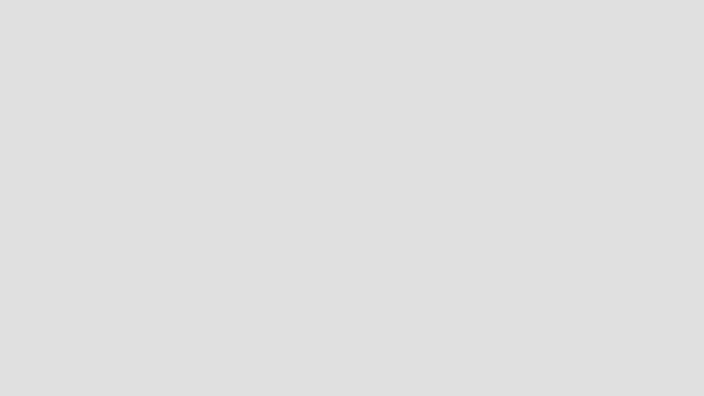Etwas ist anders, als Donald Trump in Virginia auftritt. Wie immer klatschen alle in der Halle, als der 69-Jährige in Manassas ans Rednerpult tritt. Washington ist nur 40 Minuten entfernt - jene Hauptstadt voller korrupter Politiker und Lobbyisten, die in den Augen vieler Republikaner die USA in den Niedergang führen. Das Publikum in Manassas glaubt, was auf ihren Kappen und Stickern steht: dass Donald Trump Amerika wieder zu alter Größe führen kann.
Doch am gleichen Tag schreibt der Kolumnist Dana Milbank in der Washington Post, was nicht nur in der Hauptstadt viele denken: "Donald Trump ist ein Fanatiker und ein Rassist." Zwischen diesen Polen - ungebrochene Bewunderung und wachsendes Entsetzen - bewegt sich Trumps Kampagne momentan. Und es ist dieser Außenseiter, der seit fünf Monaten nahezu alle Umfragen anführt und die Diskussion über den US-Präsidentschaftswahlkampf bestimmt - obwohl er von Latinos über Muslime, Journalisten und Frauen so viele Gruppen beleidigt hat (mehr in diesem US-Blog).
Trumps 80 Minuten langer Auftritt beginnt mit einer Schweigeminute für die Opfer der Massenschießerei in San Bernardino. Dies sei einer der Momente, in denen Amerika "stolz" sei auf seine Polizisten: "Ich könnte das nicht, was die leisten." Ein seltener Moment von Bescheidenheit, doch dann folgt Trumps typische Mischung aus Angeberei, Klagen über die Mainstream-Medien und ganz vielen Ankündigungen. Er werde Jobs aus Mexiko zurückholen, die IS-Miliz "zerstören", den Iranern die Lust an der Atombombe nehmen und China in seine Schranken weisen, sagt der Milliardär.
Es folgen Witze über den "Idioten" Barack Obama, der Klimawandel für eine größere Bedrohung hält als den "radikalen Islam". Trump klagt, dass die Obama-Regierung "Einwanderer ohne Papiere" besser behandeln würde als die eigenen Kriegsveteranen. Der Demokrat habe versprochen, die USA "vereinigen" zu wollen, doch er habe das Land gespalten. Trump, der auch mehrere schwarze Pastoren neben sich begrüßt, wirft Obama vor, sich nicht mal um Afroamerikaner zu kümmern: "Die Arbeitslosigkeit unter jungen Schwarzen ist immer enorm hoch."
"Ich stehe für eine laute Mehrheit", behauptet Trump
Diese Sätze fallen an einem für die Republikaner schwierigen Ort. Die Wähler in Virginia haben nicht nur zweimal für Obama gestimmt, sondern auch ihr Gouverneur und die beiden Senatoren sind Demokraten. Als der Kandidat Obama 2008 nach Manassas kam, wollten ihn knapp 100 000 Menschen sehen.
Zu Trump kommen "nur" einige Tausend und manche sind Verschwörungstheoretiker, die weiterhin überzeugt sind, dass Obama selbst Muslim ist und nicht in den USA geboren wurde. "Er ist aus Kenia", ruft ein Mann, als der Ex-Abgeordnete Virgil Goode ausruft, dass er es satt habe, als weißer Amerikaner nicht mehr beachtet zu werden.
Trotz seiner Witze und Attacken gegen Konkurrenten betont Trump, dass er es ernst meint mit seiner Kandidatur: "Ich bin kein Entertainer." Unter großem Jubel fügt er hinzu: "Ich weiß, wie man Dinge erledigt und ich gewinne immer." Er habe sich als Vertreter der "schweigenden Mehrheit" angesehen, ruft Trump: "Das ist aber vorbei. Ich stehe für eine laute Mehrheit."
Es ist zwar fraglich, ob Trump wirklich für eine Mehrheit spricht, doch er ist auch deshalb so populär, weil er als Republikaner höhere Steuern für Reiche fordert, die Sozialversicherung bewahren will und kritisch über das Freihandelsabkommen mit den Pazifik-Staaten spricht. So etwas kommt bei der Kerngruppe seiner Fans - jenen älteren weißen Männern, die sich als Freiwillige engagieren - extrem gut an. "Ich habe nichts gegen free trade, ich bin nur gegen dumb trade." Das ist Trumps ebenso simpler wie wirksamer Trick: Er appelliert an die Wähler, seiner Intelligenz zu vertrauen, dass er besser verhandeln werde als alle anderen.
Wieso der Ton auf allen Seiten immer rauer wird
Zwei Monate vor den ersten Vorwahlen in Iowa und New Hampshire bereitet Trumps ungebrochene Popularität dem Establishment der Republikaner enorme Sorgen. Alle sind sich einig, dass jemand den 69-Jährigen stoppen müsse, damit er nicht wichtige Wählergruppen wie Frauen und Latinos noch mehr abschreckt und die anderen Kandidaten nach rechts treibt. Doch kein Bewerber traut sich bislang wirklich, Trump zu attackieren - da alle vorherigen Versuche wirkungslos blieben und zu abstürzenden Umfragewerten führten.
Fassungslose Trump-Kritikerin
Die Washington Post zitiert aus einem vertraulichen Memo, wonach auch andere republikanische Politiker Trumps Botschaften übernehmen sollten - sie sollten ähnlich wie er Twitter intensiv nutzen und sich ähnlich kleiden. Die Analyse des Parteistrategen Ward Baker ist korrekt: "Trump ist so populär, weil ihn die Wähler als authentisch, unabhängig, direkt und stark ansehen - und weil sie glauben, dass er nicht von Interessensgruppen gekauft werden kann."
Für jeden ist diese Strategie womöglich nicht geeignet. Es erscheint fast unmöglich, dass die Pragmatiker Jeb Bush und John Kasich jemals Trump-Fans überzeugen können - und auch ein Newcomer wie Marco Rubio hat es bei wütenden Leuten wie Chris Cox schwer. Der 47-Jährige hat eine Gruppe namens "Bikers für Trump" gegründet, weil sich dieser für Verteranen einsetzt. Seine Hauptsorgen sind der "radikale Islam", der überall auf dem Vormarsch sei, sowie die illegale Migration. Syrische Flüchtlinge will er nicht aufnehmen - der zweijährige Überprüfungsprozess der US-Regierung ist ihm nicht streng genug.
Es liegt auch an Leuten wie Cox, dass die Stimmung im Vergleich zu früheren Trump-Events deutlich angespannter wirkt. Noch bevor der Milliardär ans Rednerpult tritt, werden fünf Trump-Gegner mit bunten T-Shirts von Polizisten aus der Halle geführt. Die Menge kommentiert dies mit wütenden "USA USA"-Rufen. "Wir haben nichts gerufen, wir vertreten einfach nur andere Werte", sagt eine der Aktivisten, Amanda Myers. Es macht sie fassungslos, dass so viele ihrer Landsleute Trump zum Präsidenten haben wollen: "Ich habe genauso viel Erfahrung als Politiker wie er."
Für die 26-jährige Studentin ist Trump ein Rassist, der durch seine Beleidigungen all das verrate, was sie mit Amerika verbinde. Der Satz auf der Vorderseite ihres T-Shirts richtet sich an den Immobilien-Milliardär: "Du magst zwar reich sein, aber du bist moralisch bankrott." Doch der Spruch auf ihrem Rücken klagt die Trump-Fans an: "Admit it, you love his hate."
Hass ist es wohl nicht, was die meisten Zuschauer aufs Messegelände in Manassas geführt hat. Aber Unsicherheit ist bei vielen zu spüren. Der Jubel wird am lautesten, wenn Trump über die "große und schöne Mauer" an der Grenze zu Mexiko spricht - oder dafür wirbt, keine Flüchtlinge aus Syrien einreisen zu lassen. "Es ist eine schreckliche Vorstellung, dass sich Terroristen als Flüchtlinge tarnen und in die USA einreisen könnten", sagt die 49-jährige April Glover.
Sie ist mit ihrem Mann Raymond gekommen, um Trump aus der Nähe zu sehen. Die Debatte um Trumps umstrittene Äußerungen über Muslime in New Jersey, die nach 9/11 angeblich "zu Tausenden" gejubelt haben, haben sie nicht genau verfolgt. "Da muss ich noch mehr recherchieren, aber ich halte es nicht für unwahrscheinlich", sagt Raymond.
Es ist dieses große Misstrauen gegenüber Muslimen, das Leyla al-Nozaily große Sorgen macht. Die 16-Jährige trägt ein Kopftuch und ist mit ihrer Mutter zum Messegelände zukommen, um mit eigenen Augen zusehen, wer Donald Trump unterstützt. Sie hält dessen Aussagen für unverantwortlich: "Man darf nicht eine ganze Religion als radikal bezeichnen." Sie möchte später selbst Politikerin werden: "entweder Außenministerin oder UN-Generalsekretärin".
Ihre Mutter Sherri Moore sagt, dass sie niemals für Trump stimmen werde: "Er schlägt vor, dass man uns registriert und wir Zeichen tragen, die uns als Muslime identifizieren. Wie sollen wir für so jemand stimmen?" Wie die Studentin Amanda Myers fürchtet auch Sherri Moore, dass Donald Trumps Worte dafür sorgen, dass Islamophobie und Rassismus unter Amerikanern noch gesellschaftsfähiger werden.
Am Tag nach der Rede in Manassas legt Donald Trump bei einer Veranstaltung der "Republican Jewish Coalition" nach. Auf die Frage nach der größten Bedrohung für die USA antwortet er: "Das ist momentan ganz klar der radikale Islam."