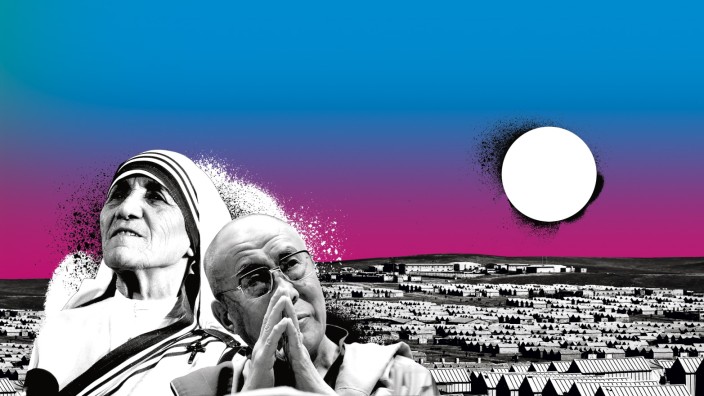Die Zeiten, da die Münchner Sicherheitskonferenz "Wehrkundetagung" hieß, sind vorbei; und die Themen, über die heute gesprochen wird, wirken vielfältiger als früher. Ging es einst fast nur um klassische Außen- und Sicherheitspolitik, diskutieren die Teilnehmer inzwischen auch über Klimawandel, Wirtschaftsprobleme oder Energieversorgung. Allerdings steht die Konferenz bei Kritikern weiterhin im Ruf, eine Hardcore-Veranstaltung von Militärstrategen und visionslosen Realpolitikern zu sein.
Ein Blick ins Programm zeigt, dass die Realität komplexer ist. Auf der diesjährigen Konferenz wird beispielsweise der Greenpeace-Chef Kumi Naidoo sprechen. Andere nutzen die Aufmerksamkeit, die diese Tagung auf sich zieht, für eigene Auftritte. So kommt der 12. Gyalwang Drukpa nach München, um, wie es heißt, "auf aktuelle weltpolitische Entwicklungen positiv einzuwirken". Seine Heiligkeit ist das spirituelle Oberhaupt der tibetisch-buddhistischen Drukpa-Tradition und Gründer des humanitären Netzwerkes Live to Love. Er verkündet, was alle gern hören: "Nichts ist unmöglich in dieser Welt, vorausgesetzt wir halten zusammen."
Die Realpolitiker wurden schon immer von Visionären herausgefordert, die das Weltgeschehen in eine große Erzählung packen, Erlösung von allen oder vielen Übeln versprechen und an einem Utopia bauen, das wahlweise als Himmlisches Jerusalem, Sonnenstaat oder klassenlose Gesellschaft angepriesen wird. Besonders geschickte Politiker schaffen es, ihre Botschaften ebenfalls in visionäre Gewänder zu kleiden. So stürmte Barack Obama mit der Verheißung einer friedlicheren Welt und dem omnipotenten Slogan "Yes, we can" das Weiße Haus. Dort ereilte ihn das Schicksal vieler Visionäre, die zu Macht gelangen: Er rieb sich an der Realität auf.
Wer kein Narrativ zu bieten hat, gilt als Langweiler
Dennoch fordern Wahlvolk und Weltöffentlichkeit von den Mächtigen immer wieder Visionen ein. Wer kein Narrativ zu bieten hat, gilt als Langweiler und wird gern bei nächster Gelegenheit abgewählt. George Bush der Ältere war so ein Fall. Als der brav-blasse US-Vizepräsident 1987 erwog, bei der Präsidentschaftswahl im Jahr darauf anzutreten, riet ihm ein Freund, sich doch ein paar Tage nach Camp David zurückzuziehen, um einige Ideen für das Land auszubrüten. Doch Bush tat dies als "the vision thing" ab. Er siegte zwar 1988, verlor dann aber vier Jahre später gegen Bill Clinton, der sich besser auf das Visionszeug verstand.
Ein Verwandter des Visionärs ist der Globalweise, der von den Bürgern als Übervater verehrt und den scheinbar schnöden Realpolitikern als positives Gegenbild vorgehalten wird. Ein Blick in die Sachbuch-Bestsellerliste des Spiegel zeigt eindrucksvoll, um wen es hier geht. Unter den zehn meistverkauften Hardcover-Titeln finden sich ein Appell des Dalai Lama, die persönliche Bilanz Helmut Schmidts, ein Buch über Papst Franziskus sowie ein Werk, das der Pontifex selbst geschrieben hat.
Weltdeutungen und Visionen sind zu einem lukrativen Geschäftsfeld geworden, das vielen Menschen Lohn und Brot verschafft. Davon zeugen die so genannten Denkfabriken, vulgo Thinktanks genannt. Sie hielten sich in den vergangenen Jahrzehnten an den Auftrag Gottes: "Seid fruchtbar und mehret Euch." Ihren Ausgang nahmen sie, wie so viele Trenderscheinungen, in den Vereinigten Staaten. Dort entstanden vor hundert Jahren die ersten Denkfabriken wie der Council on Foreign Relations oder die Brookings Institution. Heute arbeiten laut einem Forschungsbericht der Universität von Pennsylvania allein in den USA 1835 Think- tanks. In Europa sind es bereits 1770.
Utopien als vorzeitige Wahrheiten
Denkfabriken erstellen mittlerweile pausenlos und überall Strategien und Konzepte für eine bessere Welt, beraten Politiker und versuchen, bestimmte Themen, zum Beispiel die Gleichberechtigung der Geschlechter, auf die öffentliche Agenda zu bringen. Der Übergang zum gut bezahlten Lobbying auf der einen und zu karitativen Nichtregierungsorganisationen (NGOs) auf der anderen Seite ist fließend.
In manchen Ländern, zum Beispiel in den Vereinigten Staaten oder Frankreich, dienen die Denkfabriken auch als komfortabler Warte- und Regenerationsraum für Politiker abgewählter Parteien. Dort arbeiten sie an neuen Ideen und Programmen, um damit wieder an die Macht zurückzukommen. Der globale Konferenzzirkus hilft den Thinktanks, sich zu vernetzen und Aufmerksamkeit zu erringen. Dies gilt auch für die Münchner Sicherheitskonferenz. Die University of Pennsylvania stuft sie als beste Thinktank-Konferenz der Welt ein.
Von Helmut Schmidt stammt der Satz: "Wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen." Das klingt nach der Verachtung des Realpolitikers für gut gemeinte, aber wolkige Zukunftsentwürfe und für Menschen, die unzählige Papiere verfassen, die kaum einer liest. Allerdings sind viele Werke von Denkfabriken und Weltweisen mehr als nur Futter für einen sich selbst erhaltenden Betrieb zum Bau von Luftschlössern.
So klären sie die Öffentlichkeit über Fehlentwicklungen - zum Beispiel die Verschwendung von Ressourcen - auf und erarbeiten Alternativen zu scheinbar alternativlosen Entscheidungen von Regierungen. Sie helfen, im Verbund mit Nichtregierungsorganisationen, Ziele durchzusetzen, die anfangs utopisch erschienen, wie etwa die Gründung des Internationalen Strafgerichtshofs im Jahr 1998 oder die Einigung auf den Weltklimavertrag vergangenen Dezember in Paris. Und sie spornen mit dem Entwurf von Visionen dazu an, sich nicht mit den realen Missständen abzufinden.
Die oft mühseligen kleinen Schritte der Realpolitik erhalten manchmal erst vor dem Hintergrund einer positiven Utopie Sinn und Kraft, was sich etwa in der Europapolitik zeigt. Als Gegenzitat zu Helmut Schmidt mag daher hier der Ausspruch des französischen Schriftstellers und Politikers Alphonse de Lamartine stehen, Utopien seien oft vorzeitige Wahrheiten.
Die Tugendrepublik von Florenz entartete zum Tugendterror.
Allerdings kann die Verwirklichung einer Utopie zu einer gefährlichen Sache werden. Am Faschingsdienstag des Jahres 1497 ging auf der Piazza della Signoria in Florenz ein Scheiterhaufen in Flammen auf. Unzählige Dinge, die frommen Florentinern als sündhaft erschienen, wurden aufgeschichtet und verbrannt. Perücken und Karnevalsmasken, Schminkspiegel, Kartenspiele, Würfel, Skulpturen nackter Frauen, Gemälde mit sinnlichen Szenen, Musikinstrumente und Kosmetika. Erdacht hatte dieses Fegefeuer der Eitelkeiten der damals starke Mann der toskanischen Stadt: Girolamo Savonarola.
Ziel des charismatischen Dominikanermönchs war es, aus Florenz eine christliche Tugendrepublik zu machen. Etliche seiner Ideen verdienen noch heute Beifall. So half Savonarola entscheidend dabei, die Alleinherrschaft der Medici zu stürzen, die Republik wieder zu errichten und demokratische Regeln durchzusetzen. Außerdem prangerte er die Missstände in der Kirche und die Verkommenheit der Kurie in Rom unter dem skandalösen Borgia-Papst Alexander VI. schonungslos an. Dabei schätzte er allerdings die realen Machtverhältnisse falsch ein. Zudem entartete seine Tugendrepublik phasenweise zum Tugendterror. Die Folge: Am 23. Mai 1498 loderte auf der Piazza della Signoria wieder ein Scheiterhaufen. Diesmal war es Savonarola selbst, der dort verbrannte.
In Krisenzeiten erleben die Visionen eine Konjunktur
Der Fall dieses Bußpredigers verdeutlicht, wie nahe Glanz und Elend von Visionären beieinander liegen. Ihre Utopien können Gutes bewirken, aber auch ins Verderben führen. All die Zukunftsentwürfe, die Theologen, Philosophen und Schriftsteller in den vergangenen Jahrhunderten geschaffen haben, lassen sich dabei in drei Kategorien einteilen: Zur ersten gehören jene Vertröstungen auf ein besseres Jenseits, die die Menschen davon abbringen, an einem besseren Diesseits zu arbeiten. Religionen sind dafür anfällig.
Zur zweiten zählen Modelle, die das Heil einer Gruppe - einer Rasse, einer Nation, einer Klasse - über das Wohl aller anderen stellen. Solche ausgrenzenden Visionen endeten immer wieder in Katastrophen. Adolf Hitlers Rassenwahn und Josef Stalins roter Terror gehören dazu. Die Visionen der dritten Kategorie zielen dagegen darauf ab, das Los der Menschheit zu verbessern: eine Welt ohne Atomwaffen; ohne Hunger; mit Schulbildung für alle Kinder.
Eines haben all diese Arten von Visionen gemeinsam: In Krisenzeiten erleben sie eine Konjunktur. Wenn die Gegenwart bedrückend ist, sehnen sich die Menschen umso mehr nach einer erfreulicheren Zukunft und nach einem Übervater, der die Richtung weist. Auch deshalb entfaltet Papst Franziskus derzeit eine so starke geistige Wirkung; und auch deswegen gedeihen so viele Ideenfabriken und NGOs aller Couleur, während Realpolitiker viel Ablehnung erfahren.
Ein großer Horizont für viele kleine Schritte
Der Boom der Visionäre kann durchaus konstruktiv sein, solange diese - wie etwa der 12. Gyalwang Drukpa - dazu anspornen, das Gemeinwohl zu mehren. Er wird destruktiv, wenn sie einem Realitätsverlust verfallen, die Mühen der Ebene verkennen oder illiberale, totalitäre und chauvinistische Lösungen predigen. Zu letzteren gehören die Visionen von der reinen, nach außen abgeschotteten Nation, wie sie, mehr oder weniger explizit, der oppositionelle Front National in Frankreich, die regierende Pis-Partei in Polen sowie der russische Präsident Wladimir Putin propagieren. Oder, in den USA, der republikanische Präsidentschaftsbewerber Donald Trump, der sich Utopia offenbar als Herrschaft rassistischer, weißer Männer vorstellt. All diese Parteien und Politiker haben aus solchen negativen Visionen ein profitables politisches Geschäftsmodell gemacht, das in diesen Krisenzeiten besonders gut floriert.
Positive Wirkung zeigen dagegen Zukunftsvorstellungen, wie sie beispielsweise die Vereinten Nationen im Jahr 2000 mit ihren Millenniumszielen entwarfen. Ja, die Weltgemeinschaft hinkt ihrem selbst gesetzten Zeitplan beim Kampf gegen Armut, Unterernährung, Seuchen und Bildungsnotstand hinterher. Dennoch ist sie auf dem Weg zu ihren ehrgeizigen Zielen ein gutes Stück vorangekommen. Realpolitiker können von solchen Visionen profitieren, um ihren notwendigen, kleinen Schritten einen großen Horizont zu eröffnen. Visionen müssen dann kein Gegensatz zu ihrer mühsamen Arbeit sein. Oder, um es in den Worten des früheren US-Präsidenten Thomas Woodrow Wilson auszudrücken: "Wer keine Vision hat, vermag weder große Hoffnung zu erfüllen noch große Vorhaben zu verwirklichen."