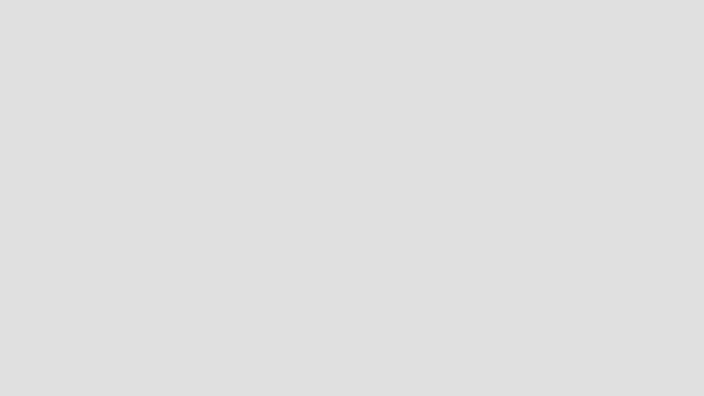Der Oberbefehlshaber ist in den Urlaub geflogen, zwei Wochen lang wird sich Barack Obama auf der Insel Martha's Vineyard erholen. Dort wurde er am Wochenende beim Golfspielen gesichtet, zuvor hatte er sich in Washington mit den Worten verabschiedet, er werde eine Weile keine Anzüge tragen. Und, übrigens, die neuesten US-Angriffe im Irak könnten noch länger dauern, sagte er auf dem Weg zum Hubschrauber.
Drei Jahre nach dem Abzug der US-Soldaten aus dem Irak fliegen amerikanische Maschinen dort wieder Kampfeinsätze. Es ist die Rückkehr in ein Krisengebiet, in dem das US-Militär von 2003 bis 2011 zäh und verlustreich gekämpft hat. Obama ist auch deshalb ins Weiße Haus gelangt, weil er versprach, jenen Krieg zu beenden. Nun hat Obama eben dort neue Luftschläge angeordnet. Aber nicht nur sein planmäßiger Urlaub zeigt, dass er die Bedeutung dieser neuesten US-Intervention herunterspielt. Er erinnert auch ständig daran, welch minimalistische Ziele er sich dort gesetzt hat.
Dem Kongress hat Obama geschrieben, Umfang und Dauer des Eingriffs seien "beschränkt"; es gehe nur darum, US-Bürger im nordirakischen Erbil zu schützen sowie Tausende Jesiden, die sich vor den Terroristen des Islamischen Staates (IS) in die Berge geflüchtet haben. Dieser Einsatz mit beschränkter Feuerkraft entspricht der Logik von Obamas Außenpolitik: Militärgewalt ist das allerletzte Mittel, der Präsident setzt sie widerwillig ein und nur nach qualvollen Abwägungsprozessen. In Libyen schritt Obama erst ein, als die Truppen des Diktators Muammar al-Gaddafi die Rebellen in Bengasi vernichten wollten. In Syrien stellte er Raketenangriffe erst in Aussicht, als das Regime Baschar al-Assads das eigene Volk mit Giftgas einnebelte.
Auch im Irak bedurfte es nun einer dramatische Ereigniskette, um Obama zu mobilisieren. Monatelang hat der Präsident beobachtet, wie sich die IS-Armee im Irak einer Stadt nach der nächsten bemächtigte. Erst in der vergangenen Woche erreichte die Krise jene Intensität, die Obama zum Handeln nötigte. In Erbil leben nicht nur mehrheitlich Kurden, also treue Verbündete der USA, dort liegt auch ein US-Konsulat. Und während die IS-Rebellen über ganze Landstriche hinwegfegten, drohten sie den fliehenden Jesiden mit dem Genozid. Hätte Obama dies geschehen lassen, hätte er sich wohl ewig Vorwürfe gemacht.
Will Obama nur US-Diplomaten in Erbil und Bagdad schützen? Ist ihm der Rest des Landes egal?
Der Präsident ist deswegen jetzt nicht über Kritik erhaben. Der republikanische Senator John McCain wirft ihm vor, er habe zu lange gewartet und tue noch immer zu wenig gegen die "mächtigste Terrororganisation der Geschichte", die nicht nur den Irak gefährde, sondern auch die USA. Die Gegner neuer Abenteuer im Nahen Osten, unter ihnen Parteifreunde Obamas, fürchten dagegen, dass sich die USA schon wieder verhängnisvoll verstricken.
Weder Freund noch Gegner ist ganz klar, welche Strategie Obama verfolgt, und ob er überhaupt eine verfolgt. Längst offenbaren sich Widersprüche: Anfangs etwa beschrieben seine Berater den Militäreinsatz als Reaktion auf eine "einmalige" Gefahr. Am Samstag sagte Obama, das Problem sei nicht in ein paar Wochen zu lösen, einen Zeitplan gebe es nicht. Es kann also Monate dauern oder Jahre. Es erinnert an die Flugverbotszonen, die die USA und Großbritannien einst über dem Norden und Süden des Irak verhängten und mehr als ein Jahrzehnt lang mit immer neuen Angriffen auf die irakische Luftabwehr verteidigten.
Obama erklärt die neue Intervention zuallererst damit, dass er US-Bürger im Irak schützen müsse, auch das Konsulat in Erbil und die Botschaft in Bagdad - dies sei seine "Pflicht". Diese leicht verständliche Begründung dürfte vor allem auf das US-Publikum zugeschnitten sein, das sich eher wenig für Kurden oder Jesiden interessiert. Was aber folgt daraus? Hat Obama den Irak aufgegeben, mit Ausnahme von Erbil und Bagdad? Um welchen Preis wird er seine diplomatischen Stützpunkte halten? Was geschieht, wenn sich die IS-Extremisten durch Luftangriffe nicht aufhalten lassen oder Bagdad das Wasser abdrehen?
Diese kleinen Fragen führen zu einer großen: Was wird Obama gegen die Terrortruppe IS unternehmen, die Teile des Irak und Syrien besetzt und ein "Kalifat", eine Art Gottesstaat ausrufen möchte? Obama fehle ein "glaubwürdiger Plan", um mit dieser Gefahr umzugehen, rügt etwa die Washington Post. Auch die Denkfabrik Center for a New American Security fordert einen "breit angelegten Einsatz", um die IS-Terroristen zu schlagen.
Am Ende, so der Präsident, müssen die Iraker ihre politischen Probleme selber lösen
Obama beteuert, dass er einen ganzheitlichen Ansatz verfolge und für Rückschläge die Iraker selbst verantwortlich seien. Aus seiner Sicht hat der schiitische Premier Nuri al-Maliki die anderen Volksgruppen, etwa Sunniten und Kurden, ausgegrenzt und gedemütigt. Deswegen sagt Obama, dass er nicht schon früher Flugzeuge schicken und die sunnitischen IS-Terroristen hätte zurückschlagen dürfen. "Das hätte nur den Druck von Premier al-Maliki genommen", erklärte er der New York Times. "Es hätte Maliki und andere Schiiten in dem Denken bekräftigt: Wir müssen keine Kompromisse machen. Die Amerikaner werden es wieder für uns richten".
Obama hat deswegen am Samstag erklärt, der wichtigste Zeitplan sei der zur Bildung einer neuen Regierung im Irak. Nach seiner Vorstellung käme diese ohne Maliki aus und würde die drei großen Volksgruppen miteinander versöhnen, was wiederum Grundlage wäre dafür, dass das irakische Militär mit amerikanischer Schützenhilfe das IS-Problem selbst lösen könnte. Obama sagt, er wolle weder die Luftwaffe der Kurden spielen, noch die der Iraker allgemein. Er sei ein Partner der Iraker, werde aber nicht deren Arbeit erledigen.
Diese Argumentation ist insoweit schlüssig, als Obama seine Militärhilfe nur zum Preis politischer Fortschritte verkauft. Doch folgt daraus wohl auch ein anderes Ergebnis: Sollten sich die Iraker weiterhin nicht einig werden, regieren eben die IS-Terroristen weite Teile des Landes.
Obama hat dieser Tage von einer Lektion aus dem Libyen-Krieg erzählt: Nach dem Militäreingriff habe man zu wenig für den Wiederaufbau getan, dies räche sich jetzt. Nun frage er sich immer, wenn er über eine Intervention entscheide: "Haben wir eine Antwort für den Tag danach?"
Im Irak scheint sie zu fehlen.