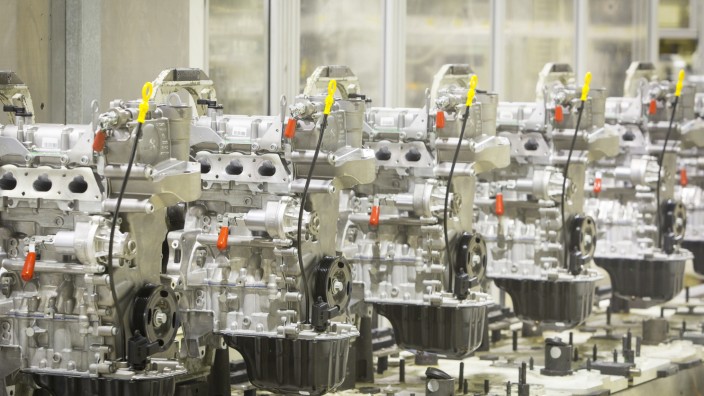Russlands Eingriff in die Ukraine. Die Entmachtung der Demokratie im beabsichtigten Investitionsschutzabkommen zwischen den USA und der EU. Die Überwachung durch die NSA. Guantanamo und Folter. Weltbank, IWF und die Bevormundung verschuldeter Staaten. Wer könnte diese Reihe verletzter Souveränität nicht beliebig fortsetzen? Nicht dass das Staatsrecht noch seine Unschuld verlieren könnte. Aber dass es im Augenblick eine Krise durchmacht, ist offensichtlich.
Auf den ersten Blick scheint der Investitionsschutz oder die Arbeitsweise der Weltbank wenig zu tun zu haben mit der großflächigen NSA-Spionage oder gar mit der Amputation der Ukraine. Das klingt eher nach Verschwörungstheorie. Doch näheres Hinsehen zeigt, dass das Recht zumindest in seiner transnationalen Dimension einem tiefgreifenden Wandel unterliegt, der solche völlig unterschiedlichen Auswüchse tatsächlich miteinander verbindet - ein Wandel, der das Recht modernisiert und zugleich entstellt.
Vattenfall will Entschädigung wegen des Atomausstiegs. Wie bitte?
Evident ist dies bei den bilateralen und multilateralen Verträgen zum Investitionsschutz, von denen weltweit bereits mehr als 3000 existieren. Allein die Bundesrepublik hat rund 130 geschlossen. Die Abkommen, ob mit Südafrika, Kasachstan, China oder Polen, folgen alle demselben Schema: Man garantiert dem ausländischen Investor, dass günstige rechtliche Standards für seine Kapitalanlage beibehalten werden, und spricht ihm einen Schadensersatz zu, falls die Garantie verletzt wird. Um den Anspruch durchzusetzen, braucht der Investor nicht vor nationale, ordentliche Gerichten ziehen, sondern darf ein Schiedsgericht anrufen. Dessen Urteile sind unanfechtbar und direkt vollstreckbar.
Sollten sich Europa und die USA jetzt, wie in den aktuellen Verhandlungen über das "Transatlantische Freihandelsabkommen" beabsichtigt, darauf verständigen, würden sich künftig auch diese beiden Wirtschaftsgiganten gegenseitig einem solchen eisernen Regulierungsmechanismus unterwerfen.
Zweifellos sorgen die Schutzabkommen für höhere Investitionssicherheit und schnellere Konfliktlösung, ein unbestreitbarer Vorteil. Aber zu welchem Preis wird er errungen? Mit welcher Rationalität?
Zweck der Abkommen ist es ja nicht, den Investor vor entschädigungsloser Enteignung zu schützen ; dazu bedürfte es keines Vertrags, das versteht sich in einem Rechtsstaat von selbst. In erster Linie soll er vielmehr geschützt werden vor veränderten rechtlichen Rahmenbedingungen, die den Wert seiner Anlage mindern. Das aber bedeutet, dass sich der vertragsschließende Staat seiner gesetzgeberischen Freiheit und gesellschaftlichen Verantwortung begibt - vor allem auf den besonders empfindlichen Gebieten des Arbeits-, Verbraucher- und Umweltschutzes. Denn das sind die Politikbereiche, die die Profitabilität von Kapitalanlagen am ehesten tangieren.
Ein bizarres, aber authentisches Beispiel ist die Investitionsschutzklage, mit der Philip Morris gegen Uruguay vorgeht, weil das Land strengere Raucherschutzgesetze erlassen hat. Der Tabakkonzern verlangt wegen der behaupteten Entwertung seiner Anlagen rund zwei Milliarden Dollar Schadensersatz. Die Summe entspricht etwa einem Siebtel des uruguayischen Staatshaushalts. Aus demselben Grund nimmt Philip Morris auch Australien in Anspruch. Deutschland wird derzeit von dem schwedischen Kernkraftbetreiber Vattenfall wegen des Atomausstiegs auf Schadensersatz von knapp 4 Milliarden Euro verklagt. Das Corporate Europe Observatory berichtet, dass im Jahr 2011 weltweit rund 450 Investmentschutzklagen von solchem Kaliber anhängig waren, womit sich ihre Anzahl seit Mitte der Neunzigerjahre verzehnfacht hätte.
Staatliche Justiz wird ausgeschaltet
Die Frivolität einer Klage wie der von Philip Morris, die die Gesundheitspolitik eines Staates zum illegitimen Hindernis einer Rentabilitätsoption herabwürdigt, illustriert, in welcher Zwangsjacke die politische Souveränität des Gesetzgebers steckt. Nicht nur in Deutschland gibt es den Straftatbestand der "Nötigung eines Verfassungsorgans" - dem Investor aber wird sie ausdrücklich zugestanden.
Nicht weniger fatal ist, dass die Schutzabkommen die staatliche Justiz zugunsten von Schiedsgerichten ausschalten. Diese Gerichte sind nicht mit Richtern, sondern mit Branchenanwälten besetzt, die von den beiden Streitparteien ausgewählt werden. (In den letzten Jahren hat ein kleiner Zirkel von 15 Anwälten weltweit über die Hälfte aller Streitigkeiten entschieden, bei Schadenssummen von über vier Milliarden sogar mehr als drei Viertel.)
Schiedsgerichte haben zwar eine große Tradition und sind bei grenzüberschreitenden Streitigkeiten zwischen Unternehmen gang und gäbe. Doch in den Investitionsschutzverfahren ist die Konstellation vor dem Schiedsgericht anders, nämlich so asymmetrisch wie der Grundkonflikt: Hier treffen der Investor und der Staat, in dem das Kapital angelegt ist, aufeinander, also das privatwirtschaftliche Verwertungsinteresse auf das - nicht zufällig meist sehr dringliche - politische Anliegen.
Es zählen unternehmerische Interessen, nicht öffentliche Anliegen
Ausgerechnet in dieser schiefen Schlachtordnung verzichten die betroffenen Staaten auf ihre eigene, öffentliche Justiz und überantworten sich privaten Schiedsleuten. Obendrein sind die Staaten bei den "Investor-Staats-Disputen" stets nur passiv beteiligt, als "Schiedsbeklagte", nie als Kläger. Das heißt: Sie können nicht ihrerseits den Investor auf diese vereinfachte Weise verklagen, falls der seine Pflichten verletzt. In dem Fall müssen sie sich an die ordentlichen Gerichte halten, deren komplizierten Entscheidungsgang sie dem klagenden Investor ersparen.
Da die Schiedsgerichte hinter verschlossenen Türen tagen, ihr Urteil unanfechtbar ist und in aller Regel noch nicht einmal veröffentlicht wird, fehlen sämtliche Faktoren, die die rechtsstaatliche Qualität von Justiz sichern: Transparenz, Überprüfbarkeit, Unabhängigkeit, Verantwortlichkeit. Der Verlust an rechtsstaatlichen Prinzipien ist umso prekärer, als der Staat in diesem geschlossenen "Geheim"-Prozess nichts weniger als seine demokratisch legitimierte Gesellschafts- und Rechtspolitik verteidigen muss - noch dazu belastet mit dem Risiko milliardenschwerer Haftung. Eine normativ verkehrte Welt.
Dennoch kommt es nicht von ungefähr, dass hier das öffentliche Anliegen ausschließlich aus dem Blickwinkel unternehmerischer Interessen und Vorgehensweisen beurteilt wird. Weltweit setzen sich Konzepte und Regelwerke durch, die auf einer ähnlichen Denkungsart beruhen.
Trotz aller gewachsenen historischen und völkerrechtlichen Bindungen und auch trotz aller geteilten ökologischen Risiken bleibt offensichtlich, dass die stärkste Dynamik für die globale Integration der Nationen bislang von der Weltwirtschaft ausgeht. Die Herrschaft der neoliberalen Marktideologie, die trotz Finanzkrise seit drei Jahrzehnten ungebrochen ist, tut ihr Übriges, sodass immer mehr internationale Schaltstellen, Institutionen und Gremien inzwischen dem regulativen Muster des ökonomischen Utilitarismus gehorchen. Ihm gilt die konventionelle Rechts- und Gesetzmäßigkeit wenn nicht als überholt, so doch als ineffizient, unflexibel und der Komplexität heutiger Problemlagen nicht mehr angemessen.
Also wird das Recht als das idealtypische gesellschaftliche Regulativ einer folgenreichen Transformation ausgesetzt, die gerne mit der Formel erfasst wird: "from government to governance". Das soll heißen, dass sich die rechtsstaatlich und demokratisch gebundene Regierungsverantwortung wandelt zur pragmatischen Lenkungsform, wie man sie vor allem in der Wirtschaftswelt entwickelt hat. "Governance" kommt der Technik der Unternehmenssteuerung nahe, sie ist unbelastet von Nationalität und Konvention, sie fragt weniger nach Regel- oder Gesetzestreue als nach Ergebnissen, Output und Machbarkeit.
Die Methoden der Finanzhilfe, Konditionierung und Kontrolle, die Organisationen wie Weltbank oder IWF gegenüber einzelnen Staaten praktizieren, gehören hierzu. Dasselbe gilt für die Praxis der Entscheidungsfindung anderer weltweit agierender Großinstitutionen, seien sie ebenso wirtschaftsnah (zum Beispiel die WTO) oder seien sie wirtschaftsfern (wie die Weltgesundheitsorganisation).
Demokratisch beschlossene Regeln geraten ins Hintertreffen
Und wie leicht zu ersehen ist, gründet sich auch ein Großteil der Initiativen der EU-Kommission auf diesem technokratisch-ergebnisorientierten Steuerungsmuster. Nicht zu vergessen die bahnbrechenden Urteile des Europoäischen Gerichtshofes, mit denen er die Deregulierung des innereuropäischen Marktes gegen die sozialpolitischen Widerstände einzelner Mitgliedsstaaten abgesegnet hat.
Der weltweite Siegeszug der Denkungsart, die sich zum geringsten mit der Befolgung von - demokratisch beschlossenen - Regeln begnügt, sondern sich primär an Nutzen und Ertrag, an Folgen, Praktikabilität und effizienter Problemlösung ausrichtet, scheint unaufhaltsam. Dieses Denken hat den Elan der Modernisierung auf seiner Seite.
Einen kompakten Überblick über die innere Metamorphose der wertgebundenen Rechtsanwendung zur mehr oder weniger wertfreien, aber ganz und gar nicht interesselosen "Steuerung" bietet ein Aufsatz des finnischen Völkerrechtlers und Diplomaten Martti Koskenniemi mit dem Titel "Miserable Comforters" (European Journal of International Relations, 2009). Anschaulich beschreibt er, wie das fortgeschrittene Denken auch die alte Begriffswelt austauscht: Regeln und Gesetze werden durch "Regulierung" ersetzt. Statt von Institutionen und Rechtsgarantien spricht man von anpassungsfähigen "Regimes" ("Menschenrechtsregime", "Handelsregime", "Sicherheitsregime"). Aus Verantwortlichkeit wird "Compliance" (hat jemand den Verhaltenskodex gebrochen, heißt es, er war "non-compliant", als ginge es nur um eine neutrale Verhaltensalternative). Statt von Recht und Gesetz spricht man lieber von "Legitimität" (viele Euro-Rettungsmaßnahmen widersprechen, so räumt man ein, den EU-Verträgen, aber sie seien "legitim"). Und darum sind den Juristen, die sich als Rechtsanwender verstehen und Sachverhalte in klassischer Art unter die geltenden Gesetze subsumieren, die pragmatisch vorgehenden "Experten der Problemlösung" vorzuziehen.
Dass beim Investmentschutz das öffentliche Gerichtsverfahren durch die von den Parteien organisierte Streitschlichtung abgelöst wird, obwohl es in der Regel um herausragende öffentliche Belange geht, liegt auf derselben gedanklichen Linie.
Angriffe auf die demokratische Souveränität, die sich "legitim" nennen
Auf der Linie liegt aber auch, dass man im "Sicherheitsregime" seit den Anschlägen vom 11. September 2001 bei Al-Qaida-Verdächtigen zu brutaleren Verhörmethoden und Haftbedingungen greift, wenn die bloße Regelbefolgung zu keinen Ergebnissen führt. Die Legitimität ergibt sich aus der Effizienz, nicht aus der Korrektheit. Datenschutzeinwände gegen die NSA-Überwachung werden mit derselben Logik zur Seite gewischt. Das instrumentelle Denken entwindet sich seiner fundamental-rechtlichen Fesseln - sieht sich aber dadurch erst recht im Dienste der Menschheit. Humanitär und legitim ist jetzt, was den Menschen angeblich nützt, nicht was "gerecht" oder "unantastbar" ist.
Aufschlussreich ist der Streit um die Behauptung Russlands, die von ihm betriebene Abspaltung der Krim sei nicht weniger gerechtfertigt als die damalige Loslösung des Kosovo mit Hilfe des Westens und der Nato. Unter völkerrechtlichen Prämissen ist die Gleichsetzung Unfug. Weder waren die Krimrussen von ukrainischen Militärangriffen bedroht wie die Kosovaren von den Serben, noch hat sich ein westliches Land den losgelösten Kosovo angeeignet wie die Russen die Krim.
Wendet man aber die rein funktionalen Kriterien des neuen Denkens an, dann hat Putin mit strategischem Geschick sein Ordnungskonzept eines "eurasischen Regimes" vorangebracht. Realpolitischer Egoismus ist diesem Denkmuster alles andere als fremd. In der effektvollen Ausdehnung der russischen Einflusszone auf die Ukraine begegnet der Westen dem rechtsneutralen Governance-Denken in hässlicher Gestalt.