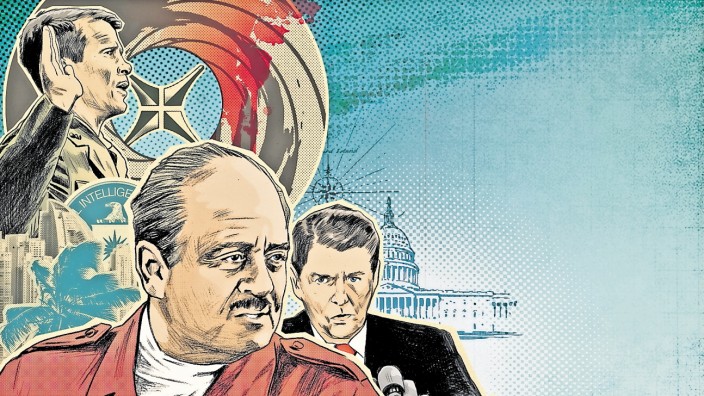Die Lieferung wird sehnlich erwartet: Am 4. Juli 1986 landet in der iranischen Hauptstadt Teheran eine viermotorige Boeing 707. Sie ist im jugoslawischen Rijeka gestartet, voll beladen mit kostbarer Ware aus den Vereinigten Staaten. Sieben Jahre nach der islamischen Revolution leidet das Regime in Iran unter den Sanktionen, die die Vereinigten Staaten von Amerika verhängt haben. Das Flugzeug bringt nun militärische Mangelware, etwa Abwehrraketen und Ersatzteile für Kampfflugzeuge - Dinge also, die eigentlich dem Embargo unterliegen.
Es ist eine typische Geheimdienstoperation: Offiziell sind Iran und die USA Erz-, wenn nicht Todfeinde. Und doch stammen die Rüstungsgüter in der Boeing von den Amerikanern. Der Geheimdienst Central Intelligence Agency (CIA) hat die Lieferung ermöglicht, im Gegenzug soll Iran die Freilassung amerikanischer Geiseln in Libanon veranlassen und Geld zahlen, mit dem die CIA dann den Aufstand der Contra-Rebellen in Nicaragua finanziert.
Die "Iran-Contra-Affäre" fliegt zwar später auf, und unter anderem muss sich Oliver North, ein Mitarbeiter des Nationalen Sicherheitsrats im Weißen Haus, vor Gericht verantworten. Aber zunächst einmal ist die Operation darauf angelegt, geheim zu bleiben. Deswegen kann die Regierung Ronald Reagans das Kriegsgerät nicht mit der US-Luftwaffe schicken. Sie braucht das, was Geheimdienste so oft benötigen, wenn sie ihre windigen Geschäfte abwickeln: Vermittler, Zwischenhändler, Firmen, Flugzeuge, die sich nicht dem Staat zuordnen lassen. Notwendig ist, was man im Geheimdienstjargon plausible deniability nennt: Höchstes Gebot ist es demnach, dass man hinterher alles "glaubwürdig abstreiten" kann.
Die Maschine, die 1986 in Teheran landet, ist in den USA registriert und gehört allem Anschein nach einem Mann namens Farhad Azima, der im US-Staat Missouri lebt. Azima ist Exil-Iraner und Geschäftsmann. Ein Leben lang verdient er sein Geld damit, dass er Flugzeuge vermietet oder verleast. Er beteuert, dass er von der CIA-Lieferung nach Teheran mithilfe einer seiner Maschinen nichts gewusst habe. "Mit Iran-Contra hatte ich nichts zu tun", sagt er auf Anfrage. "Jede denkbare US-Behörde hat mich überprüft und gefolgert, dass an dem Verdacht absolut nichts dran ist. Es ist eine sinnlose Jagd."
Nun gewähren die Panama Papers neue Einblicke in das Geschäftsleben von Azima und einem halben Dutzend anderen schillernden Persönlichkeiten, die seit Jahrzehnten immer wieder im Dunstkreis der Geheimdienste vermutet werden. Viele sollen der CIA geholfen haben, auch wenn die Betroffenen dies dementieren. In den Akten aus der panamaischen Kanzlei Mossack Fonseca finden sich zwar bislang keine direkten Zahlungen der CIA, dafür aber etliche Verhaltensmuster, die aus dem Agentenmilieu bekannt sind: dubiose Firmenkonstrukte, Geschäfte mit gebrauchten Flugzeugen, Partnerschaften unter zwielichtigen Figuren.
"Man kann halt nicht einfach rumlaufen und sagen, dass man Agent ist"
In den Akten von Mossack Fonseca, die der Süddeutschen Zeitung zugespielt und zusammen mit dem Internationalen Konsortium Investigativer Journalisten (ICIJ) ausgewertet wurden, finden sich zahlreiche Namen aus der Welt der Spionage: Zwei Verdächtige der Iran-Contra-Affäre, ein mutmaßlicher Helfer der CIA für Waffenlieferungen nach Afghanistan, hohe Ex-Verantwortliche der Geheimdienste Saudi-Arabiens, Kolumbiens und Ruandas.
Darunter: der 1999 verstorbene Saudi Scheich Kamal Adham, der in den 1970er- Jahren der wichtigste Verbindungsmann der CIA für die Region gewesen sein soll. Ferner: der griechische Unternehmer Sokratis Kokkalis, den die Stasi einst als "Agent Rocco" führte. Und natürlich: der deutsche Privatagent Werner Mauss, der über Mossack Fonseca allein ein Dutzend Briefkastenfirmen führte oder führt.
Auffällig ist, mit welcher Selbstverständlichkeit diese Profis für Geheimoperationen Briefkastenfirmen verwenden - teilweise auch dann noch, wenn sie längst im Ruhestand sind. Es wirkt wie eine alte Gewohnheit, die man nicht mehr ablegen kann. Die Akten offenbaren, dass die Offshore-Konstrukte von Mossack Fonseca wohl nicht nur mutmaßlichen Steuerhinterziehern und anderen Kriminellen geholfen haben, sondern auch jenem Milieu, in dem von Berufs wegen ein endloser Bedarf an Verschleierung herrscht - dem der Spione.
Das Phänomen ist leicht zu erklären. "Man kann halt nicht einfach rumlaufen und sagen, dass man ein Agent ist", sagt der amerikanische Professor Loch Johnson, der einst an parlamentarischen Untersuchungen im US-Kongress beteiligt war und als Experte für CIA-Tarnfirmen gilt. Wie jeder Mensch braucht auch ein Spion, Geiselbefreier oder Waffenschmuggler eine Logistik, das beginnt schon bei einem Konto und einer Kreditkarte, mit der er sein Hotelzimmer bezahlt. Manchmal wird auch Bargeld benötigt, ein Schiff oder ein Flugzeug. In allen Fällen soll eine Tarngesellschaft den wahren Auftraggeber oder Interessenten verbergen.
Bei James Bond kommt oft die Firma "Universal Exports" vor
Weil das schon Ian Fleming wusste, kommt in seinen Romanen über den britischen Geheimagenten James Bond oft die Firma "Universal Exports" vor, deren Name so nichtssagend klingt, dass er schon wieder vielsagend ist. Wenn sich der Agent Bond also über ein gewöhnliches Telefon in London melden muss, gibt er sich als Geschäftsreisender aus, der seinen Chef bei der Exportfirma anruft. Er redet dann über Belanglosigkeiten, deren Sinn nur der britische Geheimdienst versteht.
"Universal Exports" ist so sehr zum Inbegriff geheimdienstlicher Tarnung geworden, dass sie von Geschäftspartnern Mossack Fonsecas bis heute erwähnt wird. Als ein Treuhänder 2010 an die panamaische Kanzlei schreibt, um für einen Kunden eine Gesellschaft einrichten zu lassen, scherzt er über den möglichen Firmennamen: "Ich schlage mal 'World Insurance Services Limited' vor, oder vielleicht 'Universal Exports' wie in den frühen Bond-Geschichten. Aber ich weiß nicht, ob wir das durchkriegen." Viele Firmennamen in den Listen Mossack Fonsecas deuten darauf hin, dass sich die Beteiligten gefühlsmäßig der Welt der Spionage annähern wollen; Gesellschaften heißen also "Goldfinger", "SkyFall", "Moonraker", "Spectre" und "Blofeld", alles Bond-Begriffe. Sind die Kunden des Offshore-Geschäfts lustig, oder sind sie nur zynisch?
Mehr noch als zu Agentenfilmen aber finden sich in den Akten Spuren in die wirkliche Welt der Geheimdienste. Ein Beispiel dafür ist Loftur Johannesson, ein vermögender 85-Jähriger aus Reykjavík. Mehrere Artikel und Bücher haben Johannesson in die Nähe der CIA gerückt, unter anderem soll er Waffen an die antikommunistischen Aufständischen in Afghanistan geliefert haben. Johannesson bestreitet dies. Vom Jahr 2002 an taucht er im Zusammenhang mit mindestens vier Firmen auf, die Mossack Fonseca verwaltet, und deren Sitz auf den Britischen Jungferninseln oder in Panama liegt.
Es ist nicht klar, warum Menschen wie Johannesson auch als Rentner noch Offshore-Firmen brauchen oder warum sie dort womöglich Teile ihres Vermögens untergebracht haben. Vermutlich ist es schwierig, Erlöse aus geheimen Geschäften auf ein gewöhnliches Konto zu übertragen, ohne Verdacht zu erregen. Ähnliche Fragen werfen auch die Briefkastenfirmen des deutschen Privatagenten Mauss auf. Benötigt (oder benötigte) er sie, um Lösegelder zu bewegen, Provisionen zu kassieren - oder schlicht um Steuern zu sparen? Gegen Mauss ermittelt nach Informationen der Süddeutschen Zeitung die Staatsanwaltschaft Bochum wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung; Mauss hat den Vorwurf der Steuerhinterziehung ausdrücklich bestritten.
Der Betrieb von Flugzeugen (oder der weltweite Handel damit) scheint zu einem jener Geschäftsbereiche zu gehören, in denen man sehr oft auf Geheimdienste oder deren mutmaßliche Helfer trifft. Der Exil-Iraner Farhad Azima zum Beispiel, dessen Boeing 707 einst Waffen nach Teheran geflogen haben soll, taucht vom Jahr 2000 an in den Akten Mossack Fonsecas auf; damals lässt er eine Briefkastenfirma auf den Britischen Jungferninseln namens ALG (Asia & Pacific) Limited eintragen, offenbar eine Filiale seiner US-Firma Aviation Leasing Group in Missouri, die mehr als 60 Maschinen betreibt.
Erst 13 Jahre später erkennt man bei Mossack Fonseca, dass man es womöglich mit einem Mann aus dem Geheimdienstgewerbe zu tun hat. Die Mitarbeiter Mossack Fonsecas stoßen da auf Berichte, die Azima in Verbindung mit der CIA bringen. So soll er in den späten 1970er-Jahren einer Firma namens Eatsco (Egyptian American Transport and Services Corporation) dabei geholfen haben, Waffen nach Libyen zu liefern. Die Firma Eatsco gehörte mehreren ehemaligen CIA-Agenten. In den Büros Mossack Fonsecas wird man unruhig, als man davon erfährt, und bittet einen Vertreter Azimas, dessen Identität zu bestätigen. Die Kanzlei erhält keine Antwort, aber sie geht der Sache offenbar auch nicht weiter nach. Manchmal scheint es besser zu sein, es nicht genau zu wissen. Die Kanzlei hat auf Anfrage erklärt, sie überprüfe sämtliche ihrer Kunden "gründlich". Zu konkreten Fällen äußerte sie sich nicht. Man bedauere aber "jedweden Missbrauch unserer Dienstleistungen".
Der schillernde Kunde Azima besitzt noch einen weiteren dubiosen Kontakt: Im November 2011 trägt ihn die Kanzlei Mossack Fonseca ausweislich der Unterlagen als Co-Direktor einer Firma namens Eurasia Aviation Holdings Limited ein. Dem Anschein nach geht es wieder einmal um Flugzeuge. Ein weiterer Co-Direktor dieser Firma heißt Houshang Hosseinpour (ebenfalls im Luftfahrtgeschäft tätig); die US-Regierung wirft ihm später vor, er habe Sanktionen gegen Iran umgangen. Doch im Februar 2012 erklärt die Firma Eurasia Aviation plötzlich, Hosseinpour habe in Wahrheit nichts mit dem Unternehmen zu tun - dass sein Name vorkomme, sei ein "Verwaltungsfehler". Wenig später kauft die Firma tatsächlich ein Flugzeug.
Diese Abläufe belegen für sich genommen keinen Kontakt zur CIA, aber sie zeigen die Selbstverständlichkeit, mit der Figuren aus dem Dunstkreis der Geheimdienste in der Welt der Briefkastenfirmen ein- und ausgehen. Ein weiteres Beispiel dafür ist Adnan Kashoggi: Der saudische Milliardär soll in den 1970er-Jahren Rüstungsverkäufe nach Saudi-Arabien eingefädelt haben. Einem Bericht des US-Senats zufolge spielte er auch eine "zentrale Rolle" dabei, der CIA bei geheimen Waffenverkäufen an Iran zu helfen.
Auch Kashoggi taucht in den Unterlagen Mossack Fonsecas auf: Vom Jahr 1978 an firmiert er als Chef der panamaischen Gesellschaft Isis Overseas S.A. In den Unterlagen finden sich im Zusammenhang mit Kashoggi noch vier weitere Firmen, am meisten nutzte er sie zwischen den 1980er- und den 2000er-Jahren. Was diese verschleiern sollten, ist unklar.
Briefkastenfirmen für Geheimdienste müssen nicht nur in Steueroasen liegen
Aber die Akten bestätigen die Vermutung, dass das Milieu der Agenten, Waffenhändler und Geiselbefreier eine heimliche Finanz-Infrastruktur braucht, ferner Kanzleien wie Mossack Fonseca, von denen sie nicht allzu viele Fragen erwarten. So findet sich kein Hinweis darauf, dass die panamaische Kanzlei die Vita ihres Kunden Kashoggi mit größerem Aufwand ausgeleuchtet hätte. Sie tat es allem Anschein nach nicht einmal dann, als Kashoggi im Jahr 1990 in die Schlagzeilen geriet: Die US-Regierung hatte ihn angeklagt, weil er angeblich dem philippinischen Präsidenten Ferdinand Marcos geholfen habe. Kashoggi wurde später freigesprochen.
Natürlich müssen Briefkastenfirmen für Geheimdienste nicht allein in exotischen Steuerparadiesen liegen: Vermeintliche Privatfirmen, die in Wahrheit für die CIA arbeiten, lassen sich auch mitten in den USA gründen. Ein Beispiel aus jüngerer Zeit ist ein Netz aus einem halben Dutzend US-Unternehmen, die etwa Aero Contractors Limited, Pegasus Technologies oder Tepper Aviation heißen: Sie geben sich als private Anbieter von Charterflügen aus, betreiben in den Jahren nach 2001 aber 26 Flugzeuge, die in Wahrheit der CIA gehören.
Die Agency benutzt die Maschinen damals für ihren globalen Krieg gegen den Terror und fliegt damit Al-Qaida-Verdächtige von einem Geheimgefängnis zum nächsten Folterverlies. Wie die Waffenlieferungen nach Iran sind auch die Gefangenentransporte etwas, das die Regierung nicht unter eigenem Namen abwickeln kann. Die New York Times, die das Geschäft von Aero Contractors und anderen offengelegt hat, zitiert einen früheren CIA-Agenten mit den Worten: "Wenn die Politik der CIA eine Aufgabe anvertraut, dann meist deswegen, weil das Wort 'US-Regierung' eben nicht überall draufstehen soll."
Offensichtlich haben Briefkastenfirmen und Steuerparadiese also etlichen Figuren aus der Schattenwelt dabei geholfen, ein Doppelleben zu führen. Der Exil-Iraner Farhad Azima soll einerseits immer wieder an dubiosen Waffendeals beteiligt gewesen sein. Aber bewiesen wurde es nie, und so kann sich Azima in seinem anderen, oder späteren Leben in der High Society sehen lassen - als Geschäftsmann und gern gesehener Spender von US-Politikern. Azima hat Republikanern und Demokraten Geld gegeben; er ist vom damaligen Präsidenten Bill Clinton mehrmals im Weißen Haus empfangen worden und hat auch den Wahlkampf von Clintons Ehefrau Hillary unterstützt.
Zehn Jahre nach der Iran-Contra-Affäre, im September 1996, erscheint Bill Clinton während des Wahlkampfs in einem Hotel in Kansas City und führt den Chor jener an, die für den Gastgeber "Happy Birthday" singen. Der Gastgeber, der eine Spende in Höhe einer Viertelmillion Dollar in Aussicht gestellt hat, ist Farhad Azima.