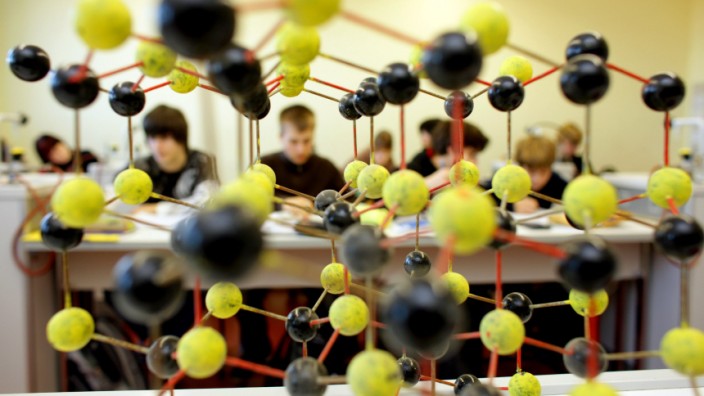Es riecht nach Schnaps im Keller der Universität, der Geruch zieht in Schwaden durch die Flure. Da stehen Flaschen - Obstler, Wodka, Marillenbrand. Nicht der Geheimvorrat des Hausmeisters, sondern Unterrichtsmaterial. "Nicht zum Trinken", sagt die Labormitarbeiterin mahnend, und in den Blicken einiger Oberstufenschüler liegt Enttäuschung. Aus der badischen Provinz sind sie an das Karlsruher Institut für Technologie (Kit) gekommen. Um zu lernen, um zu sehen, wie Naturwissenschaftler arbeiten. Gerade analysieren sie Alkohole in einem bauchigen Apparat. "In der Schule gibt es meist viel Wissen, aber wenig Brüten, Tüfteln, Knobeln. Das entspricht nicht unserem Berufsbild", sagt die Dozentin im Labor. "Wir arbeiten, bis das Experiment fertig ist, und nicht, bis der Gong schlägt. Das wollen wir den Schülern vermitteln."
Tatsächlich kann es sich eine Hochschule heutzutage kaum leisten, nichts anzubieten, was die Neigung zu den Mint-Fächern - Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik - beflügelt. "Wenn Klassen bei uns ein- und ausgehen, kann Schulbildung nachhaltig verankert werden", sagt Alexander Wanner, Vize-Präsident des Kit. Da stehe eine staatliche Universität in der Pflicht, Schulprojekte seien ein Schaufenster, um zu zeigen, was mit öffentlichem Geld geschehe. Ziel sei auch, "Neugier auf Wissenschaft und Technik" zu wecken, die "Rekrutierung von Nachwuchs", und offenbar hat der Maschinenbau-Professor künftige Exzellenz-Forscher und Nobelpreisträger vor Augen, wenn er sagt: "Es ist wie im Sport: ohne Breite keine Spitze."
40 Prozent der Schulabgänger wählen ein Mint-Fach oder eine technische Ausbildung
Nicht nur an Hochschulen denkt man so: Initiativen und Netzwerke, Arbeitgeberverbände und Unternehmen, orchestriert von der Politik, treten seit Jahren für Mint-Förderung ein. Und die Schulen springen darauf an: Wenn das Kit im Internet die Labortermine ausschreibt, für die sich Lehrer anmelden können, ist binnen 24 Stunden alles ausgebucht. Es gibt Schülerlabors, Mint-Excellence-Center an Schulen, Jugendliche können einem Mint-Slam zuhören und etwas über die "Liebe zu Ionen" erfahren; Mint-Blogs, Mint-Youtube-Videos, Mint-Wettbewerbe.
Es war vor gut zehn Jahren, als vor allem die Sorge um den Ingenieurmangel in die Öffentlichkeit drängte. Der Befund, den Arbeitgeber- und Industrieverbände anstellten: Deutschland gingen die Ingenieure und Naturwissenschaftler aus, die Tüftler, die Erfinder - der Wohlstand der Republik stehe auf dem Spiel. Immer weniger Schüler wollten Chemie, Physik, Maschinenbau oder Elektrotechnik studieren - und bei den Fächern schwinge stets mit, dass sie abstrakt und schwierig seien, aber auch der Ruf des Zausels, Langweilers, Strebers. Das sollte sich ändern. Seitdem fließt Geld, Engagement und viel Marketing in Mint.
Mit Erfolg. Ende vergangenen Jahres konnten die Bundesbildungsministerin und die damalige Chefin der Kultusministerkonferenz in Berlin einen OECD-Bericht präsentieren, der Deutschland ein unerwartet gutes Zeugnis ausstellte. Ein Aspekt erfreute die CDU-Politikerinnen Johanna Wanka und Brunhild Kurth besonders. "Trendfarbe Mint", war die Pressemittelung getitelt, der Jubel schon biografisch bedingt: Wanka ist von Beruf Mathematik-Professorin, Kurth war vor ihrer Kultuskarriere in Sachsen Chemielehrerin. Der Bericht jedenfalls zeigte: Schulabgänger entscheiden sich nun häufig für ein Mint-Studium oder eine Technik-Ausbildung: 40 Prozent, im Durchschnitt der OECD-Länder sind es nur 26 Prozent. Das sei, sagte Wanka, "für uns als Technologieland zukunftsweisend. Unsere zahlreichen bildungspolitischen Anstrengungen der vergangenen Jahre, junge Leute für Mint-Berufe zu begeistern, zahlen sich aus".
In einer Analyse des Stifterverbands für die Wissenschaft heißt es sogar: "Ein allgemeiner Fachkräftemangel in den Mint-Berufen, wie er noch vor ein paar Jahren befürchtet wurde, droht eher nicht mehr." Vor allem sei "der akute Mangel an ingenieurwissenschaftlichem Nachwuchs, der bis Mitte der 2000er-Jahre zu beobachten war, vorerst überwunden". Neue Töne aus dem Verband, zu dessen Trägern Dax-Konzerne zählen. "Auf ingenieurwissenschaftliche Studiengänge gab es sogar einen regelrechten Run", präzisiert Karl Brenke, Arbeitsmarktexperte am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung Berlin, in einer Studie. Die Folge: "zunehmend Beschäftigungsprobleme". Wenn auch in absoluten Zahlen auf niedrigem Niveau, so ist laut der Analyse zuletzt die Zahl der arbeitslosen Ingenieure um ein Drittel, die der Chemiker ohne Job um ein Viertel gestiegen.
Wann immer noch vom Ingenieursmangel die Rede ist, gibt es nun Aufregung. Als die Süddeutsche Zeitung über ein Mint-Papier der Arbeitgeber berichtete, meldeten sich: Ein Ingenieur mit sehr gutem Abschluss, der seit der Master-Arbeit bei einem Autobauer von einem Honorar-Projekt zum nächsten weitergereicht wird; ein promovierter Chemiker, der beim Stichwort Fachkräftemangel in Wut gerät, mehr als 100 Bewerbungen habe er geschrieben; ein Informatiker, der angesichts all der Job-Absagen mutmaßt, die Wirtschaft "zielt durch ein künstliches Überangebot auf Lohndumping" ab; ferner Bioprozesstechniker und Maschinenbauer, Dutzende Empörte.
Keineswegs repräsentativ - aber ein Hinweis, dass trotz guter Konjunktur die Lage nicht rosig ist. Oder nie so rosig war. Brenke schreibt: "Im Falle der industrienahen Ingenieure und anderer sogenannter Mint-Berufe haben sich junge Leute offenbar von den Klagen der Unternehmen und ihrer Verbände über einen angeblichen Fachkräftemangel leiten lassen."
"Ein super Angebot mit Möglichkeiten, die es an der Schule nicht gibt" sei der Uni-Ausflug, sagt einer der Lehrer, der mit seinen Schülern in Karlsruhe das Labor erkundet. Die Jugend in Mint-Fächer hineindrängen wolle er nicht, "aber mal reinriechen lassen, um sich ein Bild zu machen". Im Grunde mischen sich am Kit bei den Schülern Begeisterung und bloße Anwesenheit. "Endlich mal was selber machen", gluckst ein blondes Mädchen, ihre Gruppe bastelt Brennstoffzellen, es funkt und knallt. Ein Junge mit Igelfrisur zählt derweil lieber die Rillen an der Decke und gähnt. Einige können sich einen Mint-Beruf vorstellen; andere geben offen zu, den naturwissenschaftlichen Zweig am Gymnasium nur gewählt zu haben, um die dritte Fremdsprache zu umgehen. "Keine Lust auf noch mehr Vokabeln", sagt einer. Ein anderer: "Sprachen kann ich halt gar nicht, dann lieber das."
Also lieber Mint. Oder, wie es bei Lego Education heißt: "21.-Jahrhundert-Skills". Mint ist längst auch ein Geschäftsmodell. Grasbrunn in der Nähe von München, Lego lädt zur Produktvorstellung, die Spielzeugfachpresse ist da, aber auch Bildungsjournalisten. Neu im Sortiment: ein Baukasten für Grundschüler, mit dem klassisch mechanisch gebaut, aber auch programmiert wird. Eine Blume wird von einer Lego-Biene über eine App angeflogen, solche Dinge. Es gehe um "Freude am Problemlösen und Technik", sagt ein studierter Lehrer, der die Neuheit mitentwickelt hat. "Es gibt den Bedarf an kompetenzorientiertem Lernen." Damit hat er recht: Die Schulministerien gehen gerade dazu über, in Lehrplänen übergreifende Kompetenzen statt haarklein Inhalte zu definieren. Beispiel "technisches Problemlösen". Man schaut im Konzern genau darauf, was sich in den Amtsstuben tut. Niemand bestreitet bei Lego, dass es letztlich um Absatz geht. Das funktioniere unkompliziert: Wenn Schulen sich entscheiden, Lego-Baukästen und die Software anzuschaffen, fänden sich meist Budgets.
Professoren kritisieren den Mint-Hype und den Einfluss der Wirtschaft auf die Schulen
Viele Lehrer anderer Fächer schauen allmählich genervt auf den Mint-Rummel. "Die Schulen haben Angst, nicht bei dem Trend dabei zu sein, und laufen alle mit", sagt ein bayerischer Deutschlehrer, altgedient. Für Schülerlabors oder Mint-Koffer sei plötzlich Geld da, Schulbibliotheken verlotterten. "Man stelle sich mal vor, Germanisten, Philosophen und Historiker würden Lobby-Arbeit dafür machen, dass ihre Fächer die wichtigsten sind - da würden alle in Gelächter ausbrechen." Auch einen Wandel im Bewusstsein macht der Pädagoge aus: Früher habe man damit kokettiert, schlecht in Mathe zu sein, das habe als tolerierbare Schwäche gegolten. Inzwischen kaum noch - dafür sei schlechte Rechtschreibung "zur lässlichen Sünde geworden". Drastisch steht das in einem Papier der Gesellschaft für Bildung und Wissen, einer Vereinigung von Professoren gegen "ökonomische Übergriffe auf das Bildungssystem". Darin wird beklagt, dass der Mint-Hype zur "Halbierung des menschlichen Erkenntnisvermögens" führe, und dass die Wirtschaft Schulen längst "als Vorschulen für den Ingenieur" sehe.
Die Lobby-Arbeit der Arbeitgeber- und Industrieverbände geht indes weiter, jedoch die Strategie scheint sich geändert zu haben. Einen generellen starken Ingenieurmangel, hieß es bei einem Podium in Berlin, gebe es nicht mehr. Aber mit Blick auf die demografische Entwicklung sei der Bereich "noch nicht abgesichert". Auch müssten Frauen stärker auf Mint aufmerksam gemacht werden, zudem richte sich der Fokus auf technische Lehrberufe - mehr als die Hälfte eines Jahrgangs studiert aktuell, dem dualen System drohen Engpässe. Auch gibt es einen neuen Schwerpunkt: Digitalisierung. Beim jüngsten "Nationalen Mint-Gipfel, der vor ein paar Wochen stattfand, hat man sich rein auf den zweiten Buchstaben des Mint-Wortes verlagert. I wie Informatik. Sechs "Kernforderungen" für digitale Bildung hat der Gipfel aufgestellt, die Schulen bräuchten etwa "Pflichtzeit" und neue Konzepte für digitale Bildung. Das Tüfteln im Labor kam praktisch nicht mehr vor.
Weil genug getan wurde? Was auffällt, bei den Schülern in Karlsruhe: Mit dem Bild von der drögen Naturwissenschaft, vom verrückten Bastler kann keiner etwas anfangen. "Nerds sind doch cool", sagt ein Junge, und nennt die Fernsehserie "The Big Bang Theory". Sie handelt von vier jungen Wissenschaftlern, ihrem Leben zwischen Physik-Lehrstuhl, Comichefte-Laden und Chaos-WG. Der Junge argumentiert: "Die haben sogar Freundinnen."