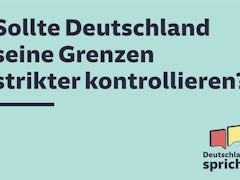Edgar Grande war Professor am Geschwister-Scholl-Institut für Politikwissenschaft der Ludwig-Maximilians-Universität München. Seit November 2017 ist er Direktor des neu gegründeten Zentrums f ür Zivilgesellschaftsforschung am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB).
SZ: Was ist mit Zivilgesellschaft eigentlich gemeint?
Edgar Grande: Allgemein geht es um den freiwilligen Zusammenschluss von Bürgerinnen und Bürgern, die sich jenseits von Familien, Staat und Unternehmen engagieren. Der Begriff wird vor allem seit Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre verwendet, nachdem in Osteuropa Bürgerbewegungen den Demokratisierungsprozess vorangetrieben haben. Deshalb wird Zivilgesellschaft überwiegend positiv mit Demokratisierung in Verbindung gebracht.
In den USA ist der Begriff zur gleichen Zeit vor allem im Zusammenhang mit Non-Profit-Organisationen verwendet worden, die sich als Alternativen zur kapitalistischen Marktwirtschaft begreifen. Aber auch Vereine gelten als wichtige Säulen der Zivilgesellschaft. Da sehen Sie schon, wie breit das Spektrum ist.
Ihre Kollegin Naika Foroutan vom Berliner Institut für empirische Integrations-und Migrationsforschung (BIM) hat im Tagesspiegel kürzlich gesagt, in der Zivilgesellschaft formierten sich neue Gruppen, die für eine Verbesserung der sozialen Verhältnisse eintreten. Die Rechte stellt sie dieser Zivilgesellschaft gegenüber.
Das ist die in den Sozialwissenschaften vorherrschende Einschätzung: Auf der einen Seite die Zivilgesellschaft als Zusammenschluss der Bürgerinnen und Bürger, die am Gemeinwohl orientiert sind, die "Guten". Und auf der anderen Seite die radikalen Rechten, die "Bösen". Die neuen sozialen Bewegungen, die in den 1970er Jahren entstanden sind, waren ja auch tatsächlich vor allem links-liberale, emanzipatorische Bewegungen. Die Rechten haben eher versucht, zu Wahlen zu mobilisieren und dort ihren Protest zu artikulieren.
Das hat sich geändert. Wir erleben in der Zivilgesellschaft das Entstehen neuer, rechter Bewegungen, die ganz offensichtlich andere Ziele verfolgen als die, die wir in den vergangenen Jahren als zivilgesellschaftlich bezeichnet haben. Wenn wir das ignorieren, dann besteht die Gefahr, dass uns wichtige Entwicklungen innerhalb der Zivilgesellschaft entgehen.
Von welchen Gruppen sprechen Sie?
Auch Pegida ist ein Teil der zivilgesellschaftlichen Protestlandschaft, das "Frauenbündnis Kandel", das seit dem Mord an einer jungen Frau dort immer wieder demonstriert, das "Aktionsbündnis für Heimat, Familie und Tradition" in Chemnitz oder die Teilnehmer an Demonstrationen, zu denen die AfD aufruft. Eines der bekanntesten Beispiele ist die Tea-Party-Bewegung in den USA.

Die Gesellschaft ist gespalten, Rechtspopulisten feiern Erfolge, der Diskurs verroht: Demokratieforscher Wolfgang Merkel über Gefahren für die Gesellschaft - und Lösungsansätze.
Die Forschung hat übrigens schon vor Jahren beobachtet, dass die Zivilgesellschaft dunkle Seiten haben kann. Der US-Wissenschaftlerin Sheri Berman von der Columbia University zufolge ist die Weimarer Republik nicht an einer Schwäche der Zivilgesellschaft gescheitert, sondern an ihrer Instrumentalisierung durch die Nationalsozialisten. Denen ist es damals gelungen, zum Beispiel Veteranenvereine wie den "Stahlhelm" und patriotische Vereinigungen für sich zu nutzen.
Lässt sich die Situation damals denn tatsächlich mit heute vergleichen?
Ich will nicht den Eindruck erwecken, die Situation in Deutschland wäre die gleiche. Aber das Beispiel zeigt uns, wohin es letztlich führen kann, wenn in der Zivilgesellschaft radikale politische Organisationen mit fundamental unterschiedlichen Zielen und Interessen gegeneinander stehen. Solche Phänomene kann ich nur in den Blick bekommen, wenn ich einen normativ offenen Begriff von Zivilgesellschaft habe, und nicht die gute Zivilgesellschaft dem "Bösen" gegenüber stelle.
Eine "böse" Seite der Zivilgesellschaft ist zumindest für die Bundesrepublik ein neues Phänomen. Wie ist es dazu gekommen?
Wir erleben eine grundsätzliche Verschiebung politischer Konfliktlinien. Lange Zeit haben vor allem soziale und ökonomische Themen die politischen Auseinandersetzungen bestimmt, es ging um Verteilungskonflikte. Die Einstellungen dazu wurden mehr oder weniger eindeutig auf der die politische Debatte noch immer bestimmenden "Links-Rechts-Skala" verortet. Die Linken wollten mehr Staat, die Rechten mehr Markt.
Aber seit einigen Jahren sind Konflikte immer wichtiger geworden, die im Zuge der Globalisierung und der Europäischen Integration entstanden. Die Vorstellung, dass man sich mit einem Nationalstaat identifiziert, dass die Grenzen dieses Staates bestimmen, wer Rechte, Pflichten und Anspruch auf Leistungen hat, ist nicht mehr selbstverständlich. Und die maßgeblichen Wirtschaftsräume sind immer weniger die nationalen Märkte; die Staaten haben immer weniger Kontrolle darüber, wer Zugang zu ihnen hat.

Damit stellen sich grundlegende Fragen der politischen Zugehörigkeit und Identität. Es geht nicht mehr so sehr darum, wem was gehören soll. Heute geht es stärker um die Zugehörigkeit zu politischen Gemeinschaften und gesellschaftlichen Gruppen. Es geht um die Frage: Mit wem soll ich mich identifizieren? Mit Brüssel? Mit dem Nationalstaat? Mit einer Region?
Deshalb beobachten wir zum Beispiel die Konflikte zwischen Kosmopoliten oder Befürwortern der EU einerseits und Nationalisten andererseits. Es gibt ja neuerdings eine bemerkenswerte, vor allem von jüngeren Menschen getragene Bewegung für Europa. Es gibt aber auch einen neuen Nationalismus in Mitgliedstaaten der EU.
Ein weiteres, besonders wichtiges Thema ist Zuwanderung.
Auch hier stellen sich viele Menschen Fragen zur Identität: Wer gehört außer mir zu der Gemeinschaft, mit der ich mich identifizieren soll? Welche Werte, welche Normen sollen diese Gemeinschaft zusammenbinden? Was wird das für eine Gesellschaft sein, die sich hier entwickelt?
Hier kommt es zum Konflikt zwischen denen, die für Offenheit und Gleichberechtigung von Minderheiten sind, und jenen, die mehr Abschließung und Abgrenzung wollen. Wir konnten einerseits sehen, wie eine große Zahl von Menschen sich in Helfervereinen und Initiativgruppen organisieren, um Flüchtlingen zu helfen. Das hat eindrucksvoll vor Augen geführt, wie stark die Zivilgesellschaft im Sinne der Gemeinwohlorientierung sein kann. Aber auf der anderen Seite gibt es die Gegenbewegungen: Proteste gegen eine angeblich drohende Islamisierung Europas, Demonstrationen vor Flüchtlingsunterkünften.
Entscheidend ist, dass die wahrgenommenen oder erwarteten wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Veränderungen nicht von allen Bürgern in gleicher Weise bewertet werden: Es gibt Menschen, die sich als Gewinner betrachten, andere haben Angst, Verlierer zu sein.
Und die, die sich durch die gegenwärtigen Entwicklungen bedroht fühlen ...
... zeigen eine zunehmende Bereitschaft, sich für ihre Ziele einzusetzen. Oder sie lassen sich von entsprechenden politischen Gruppierungen mobilisieren. So entstehen neue politische Bewegungen - während die etablierten Organisationen wie Parteien oder Gewerkschaften an Unterstützung verlieren. Diese neuen Konflikte verlaufen also mitten durch die Zivilgesellschaft, so dass diese im zunehmenden Maße durch diese Konflikte geprägt wird. Die sogenannte Özil-Debatte ist dafür ein Beispiel.
Wieso das?
Da ist ganz schnell ein vermeintlich unpolitisches Handlungsfeld, der Sport und die Aufarbeitung der schlechten Leistung der Nationalmannschaft, in die neuen Konflikte hineingezogen worden. Statt einer Mittelstürmer-Diskussion gibt es eine über Rassismus.
Dabei ging es ursprünglich um ein Foto von Özil mit dem türkischen Präsidenten, das war eine Debatte über Özils Demokratieverständnis, die dann eskaliert ist. Unabhängig davon, inwieweit Rassismusvorwürfe gegen den DFB gerechtfertigt sind - meiner Meinung nach ist diese Entwicklung symptomatisch dafür, welche Brisanz die neuen Konfliktthemen inzwischen gewonnen haben.
Gemeinhin heißt es, eine starke Zivilgesellschaft würde die Demokratie stärken. Dem widersprechen Sie also?
Der entscheidende Punkt ist nicht, wie stark die Zivilgesellschaft ist. Wichtiger ist, wie die gesellschaftspolitischen Konfliktlinien innerhalb der Zivilgesellschaft verlaufen und wie diese Konflikte verarbeitet werden. Die Frage wird immer wichtiger, denn ich bin mir sicher, dass wir erst am Anfang einer Entwicklung stehen. Die gegenwärtigen Konflikte werden immer stärker in die Zivilgesellschaft hinein wirken und es besteht die Gefahr, dass sie diese zunehmend spalten.
Ganz offensichtlich sind die neuen rechten politischen Bewegungen keine Randerscheinungen mehr. Sie haben in anderen Ländern gezeigt, dass sie Mehrheiten mobilisieren können. Sie sind in der Lage, politische Konflikte in unserer Gesellschaft zu dominieren und haben erheblichen Einfluss auf die Handlungsfähigkeit der Politik. Die westlichen Demokratien stehen deshalb vor einer großen gesellschaftspolitischen Herausforderung.
Die Zivilgesellschaft ist also nicht ohne weiteres "die Lösung". Wir müssen uns vielmehr fragen, wie wir gegen bestimmte Positionen, die wir nicht tolerieren wollen, vorgehen können, ohne den Zusammenhalt des Gemeinwesens zu gefährden.
Was lässt sich also tun? Nehmen wir das Beispiel Rassismus, über das gerade intensiv diskutiert wird.
Wer rassistische Positionen vertritt, bewegt sich jenseits dessen, was das Grundgesetz toleriert. Entsprechend müssen wir damit im Rahmen der wehrhaften Demokratie umgehen. Es gibt aber etwas, das wir nicht tun sollten: Wir sollten nicht jeden, der eine kritische Position gegenüber Einwanderung einnimmt, umstandslos zum Rassisten erklären. Der Vorwurf wird derzeit schnell gemacht.
Das ist genau der Punkt, an dem solche Debatten, wie wir sie derzeit führen, problematisch werden, weil dann tatsächlich die Spaltung der Gesellschaft droht. Das ist eine Lektion, die wir aus der Geschichte gelernt haben, aus den Religionskonflikten, der Weimarer Republik oder aus der radikalen Zuspitzung des Konfliktes zwischen Kapital und Arbeit.
Wie lassen sich die Konflikte befrieden?
Man muss in Kontakt und im Gespräch bleiben, statt sich vor den Kopf zu stoßen und die eigene Gruppenidentität zu betonen. Sportvereine sind eigentlich ein Musterbeispiel dafür, wie es gelingen kann, Menschen ganz unterschiedlicher Herkunft und sozialer Schicht in einem Team zusammenzuführen. Hier lernen sie, dass die Herkunft keine Rolle spielt für den gemeinsamen Erfolg. Das können wir trotz der Özil-Debatte sagen.
Aber eine ganz wichtige Rolle spielen natürlich die Politiker. Denn die tragen eine erhebliche Verantwortung dafür, wie die Konflikte derzeit ausgetragen werden. Nicht nur die radikalen Rechten, sondern auch die etablierten Parteien. Studien zeigen zum Beispiel, dass die Stärke der Politisierung des Migrationsthemas in Wahlkämpfen seit den 1970er Jahren in mehreren westeuropäischen Ländern nicht im Zusammenhang mit objektivem Problemdruck, also der Stärke der Zuwanderung, der wirtschaftlichen Entwicklung oder anderen Indikatoren stand.
Nicht der objektive Problemdruck, sondern die Parteien haben die Politisierung getrieben. Die Parteien nutzen ihre Möglichkeiten, Konflikte anzutreiben, um davon im politischen Wettbewerb zu profitieren. Ich bezeichne das als strategischen Opportunismus.
In Bezug auf das EU-Thema ist Großbritannien ein perfektes Beispiel für einen solchen strategischen Opportunismus. Meines Erachtens ist auch der jüngste Asylstreit zwischen den Unionsparteien ein Beispiel dafür, wie die Parteien Konflikte treiben. Das Thema Flüchtlinge und Einwanderung ist für die Bürger seit dem Herbst 2015 zweifellos ein Schlüsselthema. Aber wegen der Auseinandersetzung zwischen CDU und CSU haben viele Bürger das Thema wieder für wichtiger erachtet, obwohl sich an der Situation in Deutschland ja in den vergangenen Monaten nichts Wesentliches verändert hatte.
Ist die zunehmende Bedeutung zivilgesellschaftlicher Bewegungen auf verschiedenen Seiten der Grund dafür, dass manche Politiker versuchen, sich als Vertreter von Bewegungen zu profilieren? Zum Beispiel Emmanuel Macron in Frankreich mit seiner LRM, Sebastian Kurz mit seiner "Liste Kurz" in Österreich, Sahra Wagenknecht mit der linken Sammelbewegung "Aufstehen"?
Ja. Viele Bürger sind nicht nur mit den Themenangeboten und Positionen der etablierten Parteien unzufrieden, sie vertrauen den Parteien als solchen nicht mehr. Das eröffnet dann Chancen für neue personenzentrierte Bewegungsparteien und neue politische Bewegungen.
Was ist mit der AfD?
Die AfD ist eigentlich eine normale Partei, die den Wählern ein alternatives thematisches Angebot machen will. Aber um sie herum sind in der Zivilgesellschaft rechte politische Bewegungen entstanden, in die sie eingebettet ist. Sie versucht außerdem auch gezielt in die Zivilgesellschaft, in den vorpolitischen Raum, hineinzuwirken - etwa mit ihren Aufrufen zu Demonstrationen oder mit ihren Bemühungen, Einfluss in Vereinen zu nehmen.
Das ist ein großer Unterschied zwischen ihr und früheren rechtsextremen Parteien wie den Republikanern oder der DVU, die in dieser Hinsicht weitgehend isoliert waren. Heute übernehmen die radikalen Rechten dagegen ganz selbstverständlich das bislang eher linke Handlungsrepertoire der Zivilgesellschaft.