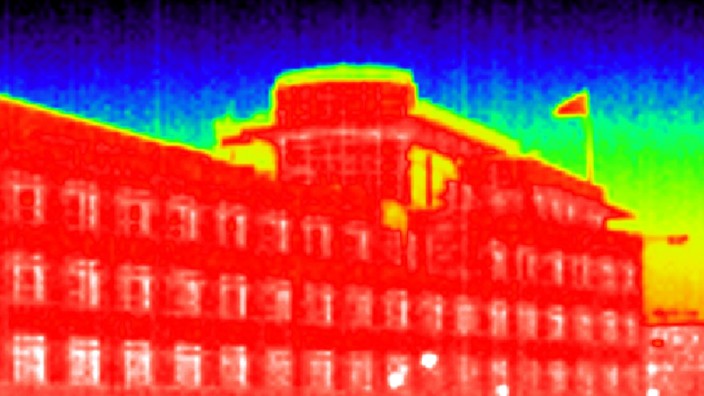Nicht selten haben Geheimdienstler von Berufs wegen Pech. "Von den drei Optionen des Gegners, die du kennst, nimmt der für gewöhnlich die vierte", beschrieb Ende der Neunzigerjahre ein hochrangiger US-Nachrichtendienstler vor einem Kongressausschuss den Behördenalltag. Er hatte die Erkenntnis bei dem Generalfeldmarschall Helmuth von Moltke stibitzt.
Auch fehlt es oft an der gesellschaftlichen Anerkennung; insbesondere der anderer Sicherheitsfachleute: "Möge Gott ihm lohnen, was die Menschen versäumt haben" - dieser Spruch, der angeblich von US-Präsident George Washington stammt und in dem 1821 erschienenen Klassiker "The Spy" verarbeitet wurde, ist schon manchem toten Agenten hinterhergerufen worden.
Aber wie soll es mit der Anerkennung etwas werden, wenn die Nachrichtendienstler nicht erkennen, wie andere Spionageorganisationen funktionieren und wenn sie nicht prüfen, wer die Möglichkeiten und die Chuzpe haben könnte, in Deutschland die Kanzlerin abzuhören?
Das Erstaunen der Berliner Regierenden über die Aggressivität der amerikanischen Dienste in diesen Tagen mag Heuchelei sein. Das Ignorieren, Wegreden, Beschwichtigen im Wahlkampf war peinlich genug, aber handwerklich versagt haben diejenigen, die eigentlich für die Spionageabwehr zuständig sind: die Geheimen, allen voran das Bundesamt für Verfassungsschutz in Köln, in deren zuständiger Abteilung 4 sich mehr als hundert Mitarbeiter um Spionageabwehr kümmern.
Abwiegelnde Gefahrenabwehrer
Circa 5000 Verfassungsschützer arbeiten für die Apparate im Bund und in den 16 Bundesländern, und zu den Aufgaben der Verfassungsschutzbehörden gehört nach dem Bundesverfassungsschutzgesetz die "Sammlung und Auswertung von Informationen" über verfassungsfeindliche Bestrebungen und andere Gefahren, aber die Spionageabwehr ist eine klassische Aufgabe eines Nachrichtendienstes.
Im Fall der US-Botschaft und im Abhörfall Merkel besteht das Versagen der Geheimen nicht darin, dass sie Pech hatten oder die falsche Option beim Gegenüber vermuteten. Das Problem ist, dass sie arglos und überfordert waren. Sie hatten keine Ahnung, was im eigenen Land passierte. Als neulich in den Blättern stand, die deutschen Sicherheitsbehörden hätten mit einem Hubschrauberflug geprüft, ob beim US-Konsulat in Frankfurt verdächtige Antennen auf dem Dach stehen, wiegelten deutsche Sicherheitsfachleute ab: falscher Alarm, alles Routine, kein Verdacht.
Jetzt erklären Regierungsvertreter in Berlin, die NSA verfüge halt über technische Möglichkeiten, die die deutschen Kollegen nicht hätten. Das mit der Technik mag stimmen, aber wichtiger ist, dass die deutschen Dienste im Fall der Amerikaner nicht einmal ansatzweise abwehrbereit und total vertrauensselig waren.
Als in den vergangenen Wochen kritische Fragen nach der Arbeit von US-Diensten in Deutschland gestellt wurden, wiegelten ausgerechnet die Gefahrenabwehrer ab: Die Amerikaner seien alliierte Partner, Freunde. Die Zusammenarbeit sei vertrauensvoll. Wenn US-Dienste in Deutschland spionieren wollten, bräuchten sie die Zustimmung der Deutschen.
Blauäugigkeit und Ignoranz
"Im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit erfolgt ein Austausch situativ und anlassbezogen", teilte vorigen Monat Klaus-Dieter Fritsche, Staatssekretär im Bundesministerium, einem Bundestagsabgeordneten mit, der sich über die Art der Zusammenarbeit erkundigt hatte. "Die Aufklärung internationaler dschihadistischer Netzwerkstrukturen und die Zusammenarbeit der vorhandenen Informationen zu diesen Netzwerken" erforderte "die Zusammenarbeit mit den Partnern" erklärte Berlin.
In dem fischigen Gewerbe wird gern schöngetan, und Partnerschaft wird beschworen, wo Misstrauen herrschen müsste. Aber so überraschend ist es nicht, dass sich eine Organisation mit einer militärischen Mission wie die NSA in Deutschland so aufführt wie in ihrem Hinterhof.
Das hat Tradition. Das hat sie immer schon so gemacht. Im bayerischen Bad Aibling steht eine große Abhöranlage, die viele Jahre nur von der NSA betrieben wurde und zu der auch Mitarbeiter des Bundesnachrichtendienstes keinen Zugang hatten: "das große Ohr". Von Bad Aibling aus werde vermutlich ein Lauschangriff gegen Deutschland geführt, fand in den Neunzigerjahren eine Arbeitsgruppe des Kanzleramtes heraus. Der damalige NSA-Chef Michael Hayden kam nach Berlin und erklärte, alles sei in Ordnung. Das große Ohr richte sich "weder gegen deutsche Interessen noch gegen deutsches Recht". Später wurde deutschen Nachrichtendienstlern der Zugang erlaubt.
Partnerschaft mit den US-Diensten stand über allem
Heute wird Bad Aibling vom BND betrieben, und der Dienst kooperiert mit der NSA. Abgehört wird im Wesentlichen Kommunikation aus Afghanistan und Nordafrika. Irritationen gab es dann viele, die Amerikaner tauschten nach ihren eigenen Regeln aus. Sie gaben, was sie gern gaben, und sie nahmen alles.
Dass deutsche Nachrichtendienstler nicht mal den Anfangsverdacht hatten, ihre Freunde, Partner, Verbündeten würden auch die deutsche Regierungschefin ausspionieren, mag damit zu erklären sein, dass die US-Dienste viele Jahre eine Art Richtlinienkompetenz für die deutschen Dienste hatten. Unabhängig, wer wann Präsident eines deutschen Nachrichtendienstes war - die Partnerschaft mit den US-Diensten stand über allem. Man war stolz, von dem größeren Bruder wie ein wichtiger Kumpel behandelt zu werden. Die größte Auszeichnung war das Lob amerikanischer Nachrichtendienste.
Blauäugigkeit und Ignoranz gab es nicht nur beim Handy-Fall, sondern es gibt sie auch im heiklen Bereich der Wirtschaftsspionage. Seit Jahren erklären die Oberen der Dienste, die deutschen Unternehmen, die mittelständischen vor allem, kümmerten sich nicht genug um ihre Sicherheit. Große Gefahr drohe aus Russland und China, weil dort der Rechtsstaat nichts gelte. Viele russische Unternehmen seien in staatlicher Hand, viele chinesische Unternehmen gehörten der Volksbefreiungsarmee. Die Gefahr kommt eindeutig aus dem Osten.
Nichts aber weise darauf hin, dass die amerikanischen Dienste auch Industriespionage betrieben. Er wolle für die alliierten Partnerdienste bei diesem Thema nicht seine Hand ins Feuer legen, hat ein hochrangiger Nachrichtendienstler jüngst erklärt, aber er habe keine Erkenntnisse, dass "die das machen". Man müsse zu Freunden auch Vertrauen haben.