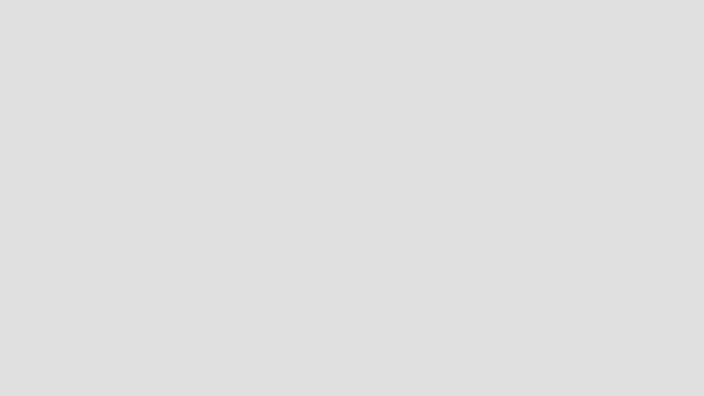Der einstige EU-Handelskommissar Karel De Gucht war ein Mann der deutlichen Worte. China spiele die europäischen Staaten gegeneinander aus, warnte er 2013 bei einem Besuch in Peking. Er mahnte die Europäer, sie dürften das Spiel nicht mitspielen. De Gucht hatte gute Gründe für seine Warnung: Als er im selben Jahr ein Dumping-Verfahren gegen chinesische Solarhersteller eingeleitet hatte, da waren ihm mehrere EU-Länder dazwischengegrätscht - aus Angst um ihre Geschäfte. Es drohe ein Handelskrieg, klagten sie. An vorderster Stelle der Bremser: Deutschland.
Und nur wenige Tage nach De Gucht, im Dezember 2013, traf der britische Premier David Cameron mit einer gewaltigen Handelsdelegation in Peking ein. Cameron überraschte selbst die Gastgeber mit seinem Auftritt, der in Sachen Liebedienerei ganz neue Maßstäbe setzte: Er wollte Chinas Führung vergessen machen, dass er im Jahr zuvor den Dalai Lama empfangen hatte. In einigen britischen Kommentaren konnte man vom "Kotau" und von einer "Demütigung" Camerons lesen, was diesen unberührt ließ: Er feierte die in Aussicht stehenden Geschäfte.
Diplomaten aus EU-Partnerländern reagierten damals regelrecht fassungslos. Dabei war das erst der Anfang. Nun setzen die Briten noch einen drauf: Chinas Staatschef Xi Jinping wird den "rötesten aller roten Teppiche" (Financial Times) ausgerollt bekommen, wenn er am Montag zum Staatsbesuch in London eintrifft.
Europa verliert an Einfluss
"Wir sollten cool mit China umgehen", hatte De Gucht in seinem Appell vor zwei Jahren gesagt. Heute ist von solcher Coolness weniger denn je zu spüren. Im Gegenteil, der Wettlauf um Pekings Gunst wird immer fiebriger. Die Rivalität der EU-Staaten hat erstaunliche Ausmaße. "China war immer ein Meister des Teile-und-herrsche. Aus Pekinger Sicht ist das ein durchaus rationales Verhalten", sagt Volker Stanzel, ein Diplomat im Ruhestand, der heute zu China forscht und lehrt. "Aber heute ist das chinesische Spiel 'Wer ist unser bester Freund?' so erfolgreich wie nie. Nach drei Jahrzehnten China-Beobachtung sehe ich zum ersten Mal, dass der EU wirklich Schaden droht."
Stanzel war von 2004 bis 2007 selbst deutscher Botschafter in Peking, später politischer Direktor im Auswärtigen Amt. Zu einer Zeit, da China international immer aktiver wird, da es beginnt, Einfluss aufs globale Regelwerk zu nehmen, verlieren die auseinanderdividierten Europäer an Einfluss in Peking. Und das Erstaunliche ist: Sie tun das aus freien Stücken. "China muss Europa gar nicht spalten", sagt Mikko Huotari von der Berliner China-Denkfabrik Merics: "Die Europäer erledigen das schon selbst."
China schwärmt vom guten Verhältnis zu den Briten
In den nächsten Tagen und Wochen kann man die wichtigsten europäischen Einzelkämpfer beobachten beim Tête-à-tête mit Chinas Führung: Auf Xis Englandbesuch folgen Besuche in Peking von Angela Merkel (Ende Oktober) und François Hollande (Anfang November). Die Briten stechen dabei heraus mit ihrem unbedingten Willen, Peking um jeden Preis zu gefallen.
Als der britische Finanzminister George Osborne vergangenen Monat China besuchte, um Xis Staatsbesuch vorzubereiten, da verlor er über Menschenrechte kein Wort, aber auch nicht über die Spannungen im Südchinesischen Meer oder die Diskriminierung europäischer Unternehmen in China. Stattdessen schwärmte er von einem "goldenen Jahrzehnt" im "goldenen Verhältnis" zwischen beiden Staaten. "Wir wollen Chinas bester Partner im Westen sein", versprach er. Hernach sang sogar das notorisch misstrauische Propagandablatt Global Times eine Hymne auf Osborne: Alle anderen Länder sollten sich ein Beispiel an den Briten nehmen. In Zukunft, so die Global Times solle es, bitte schön, immer "Teil der diplomatischen Etikette sein, die Menschenrechte in China nicht anzusprechen".
Osborne hatte in China nicht nur mitgeteilt, sein Land wolle sich von den Chinesen ein neues Atomkraftwerk bauen lassen, er war sogar so weit gegangen, sich von Peking für einen Besuch der von Unterdrückung und Gewalt heimgesuchten Uigurenprovinz Xinjiang einspannen zu lassen, eine Visite, die Chinas Propaganda kräftig feierte. Der britische Independent sprach hernach von einem "Tiefpunkt" britischer Chinapolitik, der Economist befand, die britische Regierung "schlafwandle" ohne jede öffentliche Debatte geradewegs hinein in gefährliche Abhängigkeiten. "Die deprimierende Schlussfolgerung ist", schrieb der britische Chinaexperte und Ex-Diplomat Kerry Brown in The Diplomat, "dass in Peking nicht nur britische Geschäfte und Expertise zum Verkauf stehen, sondern auch britische Regierungspolitik."
Auch andere EU-Staaten sprechen Menschenrechte nicht mehr an
Dabei sind die Briten nicht die Einzigen, die nicht länger über Menschenrechte sprechen wollen, obwohl die Repression in den vergangenen drei Jahren deutlich zugenommen hat. "Menschenrechte waren früher immer ein Thema. Das hat sich bei vielen EU-Staaten erkennbar geändert", sagt ein westlicher Beobachter in Peking. "Man erkennt eine zunehmende Reduzierung auf rein kommerzielle Interessen."
In diplomatischen Kreisen erzählt man sich, wie bei einem der regelmäßigen Treffen der EU-Vertreter in Peking einmal ein osteuropäischer Vertreter gefragt wurde, ob denn die Menschenrechte beim gerade zu Ende gegangenen Besuch seines Regierungschefs in Peking eine Rolle gespielt hätten. Nein, antwortete der Gefragte ernst: Die Chinesen hätten das Thema nicht angesprochen.
Auch die Deutschen haben das eigene Interesse im Blick; Berlins China-Politik, schätzt Merics-Mann Mikko Huotari, sei "zu 85 Prozent von reinem Geschäftsinteresse getrieben". Und doch weiß man von Bundeskanzlerin Angela Merkel und der deutschen Diplomatie, dass sie - wie zum Beispiel noch die USA - regelmäßig die Menschenrechte und andere heikle Themen ansprechen. Nun aber steige der Druck von chinesischer Seite, heißt es in diplomatischen Kreisen: "Sie haben westlichen Diplomaten zu verstehen gegeben: Schaut auf die Briten!"
Die engsten Beziehungen zu China hat Deutschland
Dabei müssen sich die Deutschen oft anhören, dass sie selber auch nicht gerade Musterschüler seien (siehe Solar-Dumping). Und vor allem: dass sie ja leicht reden hätten. Tatsächlich ist Deutschland Chinas Partner Nummer eins in Europa. Die Hälfte aller EU-Exporte dorthin stammt aus Deutschland. Gleichzeitig sind die beiden Länder auch institutionell miteinander so verbandelt wie nie: Mit keinem anderen EU-Land hält China jährlich gemeinsame Kabinettssitzungen ab, Angela Merkel bricht deshalb Ende des Monats wieder mit einer Riege von Ministern Richtung Peking auf. Das deutsche Handelsvolumen mit China ist dreimal so hoch wie das der Briten - und es ist erklärtes Ziel deren Eifers, nun Deutschland einzuholen.
"Wer schmeißt sich schneller an die Chinesen ran?"
Chinas Versuch, auf europäische Staaten einzuwirken, lässt sich an verschiedenen Initiativen beobachten, so bei der "16plus1"-Gruppe von zentral- und osteuropäischen Staaten (darunter elf EU-Mitglieder), mit deren Gründung China vor zwei Jahren Brüssel überraschte und verunsicherte. Oder beim Ringen um den Status einer Marktwirtschaft, den China von der EU gerne zuerkannt hätte.
Besonders eindrücklich aber war der Wettlauf der Europäer zu studieren bei der Gründung der von China initiierten Asiatischen Infrastrukturinvestitionsbank AIIB. Da konnten sich nicht nur jene Kräfte in Peking freuen, die einen Keil zwischen Europäern und Amerikanern treiben wollen (die USA lehnten eine Mitgliedschaft ab), da war Anfang diesen Jahres auch zu sehen, wie EU-Staaten wie Großbritannien, Frankreich, Spanien oder Deutschland sich aus eigenen Stücken schwächten, obwohl sich doch alle einige waren in ihrem Ziel, AIIB-Mitglied zu werden: "Es gab nur wenig Interesse, die Politik China gegenüber auf EU-Ebene zu koordinieren", sagt Mikko Huotari von Merics. "Stattdessen wurde man wieder Zeuge des Spiels: ,Wer schmeißt sich schneller an die Chinesen ran?'" Die Briten waren auch da die Schnellsten. "Auf Dauer hat solches Handeln einen hohen politischen Preis", sagt Huotari. "Es droht der völlige Verzicht auf Außenpolitik im eigentlichen Sinne. Die Europäer bringen sich selbst um ihr Gewicht bei der Neugestaltung der globalen Handels- und Finanzordnung."
"Es besteht die Gefahr, dass wir unsere Zukunft verspielen"
Gründe für die zunehmende Kurzsichtigkeit der Europäer gibt es einige. Weltfinanzkrise und lahmende Volkswirtschaften verengten bei vielen den Blick auf den rein wirtschaftlichen Nutzen ihres politischen Handelns. Dazu kommt der Trend zur Renationalisierung der europäischen Politik. Und schließlich sitzt in Brüssel eine EU-Kommission, deren ganze Kraft absorbiert wird von Themen wie Griechenland, Ukraine und der Flüchtlingskrise, und die darüber China schlicht aus dem Blick verliert. "Fatal, aber erklärlich", findet das der frühere Spitzendiplomat Volker Stanzel. "Es ist faszinierend und deprimierend zugleich: Viele sehen das, aber wissen keinen Ausweg. Und es besteht die Gefahr, dass wir darüber einen Teil unserer Zukunft verspielen."
In Peking ist die Stimmung derweil prächtig. Am Freitag pries die Global Times den Musterknaben Großbritannien erneut für sein neugefundenes "diplomatisches Geschick". China habe jemanden wie die Briten dringend gebraucht, als "Vorbild für ein neues Verhältnis zwischen China und dem Westen". China übe mittlerweile eine so "unwiderstehliche Anziehungskraft" aus, konstatiert das Propagandablatt zufrieden, dass dies "die Grundlage der Beziehungen zur EU verwandelt" habe. Wahrlich: "Es brechen goldene Zeiten an."