Fast 2300 rechtsextreme Straftaten in Bayern im vergangenen Jahr. 68 Anschläge auf Flüchtlingsheime. Täglich Pöbeleien auf den Straßen, Nazi-Parolen auf Hauswänden. Jeden Montag Pegida vor der Münchner Feldherrnhalle und mehrmals die Woche vor dem Rathaus, mit Lautsprecher und fingiertem Muezzin-Ruf. Drinnen, im ersten Stock sitzt die Politologin Miriam Heigl. Die schlanke, blonde Frau ist Expertin für Rechtsextremismus und beobachtet die Umtriebe seit Jahren von Berufs wegen. Und sie stellt fest: Die Hemmschwelle für Hetze gegen Minderheiten ist dramatisch gesunken. Die für Gewaltakte auch.
Als die "Fachstelle für Demokratie - gegen Rechtsextremismus, Rassismus und Menschenfeindlichkeit" 2010 gegründet wurde, waren die Zahlen verglichen mit heute überschaubar. Braucht es so eine Stelle überhaupt, fragten damals einige Stadträte. Sechs Jahre später zweifelt kaum einer mehr daran. Denn inzwischen vergeht kein Tag, ohne dass neue Meldungen über rechte Aktionen oder Angriffe in Heigls Büro einlaufen. Das bemerken auch die Mitglieder des Vereins "Before", der vor Kurzem - unterstützt vom Stadtrat - seine Arbeit aufnahm, der Hilfe suchende Bürger berät, notfalls auch anonym. Vorsitzender ist Alt-Oberbürgermeister Christian Ude.

Fast jede Woche marschiert die rechtspopulistische Gruppe durch die Stadt, die Bewegung ist radikaler und aggressiver geworden. Eine Bilanz über ein Jahr Pegida in München.
Die promovierte Politikwissenschaftlerin und Soziologin, 39 Jahre alt, international erfahren, beschäftigt sich seit Jahren mit Rechtsextremismus. Weil sie inzwischen ein breites Netzwerk in München aufgebaut hat - nach ihren Worten "einmalig in Deutschland" -, erfährt sie relativ schnell von rechtsextremen und neuerdings auch salafistischen Umtrieben in München. Sie hält Kontakt zur Polizei und zum Verfassungsschutz.
Immer wieder bricht ein Shitstorm im Internet über sie herein
Sie informiert die Mitarbeiter der Verwaltung und berät Bürger, wie sie sich wehren können: Schulen, vor deren Eingang die NPD ihre Propaganda-CD verteilt mit dem Titel "Freiheit statt BRD", oder an denen die Partei "Die Rechte" Flugblätter verteilt und sich dabei rühmt, Schüler davor zu bewahren, "durch Lehrer in staatskonformer Einfalt gehirngewaschen zu werden". Hausmeister, die ein Hakenkreuz im Treppenhaus entdecken. Oder Wirte, die ihr Lokal nicht länger an rechte Parteien vermieten wollen.
Konsequent und unerschrocken kämpft die gebürtige Münchnerin für Freiheit und Demokratie in ihrer Heimatstadt. Sie geht in öffentliche Versammlungen, wohl wissend, dass dort ihre Gegner auftreten können und gerne mal mit dem Smartphone fotografieren. Immer wieder, und in jüngster Zeit verstärkt, bricht dann ein Shitstorm im Internet über sie herein. Dann wird sie, genauso wie ihr Dienstherr, Oberbürgermeister Dieter Reiter, als Teil eines "Repressionsapparats" beschimpft, der aufrechte Patrioten verfolge. Sich selbst als Opfer darstellen, das ist Methode in den rechten sozialen Netzwerken.
Sie ist vorsichtig geworden, sagt Miriam Heigl. Angst machen lässt sie sich aber nicht. "Letztlich muss man darauf hoffen, dass die Sicherheitsbehörden einen schützen", sagt sie. Seit sie denken kann, interessiert sie sich für Politik. Da gehören Konflikte dazu. Sie ist in München aufgewachsen, war Schülersprecherin und hat sich in der Friedensbewegung engagiert.
Auch andere Kommunen schauen mittlerweile auf die Fachfrau für Demokratie
Sie hat an der Ludwig-Maximilians-Universität studiert und an der Sorbonne in Paris. Sie verbrachte einige Zeit in New York und in Mexiko und hat später beim Ökumenischen Büro in München gearbeitet. Sie hat Erfahrung in der Erwachsenenbildung und in Anti-Gewalt-Programmen für Jugendliche gesammelt. Sie ist überzeugt, dass ihre Arbeit München friedlicher machen kann, das motiviert sie. "Wir haben viele Optionen, wir können was erreichen", sagt sie. Mittlerweile schauen auch andere Kommunen in Deutschland auf München und seine Fachfrau für Demokratie.
Dabei kann sie sich auf viele Unterstützer in der Stadt verlassen, von den Kirchen über Gewerkschaften bis zu Vereinen und Initiativen. Sobald die NPD eine Demo anmeldet, wenn irgendwo Flugblätter verteilt werden, wenn Schmierereien auftauchen, erfährt sie meist schnell davon. Aber es geht nicht nur um offensichtliche rechte Aktionen.
"Das geschlossene rechtsextreme Weltbild, zu dem Holocaust-Leugnung und Führerverehrung gehören, nimmt eher ab", stellt Heigl fest, "aber menschenverachtende Tendenzen, das Stigmatisieren bestimmter Gruppen, werden stärker." Vor allem der Flüchtlinge. "Sie stellen eine Projektionsfläche für die eigenen Ängste und Frustrationen dar. Sie werden als fremd wahrgenommen, und immer, wenn ich mit Menschen nicht so einfach in Kontakt treten kann, ist es leichter, mir Vorurteile über diese Menschen zu bilden", sagt die Wissenschaftlerin.
Es geht aber nicht nur um Flüchtlinge und Vorurteile, sagt Heigl, sondern um eine grundlegende Tendenz in der Gesellschaft. "Kurz nachdem ich meine Stelle angetreten habe, ist die Sarrazin-Debatte explodiert. Da wurden Akzente gesetzt, auch im medialen Diskurs, nach dem Motto: ,Das wird man doch noch sagen dürfen'." Von diesem "Das wird man doch noch sagen dürfen" bis zur "Lügenpresse" war es dann nicht mehr weit.
Die extreme Rechte schiebt die Politik vor sich her
Heigl beobachtet: "Die Gesellschaft spaltet sich immer mehr, da geht es um Abstiegsängste, um Konkurrenz und das Bewusstsein, dass das soziale Netz immer dünner wird." Sie sieht eine Parallelwelt entstehen von Menschen, die meinen, nicht mehr gefragt zu werden, die sich in einer Notstandssituation begreifen - siehe Bürgerwehren - "und meinen, selbst handeln zu müssen. Das ist ein gefährlicher Nährboden."
Heigl spricht ungern über Politik, denn als Mitglied der Verwaltung ist sie zu Neutralität verpflichtet. Aber eines beobachtet sie durchaus: "Dass die extreme Rechte es geschafft hat, die etablierte Politik vor sich herzutreiben. Und dass es dabei einen europaweiten Trend gibt, dass sich die Rechte gegenseitig stabilisiert, macht es noch schlimmer. Wir brauchen jetzt wirklich Demokraten, die aufstehen und für demokratische Werte plädieren."
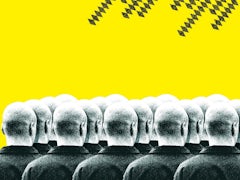
Zwei rechtsextreme Gruppierungen versuchen offensiv, sich in München zu etablieren. Hat die Stadt ein wachsendes Nazi-Problem?
München, so hat es Christian Ude betont, als er sich für die Einrichtung dieser Stelle einsetzte, habe als ehemaliges Zentrum der NS-Bewegung eine besondere Verantwortung, die Demokratie in der Stadt zu schützen. Zumal es immer wieder Gewaltakte von Neonazis gab. Das Oktoberfestattentat 1980, mit 13 Toten und 211 Verletzten. Das geplante Attentat auf die Grundsteinlegung des Jüdischen Zentrums auf dem St.-Jakobs-Platz 2003, die Morde des NSU. Das ist die Spitze einer Bewegung, die sich wandelt, aber heute nicht minder gefährlich ist, sagt Heigl.
Heute heißen sie "Die Rechte" und "Der dritte Weg", sie fangen Neonazis von der NPD oder vom Freien Netz Süd auf, und sie haben in München Fuß gefasst. "Es gibt etwa 1000 gewaltbereite Rechtsextremisten in Bayern", sagt Heigl, dazu kämen zahlreiche bekannte Salafisten. Wer eine Bedrohung wahrnimmt, dem rät Heigl zur Anzeige, wohl wissend, dass sich viele davor scheuen, aus Angst, oder auch, weil sie meinen, die Polizei würde Täter nicht immer mit der nötigen Konsequenz verfolgen.
Jede Anzeige, die in die Polizeistatistik eingeht, ist wichtig
"Es ist auf jeden Fall sinnvoll, alles, von dem man denkt, dass es strafrechtlich relevant sein kann, zur Anzeige zu bringen. Jede Anzeige, die in die Polizeistatistik eingeht, ist wichtig. Denn oft spiegelt die Statistik ja nicht das reale Problem wider. Das haben wir im Zusammenhang mit den NSU-Morden gesehen", sagt sie. Gegen die Hetze im Internet sind die Behörden ohnehin oft machtlos. Da gibt es Seiten wie von Pegida-Bayern, die im Ausland angemeldet sind und ohne Impressum auftreten. Urheber lassen sich dort kaum verfolgen.
Für Heigl selbst gilt: "null Toleranz." Mit strammen Neonazis, denen es nur darum gehe, die Gesellschaft zu spalten, lasse sich nicht diskutieren. Das gilt auch für den Stadtrat Karl Richter von der rechtsradikalen Bürgerinitiative Ausländerstopp, einstiger NPD-Bundesvize, der sie immer wieder persönlich angreift. Sie steht so etwas durch, sie sieht sich auf der richtigen Seite, das macht sie stark.

