
Ist ein Gebäude nach 30 Jahren wirklich bereits alt, also abbruchreif? Klaus Beslmüller und sein Kollege Melchior Kiesewetter, beide vom "Studio Plus Architekten", schütteln energisch den Kopf. Erst nach etwa 40 Jahren stünde normalerweise eine Generalsanierung an, bei der mehr nötig sei als ein wenig Farbe aufzutragen, erklären die beiden. Nämlich eine Erneuerung der Sanitäranlagen und der Verschleißflächen wie Böden oder Treppen sowie wahrscheinlich eine Instandsetzung der Fassade und der Haustechnik wie Heizung, Lüftung und Elektrik. Und doch gebe es Gebäude, die herausfielen aus dem üblichen Modernisierungszyklus, bei denen früher Handlungsbedarf bestehe. "Das Centre Pompidou in Paris zum Beispiel war von Millionen Besuchern einfach kaputtgetrampelt", sagt Beslmüller. Und dann gebe es sogar solche Häuser, bei denen eine Generalsanierung eigentlich gar nicht mehr sinnvoll sei, weil deren Kosten die eines Neubaus übersteigen würden - wie es nun bei der 33 Jahre alten Grafinger Stadthalle der Fall ist.
Im Stadtrat
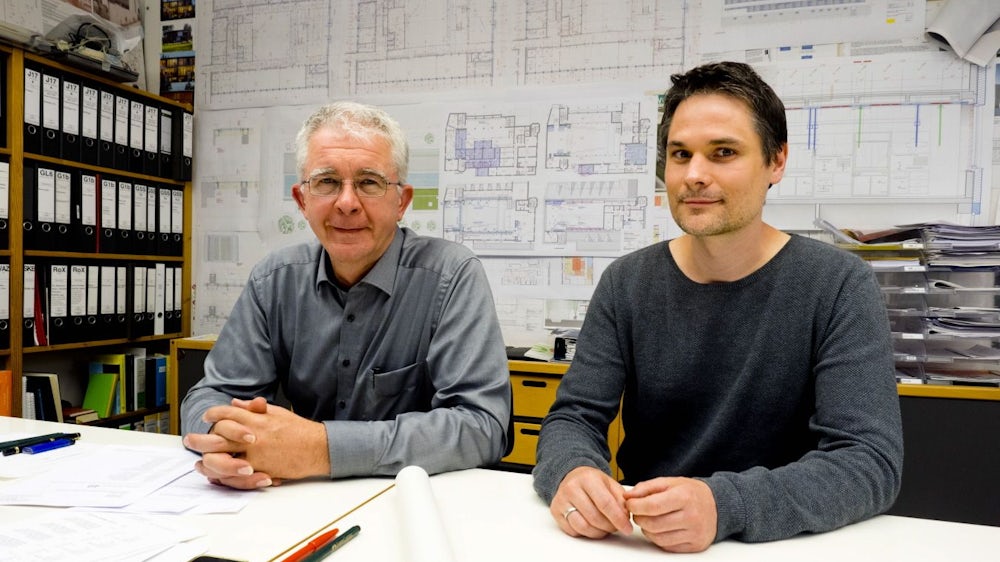
"Wir haben ein halbes Jahr lang wirklich alle Optionen durchgespielt", sagt Beslmüller mit Blick auf das große Veranstaltungshaus - "aber leider vergeblich". Und so stand bei seiner Präsentation im Grafinger Stadtrat am Ende plötzlich ein Abriss im Raum. "Ich hätte selbst nicht gedacht, dass die Diskussion eine solche Wendung nimmt", sagt Beslmüller, der freilich auch um die Emotionen weiß, die mit solch einem öffentlichen Gebäude stets verbunden sind. "Aber letztlich sprechen die Zahlen ja für sich." 1,6 Millionen Euro sind das absolute Minimum, das Grafing in Brandschutz, Lüftungsanlage und Schadstoffsanierung der Stadthalle stecken müsste, um vom Landratsamt grünes Licht zu bekommen. Um das Haus aber tatsächlich besser nutzbar und attraktiver zu machen, wären 5,4 bis 8 Millionen Euro fällig. Dem gegenüber stellte Beslmüller 3,5 Millionen Euro für eine einfache neue Mehrzweckhalle - "diese Summe sollte ein wenig provozieren", sagt er und lächelt. Eigentlich nämlich waren die Neubaukosten nur als Referenzwerte für den Stadtrat gedacht, um ihm eine Größenordnung als Vergleich zu geben. "Aber dann war das Gremium echt diszipliniert, hat die Informationen angenommen und sehr sachlich beraten - trotz Wahlkampf", berichtet Beslmüller. Eine Entscheidung allerdings steht noch aus.
Sanieren ist gut - aber
Eigentlich, sagen die beiden Architekten, seien sie "leidenschaftliche Sanierer". Erstens, weil Gebäude mit Geschichte oft einen ganz eigenen Charme hätten, aber auch, weil ja in jedem Haus enorm viel Ressourcen und Energie steckten - ein Abriss hingegen nur einen Haufen Müll produziere. In Zeiten, in denen sich alle um Nachhaltigkeit bemühen, keine gute Option. "Zudem kommt man im Dialog mit dem Altbestand oft auf sehr kreative Lösungen", schwärmt Kiesewetter.
Und doch sei der Grat zwischen Generalsanierung und Neubau ein sehr schmaler, denn oft koste die Instandsetzung nur etwa ein Drittel weniger. "Das kann also sehr schnell kippen", erklärt Kiesewetter. Das größte Problem nämlich sei, dass Sanierungen meist viele "Kollateralschäden" mit sich brächten: Will man an die Leitungen, müssen die Wände aufgestemmt werden, beim Fensteraustausch leidet die Fassade, und für eine neue Heizung ist möglicherweise der Kellerraum zu klein. Solche Zusammenhänge sehe man als Architekt freilich schneller - mit entsprechendem Ergebnis. "Außerdem gehört zu einer glaubwürdigen Kalkulation immer ein Puffer dazu", sagt Beslmüller. "Denn irgendwas ist immer." Doch nicht nur die Altbestände stellten Architekten oftmals vor große Herausforderungen, sondern auch die Extrawünsche der Bauherren. Dies alles unter einen Hut zu bringen, und trotzdem finanziell deutlich unter den Neubaukosten zu bleiben, ist wohl große Kunst.
Zumal es auch viele externe Faktoren gibt, die eine Sanierung durchkreuzen können: Manchmal sei die Lage des Gebäudes das Problem, erklärt Beslmüller. Im Laufe der Jahre nämlich könne sich eine komplette Umgebung verändern, so dass zum Beispiel eine neue Erschließung vonnöten sei. Oder es gelte neues Baurecht, so dass plötzlich die Möglichkeit eines weiteren Stockwerks locke. Eine tolle Chance, denn bestehenden Wohnraum zu verdichten, das sei nicht nur ökonomisch sinnvoll, sondern auch ökologisch. "Wenn mehr Menschen auf weniger Platz leben, gibt es mehr ungeteilte Natur, und das ist gut für die Biodiversität", sagt der Grafinger Architekt.
Nicht ganz einfach ist auch das Thema Bestandschutz, den alte Gebäude eigentlich genießen. Denn dieser kann über die Zeit leicht verloren gehen, etwa wenn die Räumlichkeiten nicht mehr so genutzt werden, wie es die Behörden einst genehmigt hatten - und dies ist gerade bei öffentlichen Gebäuden für diverse Zwecke häufig der Fall. Dann aber gibt es bei einer Sanierung keine Ausnahme mehr, zum Beispiel, was Brandschutz und Fluchtwege angeht.
Die Kommune als Bauherr
Dass es gerade bei kommunalen Bauvorhaben immer wieder Qualitätsprobleme gibt, liegt laut den Architekten auch in den gesetzlichen Vorgaben begründet: Will eine Gemeinde bauen oder sanieren, muss sie diese Arbeiten öffentlich ausschreiben und das vermeintlich beste, sprich: billigste Angebot annehmen. Mit Regelungen wie dieser soll Vetternwirtschaft verhindert werden. Durchaus sinnvoll also - doch die Architekten erleben immer wieder die Kehrseite der Medaille: "Wegen ein paar hundert Euro weniger eine Firma mit eher schlechten Referenzen zu beauftragen, das würde kein privater Bauherr machen", sagt Beslmüller. Selbst eindeutig schwarze Schafe, mit denen man selbst bereits schlechte Erfahrungen gemacht habe, könne man in den kommunalen Verfahren nicht ausschließen. Die guten Firmen aus der Region hingegen reichten teils schon gar keine Angebote mehr ein, weil sie ohnehin unterboten würden, sagt Kiesewetter. "95 Prozent der Probleme verursachen Firmen mit vier, fünf Stunden Anfahrt", konstatiert Beslmüller. "Klar, die müssen die Fahrtkosten ja an anderer Stelle wieder einsparen", assistiert der Kollege. Einfache Lösungen für dieses Problem allerdings haben die beiden Planer auch nicht parat. "In der Schweiz fliegt der Billigste automatisch raus, das wäre ein Anfang", sagen sie, und dass ein wenig mehr "Spielraum" für die Kommunen gut wäre, "in den auch weiche Faktoren einbezogen werden dürfen".
Die Geschichte der Stadthalle

Doch zurück zur Stadthalle. Welch Ironie der Geschichte, dass man in Grafing vor etwa 30 Jahren schon einmal an genau dem selben Punkt stand wie heute: Damals war die Jahnturnhalle des TSV, 1924 von den Grafingern in Eigenleistung erbaut, renovierungsbedürftig, die Stadträte stritten darüber, ob man nur die Auflagen des Landratsamts erfüllen oder das Haus gleich zu einer richtigen Veranstaltungshalle ausbauen sollte. Letztlich setzten sich die Befürworter der "großen Lösung" für damals drei Millionen Mark durch, beauftragt wurde Architekt Franz Einhellig. Doch damit fingen die Probleme erst richtig an, eine Hiobsbotschaft von der Baustelle jagte die nächste: Ein Deckenbalken brach, das gesamte Dach erwies sich als so sanierungsbedürftig wie das Fundament, die Keller- und die Saaldecke als mangelhaft. Es folgten mehrere Baustopps und Umplanungen, es wurde weitergebaut, teils sogar ohne Genehmigung, man fürchtete Regressansprüche der beteiligten Firmen. Am Ende jedoch musste alles weggerissen und ein Neubau errichtet werden, der noch einmal zehn Millionen Mark kostete. Die Vorgabe war dabei, dass die neue der alten Halle möglichst gleichen sollte, also erhielt sie wie der Vorgänger einen Turm und viele Giebel, das Erdgeschoss wurde erneut gut einen Meter über dem Boden angelegt.
Das alles ist wohl auch der Grund, warum die Stadthalle heute so seltsam aus der Zeit gefallen wirkt, obwohl sie tatsächlich erst 33 Jahre auf dem Buckel hat. Böse Zungen mögen sich an den österreichischen Kabarettisten Pepi Hopf erinnern, der die Stadthalle bei seinem Auftritt dort folgendermaßen beschrieb: "Stell Dir vor, die in der DDR hätten eine große Skihütt'n gebaut..."
Die Gebäudeanalyse

Über Geschmack lässt sich streiten, von den Materialien her ist die Ausstattung des Hauses aber tatsächlich hochwertig, es gibt Handläufe aus Holz und Sockelleisten aus Schmiedeeisen. Auch die tragende Struktur ist laut Beslmüller gut, "so ein Beton hält ewig". Zu den Vorteilen der Stadthalle zählt außerdem, dass sie immens viel Platz bietet, die Architekten haben im dritten Stock nun sogar noch einen dritten Saal und eine Wohnung entdeckt. Doch damit ist leider nichts gewonnen.
Auslöser für das aktuelle Drama war der Brandschutz: Die Klappen in den Lüftungsschächten der Stadthalle sind asbesthaltig und daher nicht mehr zulässig. Dabei geht es zwar nicht um den normalen Betrieb, Besucher sind keiner schädlichen Belastung ausgesetzt, aber bei den vorgeschriebenen Funktionstests könnten doch Fasern freigesetzt werden. Also müssen die Klappen ausgetauscht werden. Das aber ist in der Stadthalle nicht so einfach, weil die Belüftungsschächte kreuz und quer durch das ganze Haus laufen, vom Dach in den Keller und wieder zurück. Rund 40 Klappen seien dort verbaut, sagt Kiesewetter, viele davon zudem sehr schlecht zu erreichen. Also zog die Stadt das Architekturbüro hinzu, das dann im Laufe seiner Analyse immer mehr Mängel und Ungereimtheiten feststellte.
Die hohe Schadstoffbelastung mit Asbest und künstlichen Mineralfasern (KMF) sei zeittypisch und kein Grund für einen Abriss, stellt Beslmüller klar. Viel schlimmer sei die aus heutiger Sicht völlig unwirtschaftliche Organisation der Grundrisse: Die Stadthalle verfügt über eine Geschoßfläche von 3200 Quadratmetern, der Saal aber bietet nur etwa 600. Die Architekten haben berechnet, dass lediglich 40 Prozent der Stadthalle tatsächlich genutzt werden. "Und was ist mit dem Rest?", fragt Beslmüller - um gleich selbst die Antwort zu geben: "Der muss ebenfalls geheizt, geputzt und instand gehalten werden." Deswegen sei das Haus im Unterhalt so teuer. Kein Wunder, dass im Stadtrat immer wieder über die Defizite diskutiert wird. Als positives Gegenbeispiel nennt der Planer das Grafinger Gymnasium nebenan: Dieses sei so gut und zeitgemäß geordnet, dass man habe um- statt neu bauen können.
Außerdem kommen bei der Stadthalle viele Kleinigkeiten zusammen: Das Haus ist nicht barrierefrei, der Aufzug überwindet gerade den einen Meter zum Saal im Erdgeschoss, erreicht aber nicht die Toiletten im Keller, von der Turmstube oben ganz zu schweigen. Die Treppe, die zu dieser hinaufführt, ist an einer Stelle nur 70 Zentimeter breit: ein "Nadelöhr im Fluchtweg!", ächzt Kiesewetter. Um dieses zu beseitigen, müsste jedoch der ganze Turm umgebaut werden, ein irres Unterfangen. Deswegen kann der Saal im dritten Stock schlicht nicht genutzt werden. Ein Schallschutz zwischen den verschiedenen Spielstätten ist ebenfalls nicht vorhanden. Obendrein ist die Stadthalle total verwinkelt, es gibt eine mehrteilige Galerie, diverse Ebenen, Treppchen und Türen. "Vieles ist rätselhaft", resümiert Beslmüller, fügt aber gleich hinzu, dass der Kollege Einhellig "schweres Gepäck" gehabt habe: Er sollte den historischen Vorgängerbau nachempfinden, diverse Wünsche des Stadtrats erfüllen und war natürlich den Gepflogenheiten seiner Zeit unterworfen. "Dem Brandschutz etwa wurde nicht so eine Bedeutung beigemessen wie heute."
Wie es weitergeht
Doch nun ist es, wie es ist: All die Mängel zu beseitigen, würde extrem viele schwere Eingriffe nötig machen. Deswegen wurde aus der Idee Neubau eine echte Option. Beslmüller würde dabei auf ein schlichte, moderne Architektur setzen: Eine ebenerdige Halle schwebt ihm vor, mit Flachdach, einer neutralen Hülle aus Holz oder Stahlbeton sowie einer einladenden Glasfront samt Vordach. Den Saal könnte man variabel abtrennbar gestalten, so dass er diversen Veranstaltungsgrößen angemessen Raum bietet. Zeiträume abzuschätzen ist bei Bauvorhaben freilich immer schwierig, aber in einem Punkt legt sich Beslmüller fest: "Eine Sanierung dauert sicher länger", sagt er, für einen Neubau veranschlagt er ein bis eineinhalb Jahre Bauzeit. Die Planungen dafür würden ausgeschrieben - könnte also sein, dass sein Architekturbüro gar nicht zum Zug käme.
Ob die Stadthalle nun abgerissen wird oder nicht, muss der Stadtrat noch heuer entscheiden, am 31. Dezember endet die Schonfrist des Landratsamtes. Der künstlerische Leiter der Stadthalle, Sebastian Schlagenhaufer, nimmt es gelassen, dass sein Haus in jedem Fall eine gewisse Zeit lang geschlossen bleiben wird, denn er habe schon jede Menge Ideen für Alternativen, sagt er. Außerdem sehe er in der ganzen Situation "eine historische Chance für Grafing". Und wer weiß, vielleicht lernt die Stadt ja einmal aus ihrer bewegten Geschichte.