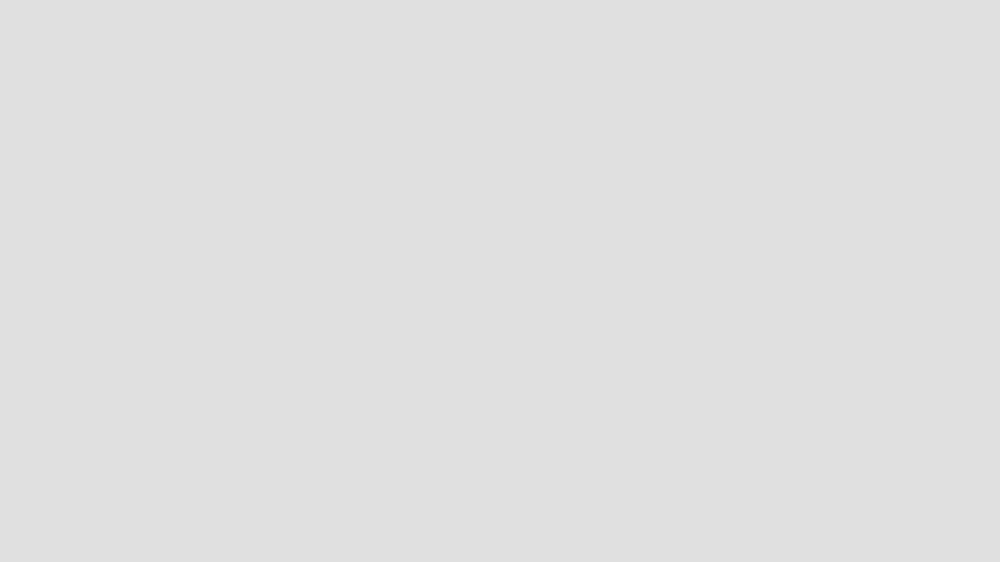Die freie Presse sei für die moderne Demokratie "unentbehrlich". Sie halte die Diskussion in Gang, beschaffe Informationen, nehme dazu Stellung und gebe Orientierung. So schlicht, so gut haben es einst die Bundesverfassungsrichter in ihrem Urteil zur Spiegel-Affäre formuliert. Das war im Jahr 1966.
Sind ihre Sätze heute nur noch die Spott- und Schreivorlage für Pegidisten? Sind sie nur museale Rhetorik, überholt und übertönt vom Gegoogel und Getwitter der vereinigten User aller Länder?
Glaubt man dem Autor Stefan Schulz, pfeift das Publikum auf die "normative Überhöhung", mit der Journalisten ihre Arbeit als Dienst an der Demokratie darstellen. Es lege wenig Wert auf diesen "ideologischen Schmuck", und auch nicht auf Seriosität. Das Vertrauen, das der Journalist früher unter dem Dach bekannter Medienmarken genossen habe, sei "fast gänzlich" in die Technologien abgewandert.
Schulz, der bei der FAZ gearbeitet hat und nun eine "Zeit nach der Zeitung" ausruft, zitiert eine Umfrage. Sie behauptet, Internet-Suchmaschinen hätten die traditionellen Medien als glaubwürdigste Quelle abgelöst. Kunststück. Suchmaschinen leisten ja etwas ganz anderes als eine (gedruckte oder digitale) Zeitung. Man kann diese Leistungen nicht gegeneinander ausspielen. Der Vergleich ist etwa so sinnvoll wie die Frage, ob die Menschen den Autobahnen mehr vertrauen als den Autos.
Naiv, unfähig, von vorgestern: So lauten die gängigen Vorurteile
Eine Erosion des Vertrauens in "die" Medien mag ins Weltbild des jungen, ernüchterten Journalisten (oder Ex-Journalisten) Schulz passen, aber die Belege, die er liefert, sind dünn. Andere Studien belegen, dass viele Bürger weiterhin Wert auf einen seriösen Journalismus legen, der professionelle Standards einhält. Eine Umfrage, die Kollegen des Instituts für Publizistik in Mainz durchgeführt haben, zeigt beispielsweise, dass nur eine Minderheit denkt, man könne den Medien nicht vertrauen und diese berichteten nicht präzise.
Regt sich Unmut, so oft deshalb, weil die Medien den Standards mal besser, mal schlechter genügen. Das bedeutet: Die Standards sind den Menschen nicht egal. Jenseits der infamen Attacken à la "Lügenpresse" gibt es jede Menge berechtigte oder diskussionswürdige Kritik, und diese speist sich nicht aus Gleichgültigkeit, sondern aus demokratischer Wachheit. Viele Bürger wünschen sich auch heute das, was die Verfassungsrichter damals beschrieben haben: ordentliche Information, Diskussion und Orientierung.
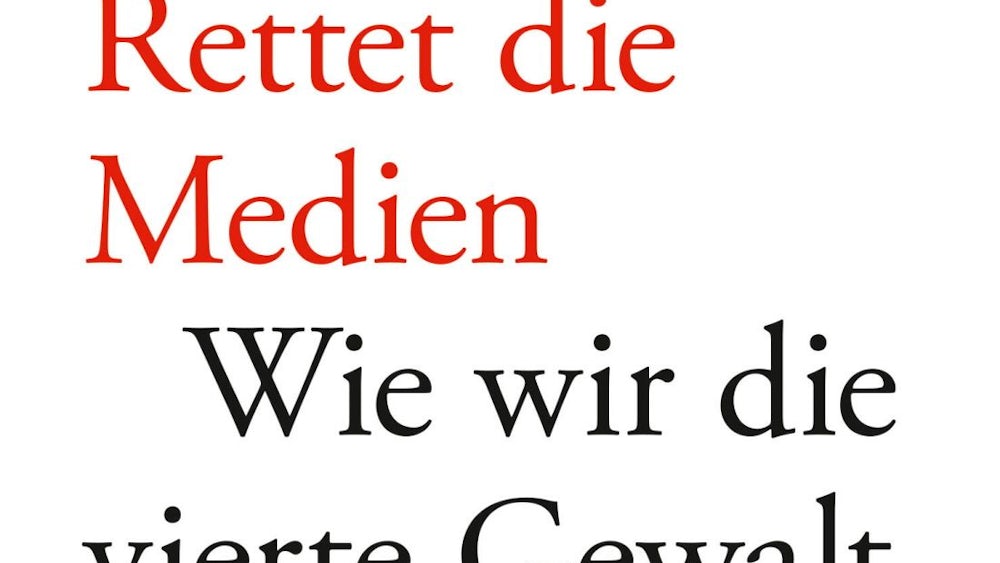
Julia Cagé: Rettet die Medien. Wie wir die vierte Gewalt gegen den Kapitalismus verteidigen. Aus dem Französischen von Stefan Lorenzer. Verlag C. H. Beck, München 2016, 134 Seiten, 12,95 Euro. E-Book: 9,99 Euro. Leseprobe: Einen Auszug aus dem Buch stellt der Verlag hier zur Verfügung.
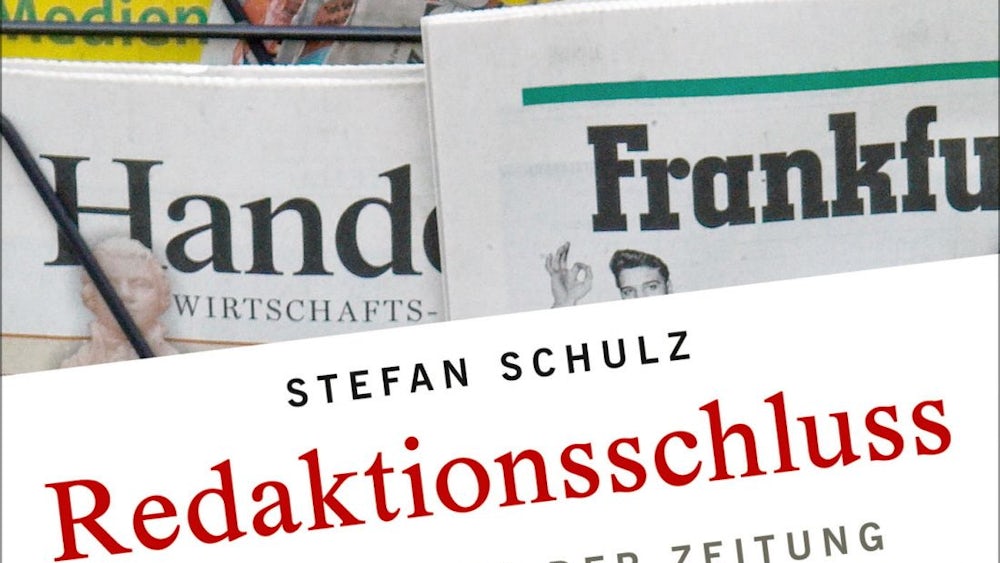
Stefan Schulz: Redaktionsschluss.Die Zeit nach der Zeitung. Hanser Verlag, München 2016, 303 Seiten, 21,90 Euro. E-Book: 16,99 Euro. Leseprobe: Einen Auszug aus dem Buch stellt der Verlag hier zur Verfügung.
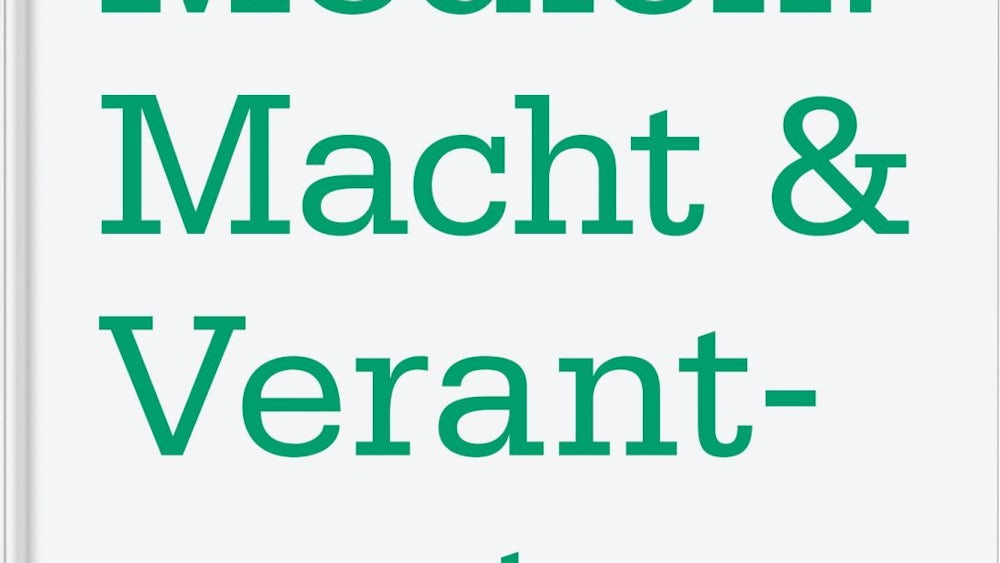
Ulrich Wickert: Medien: Macht & Verantwortung. Verlag Hoffmann und Campe, Hamburg 2016, 157 Seiten, 16 Euro. E-Book: 11,99 Euro.
Deshalb ist es weder altmodisch noch ideologisch, wenn Ulrich Wickert in einem Büchlein über die Macht und Verantwortung der Medien gleich zu Beginn Immanuel Kant und den Wahlspruch der Aufklärung zitiert. "Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen!" Ach, wie originell, mögen die naseweisen Post-Journalisten murren.
Natürlich kann man fragen, ob dem guten alten Tagesthemen-Mann bei einem Glas Rotwein nicht eine frischere Referenz hätte einfallen können. Nur: Stimmt es etwa nicht mehr, dass Journalisten kritisch sein sollen? Dass sie Gebrauch machen sollen von ihrer Vernunft - und so auch ihr Publikum, das ja nicht immer einig sein muss mit dem Journalisten.
Während Wickert am Ideal eines aufklärerischen Journalismus festhält und zeigt, wo es annähernd verwirklicht oder grob verletzt wird, wirkt der junge Schulz bereits resigniert. Er proklamiert eine "Nachrichtendiät", vom klassischen Journalismus verspricht er sich nicht mehr viel. Sein Buch ist gut geschrieben, aber der Gestus nervt. Es erweckt den Eindruck, als seien Verleger und Journalisten allesamt naiv, unfähig und von vorgestern. Es unterschlägt all die Anstrengungen, mit denen Verlage auch im Internet qualitativ hochwertige Stücke anbieten.
Es unterschlägt, wie Journalisten sich auf ihre Stärken besinnen und durch aufwendige Recherchen der Welt wichtige Informationen abtrotzen. Es unterschlägt, dass es immer noch eine große Zahl von Menschen gibt, die Nachrichten und Reportagen lesen wollen, die auf Papier gedruckt sind. Und dass von den anderen, die alles auf Bildschirmen lesen, keineswegs nur billigste, schnellste und schlechteste Ware verlangt wird.
Ulrich Wickert warnt zu Recht davor, den Journalismus in einen oberflächlichen medialen Amüsierbetrieb zu verwandeln. Präzision und Richtigkeit müssen auch online vor Schnelligkeit gehen. Dafür zeigen Journalisten oft mehr Sinn und Verständnis als die Schnellschlauen in der sozialen Medienmeute.
Stefan Schulz hadert dennoch grundsätzlich mit dem politischen Journalismus: Die Nachrichten und politischen Wochenendmagazine im Fernsehen seien nur "Gossip-Reports". So wie sich die Boulevardmeldungen der Privatsender mit den Schönen und Reichen befassen, würden sich ARD und ZDF auf die Mächtigen konzentrieren. Das politische Leben schrumpfe zusammen "auf das persönliche Kräftespiel von zehn Bundespolitikern".
Das ist schön zugespitzt und ein Körnchen Wahrheit zweifellos dabei. Seit jeher diagnostiziert die Medienforschung einen Hang des Journalismus, Politik zu personalisieren und strukturellen und institutionellen Faktoren der Politik zu wenig Aufmerksamkeit zu schenken.

Von wegen "Lügenpresse": Wissenschaftler haben Umfragen der vergangenen dreißig Jahre ausgewertet - und kommen zu einem überraschenden Ergebnis.
Doch zu einem vollständigen Bild gehört, dass das Agieren der Spitzenpolitiker tatsächlich bedeutsam ist - und dass die Medien sehr wohl auch themen- und problemorientorientiert berichten, die wiederholte Darstellung weniger prominenter Personen jedoch viel stärker in Erinnerung bleibt.
Aus Schulz' Diagnose ließe sich folgern, die Demokratie nähme kaum Schaden, wenn der Journalismus einginge. Aber woher würden die Blogger und Hobby-Publizisten, von denen nur einige ernsthaft recherchieren, dann ihren Stoff beziehen? Wo kämen die klugen Analysen und Kommentare her - auch jene, über die man sich leidenschaftlich streiten kann?
Wenn man sich vorstellt, morgen erschienen keine SZ, keine FAZ, keine Lokalzeitungen, keine Interviews im Deutschlandfunk, keine Tagesschau und keine Heute-Sendung - würde es genügen, dass Angela Merkel sich per Podcast an die Menschen wendet?
Die Rolle, die das Bundesverfassungsgericht dem Journalismus zugesprochen hat, kann aus der Demokratie nicht gestrichen werden. Es lohnt sich, ihn zu schützen und zu verteidigen, notfalls: ihn zu retten. Und das sei bereits dringend notwendig, glaubt Julia Cagé, eine junge Ökonomie-Professorin aus Paris. Noch nie habe es so viele Zeitungsleser gegeben wie in der Gegenwart, in der man sich von einem (kostenlosen) Online-Artikel zum nächsten klicken kann. Doch ökonomisch seien die Medien so schwach wie nie zuvor. Cagé schlägt deshalb ein neues Unternehmens- und Finanzierungsmodell vor.
Was könnte helfen?
Die Medien dürften nicht zu Marionetten einflusshungriger Milliardäre werden, die Idee eines selbstverwalteten Journalismus sei allerdings auch nur eine Utopie. Medien, die im Eigentum ihrer Belegschaften stünden, würden schnell scheitern. Die Ökonomin entwirft eine Aktionärsdemokratie, die den Medien stabiles Eigenkapital verschaffen soll. Sie wünscht sich eine neue Rechtsform: die einer nicht gewinnorientierten "Mediengesellschaft".
Eine Zwischenform aus Aktiengesellschaft und Stiftung soll helfen, die Gesetze des Marktes zu überwinden. Medien sollten nicht an die Börse gehen, fordert Cagé. Die Jagd nach Gewinnen würde dazu führen, das Ziel aus den Augen zu verlieren, das Publikum mit unabhängigen und verlässlichen Informationen zu versorgen. Wie Wickert hält Cagé an dem Gedanken fest, dass die Medien unverzichtbar sind für eine aufgeklärte Gesellschaft.
Die propagierte Rechtsform für Medienunternehmen sähe so aus: Teilhaber könnten ihre (steuerlich geförderten) Einlagen nicht zurückziehen, es würden auch keine Dividenden ausgeschüttet. Wer mehr als ein Prozent zum Stammkapital beisteuert, erhält Stimmrechte. Die vielen, die weniger beisteuern, könnten sich in Vereinen organisieren, um Einfluss zu nehmen. Damit nicht ein paar Reiche kontrollieren, will Cagé das Prinzip "eine Aktie, eine Stimme" außer Kraft setzen und eine Schwelle festsetzen, jenseits derer die Stimmrechte weniger als proportional zur Kapitaleinlage steigen würden.
Das Modell läuft darauf hinaus, die Medien auf eine breite Eigentümerbasis zu stellen. Cagé hofft, dass sich durch entsprechende Anreize "Lesergesellschaften" bilden; sie sieht darin eine "Wiederaneignung der Information nicht bloß durch die, von denen sie produziert, sondern auch durch die, von denen sie konsumiert wird".
Auch dies setzt freilich voraus, dass Menschen bereit sind, für "ihre" Medien zu bezahlen. Und dann käme, weil nicht nur der Milliardär, sondern auch die Masse borniert sein kann, die nächste Frage: Sind die vielen Anteilseigner wirklich bereit, sich auf das Abenteuer der Aufklärung einzulassen - oder wollen sie nur lesen und sehen, was ihre Vorurteile bestätigt?
Tanjev Schultz ist Professor für Journalismus an der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz. Bis 2016 war er Innenpolitik-Redakteur bei der SZ.