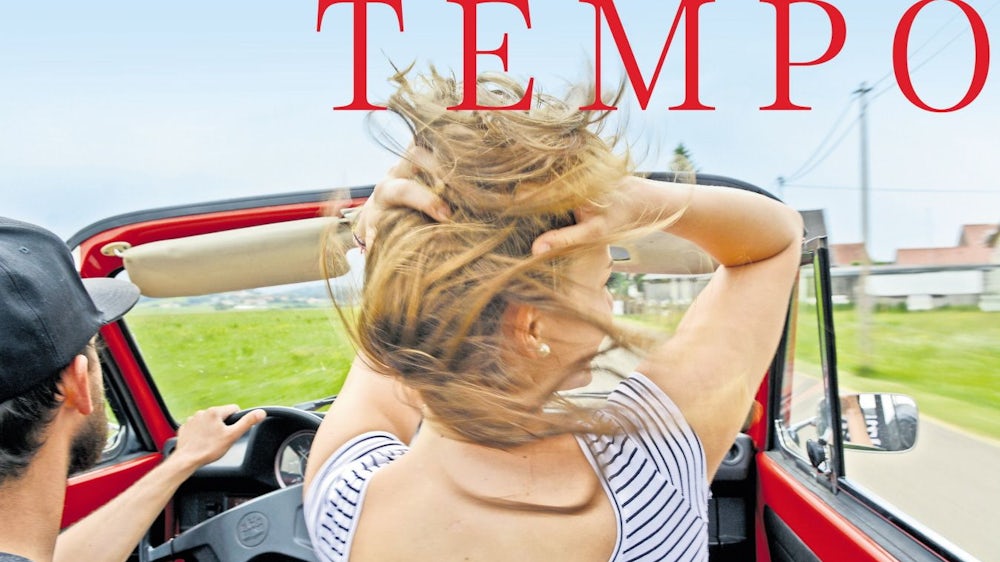Es war an einem Dienstagabend. Mein guter Freund Otto und ich saßen an der Isar in München. Wir redeten über dies und das, die Zukunft, das Leben, aber Otto war nicht bei der Sache. Er drehte seine Bionadeflasche zwischen den Fingern, scharrte mit den Füßen im Gras herum und schaute immer wieder auf sein Handy, ohne tatsächlich draufzuschauen. Dann platzte es plötzlich aus ihm heraus: "Wir werden alle arbeiten, bis wir tot umfallen." Bämm.
Das konnte einfach nicht wahr sein. Für mich war Otto immer der Inbegriff dessen gewesen, was die Soziologen "Generation Y" nennen. Gemeint sind wir unter 30-Jährigen, für die eine ausgewogene Work-Life-Balance angeblich alles ist. Für die eine Karriere nur infrage kommt, wenn sie Spaß macht und sich flexibel in den individuellen Lebensentwurf integrieren lässt. Kurz: an denen Stress abprallt, weil er einfach nicht ins Modell eines ausgeglichenen Lebens passt. So ist Otto. Wenn er eine gute Idee braucht, setzt er sich ins Café und sinniert so lange, bis ihm etwas Schlaues einfällt. Wenn er verspannt ist, lässt er alles stehen und geht rennen im Park. Und jetzt redet sogar er vom Burn-out. Weil ihm alles viel zu schnell geht.
Tempo: Wann ist das eigentlich ein Wort geworden, vor dem die Leute Angst haben? Oder anders gefragt: Wenn meine Generation tatsächlich das Patentrezept gegen den Beschleunigungswahn erfunden hätte, wie ihr gerne unterstellt wird, warum denken dann immer mehr von uns so, wie mein Freund Otto denkt? Dass ihnen alles zu viel, zu schnell, zu unübersichtlich wird? Dass die Balance aus Arbeit und Leben gekippt ist?
Sicher, die Arbeitswelt hat sich beschleunigt. Wir landen nach der Uni nicht mehr in einer Festanstellung, die nach vier Jahrzehnten in einen sorgenfreien Ruhestand plätschert. Heute konkurriert die ganze Welt, Frauen wie Männer, um die interessanten Jobs, deren Anforderungen sich wiederum laufend verändern. Lebenslange Festanstellung? Geregelte Altersvorsorge? Begriffe aus dem Geschichtsbuch.
Slow Food, Slow Life, Slow Travel: Davon schwärmen jetzt alle
Aber statt die Geschwindigkeit als Herausforderung zu verstehen, ist die Öffentlichkeit in eine Art Gemütlichkeitsstarre verfallen: Augen zu, innehalten und träumen. Buchhandlungen, Zeitschriftenregale und Kochforen flöten dem Publikum seit ein paar Jahren vor allem eine Silbe zu: Slow. Slow Food, Slow Life, Slow Travel. Alles muss langsamer werden, lautet die Grundthese. Erst dann kann es gut werden. Selbsthilfebücher wie "Die 7 Geheimnisse der Schildkröte" erklären, dass das wahre Glück im Nichtstun schlummert. Slow gegen Schnell, das heißt ganz klar Gut gegen Böse.
Beim Online-Versand des Buchhändlers Hugendubel kann der gestresste Leser derzeit aus mehr als 120 Werken zum Thema Entschleunigung auswählen. Und die Zeitschriftenlandschaft dürfte nicht mehr lange brauchen, bis sie mit ihren Slow-Titeln auch im dreistelligen Bereich angekommen ist. Titel wie Landlust oder Flow waren nur die Vorreiter. Das in weichen Farben abgebildete Märchen eines rustikal-ästhetischen Lebens vor den Toren der Großstadt ist längst publizistischer Mainstream. Millionen Leser sitzen in ihren Mietwohnungen und träumen von einem Leben im Schneckentempo, irgendwo zwischen selbstgekochter Marmelade und rüschigen Blümchenkleidern. Dass so ein Idyll mit dem wahren Landleben etwa so viel zu tun hat wie die Zukunftsangst meines guten Freundes Otto mit echten Lebensproblemen, ist den wenigsten bewusst.
Was war eigentlich zuerst da, fragt man sich beim Lesen der pastellfarbenen Entschleunigungsprosa, die Sehnsucht nach dem ruhigen Leben oder die romantisch aufgehübschte Inszenierung dieses Lebens? Haben wir wirklich alle Angst vor dem Tempo der Gegenwart, oder haben wir einfach zu oft gelesen, dass es uns kaputt und krank macht? Es ist doch so: Wenn einem ständig jemand einredet, dass man Probleme hat, glaubt man irgendwann selbst daran. Und wenn man immer nur von Leuten umgeben ist, die darüber klagen, wie schnell und stressig alles geworden ist, dann wird man sich eher früher als später selbst gestresst fühlen. Da hilft auch ein Eimer selbstgemachte Marmelade nicht weiter.
Was ist Tempo wirklich? Also dann, wenn man die angstbesetzten Assoziationen mal weglässt? Es ist Bewegung, ganz simpel. Ein Ding, eine Idee, ein Mensch kommt voran. Zum Beispiel in der Achterbahn. Ist das nicht ein irres Gefühl, wenn sich die Wagen ratternd in den Himmel schrauben? Wenn der Fahrtwind einem die Haarsträhnen ins Gesicht peitscht, die Schreie des Nebenmanns nur noch wie ein dumpfes Hallen klingen, weil der Kopf so fest in die dicke Lehne gepresst wird, dass einem alle Gesichtszüge entgleiten? Das Kribbeln im Magen, der noch immer den letzten Looping verdaut, die Hände, die sich in den Schutzbügel krallen, während die Bahn schon wieder langsam Richtung Startrampe zurückrollt? Tempo ist pure Lebensenergie.
Oder die Bewegung von einem Land ins nächste. Das heutige Reisetempo macht es möglich, in einem Leben fast die ganze Welt zu sehen, selbst mit Sparbudget. Für meine Großeltern war es früher das Größte, im Urlaub mit dem Auto von Berlin bis nach Österreich zu fahren. Zwei Tage brauchten sie für die Strecke. Als ich alt genug war, um allein zu reisen, konnten sie es kaum begreifen, dass ich in der gleichen Zeit, die sie damals gebraucht hatten, bis nach Südostasien fliegen konnte - und dass meine Karte von dort genauso schnell bei ihnen in Berlin ankam. Sie staunten. Selbst hätten sie es aber nicht erleben wollen. Was für mich normal war, hätte ihnen Angst gemacht.
Wenn das Leben schneller wird, dann wird der Mensch nervös. Das war schon immer so. Als die ersten Dampfloks fuhren, befürchteten Ärzte, dass die hohe Geschwindigkeit die Köpfe der Passagiere zum Platzen bringen würde. Heute lösen andere Dinge Ängste aus. Das Internet, natürlich. Aber auch die zunehmend globalisierte Arbeitswelt. Oder die Auflösung der klassischen Familienstrukturen. Dass hinter diesen temporeichen Veränderungen vor allem Chancen stehen - auf eine zusammenwachsende Welt ohne Nationalismus, auf ein aufregendes, intellektuell forderndes Berufsleben, auf ein Ende des Patriarchats, und das nicht nur in der westlichen Welt - das sehen nur wenige. Befremdlich ist, dass es auch nur wenige junge Menschen sehen, zumindest im ruhigen, reichen und sicheren Westen.
Nehmen wir nur mal das Internet, den größten Tempomacher der Menschheitsgeschichte. Eine Erfindung, die die Art, wie wir arbeiten, uns informieren, Freundschaften pflegen, Beziehungen eingehen, Jobs finden, reisen oder uns einfach nur unterhalten, so sehr verändert hat wie nichts zuvor. Toll, könnte man sagen. Was für ein Privileg, so eine aufregende Zeit erleben und mitgestalten zu dürfen! Stattdessen wird genölt und gejammert.
Eine Umfrage des IT-Branchenverbands Bitkom vor einem Jahr kam zu dem Ergebnis, dass jeder Arbeitnehmer im Durchschnitt 18 berufliche Mails pro Tag empfängt, Spam und Werbung schon rausgerechnet. Doch statt dass wir uns freuen, dieses ultraeffiziente Kommunikationsmittel zur Verfügung zu haben, überwiegt in fast jedem Artikel oder Vortrag zum Thema die Sorge. So viele Informationen! Dauernd muss man irgendwem antworten! Dann diese Kurzformeln! Lol! Hdl! WTF! Und warum schreibt eigentlich keiner mehr Briefe? Das war doch so schön.
Wenn nicht über das Internet geschimpft wird, ist das Handy dran. Dieses kleine Monster. Alle zwei Jahre lockt der Mobilfunkanbieter bei Vertragsverlängerung mit einem neuen Modell . . . was für ein Stress! Da hat man sich kaum an all die komplizierten Funktionen gewöhnt und soll schon wieder umlernen?
Genau. Beziehungsweise: Solche Sorgen hätten die Deutschen vor 70 Jahren auch gerne gehabt. Oder die Menschen in den Ländern, in denen es noch kein Jahrzehnt des Wirtschaftswunders gab. Davon, dass es in Entwicklungsländern eine Nachfrage nach Slow-Produkten gibt, hat man noch nichts gehört. Im Gegenteil. Dort, wo es noch keine Bionade zu kaufen gibt und Burn-out noch ein Fremdwort ist, geht es den Menschen in Sachen Fortschritt, wenn überhaupt, viel zu langsam vorwärts.
Wer im Leben nur Schritttempo fährt, kommt nicht weit
Ganz anders wir jungen Deutschen. Wenn ich mich in meinem Bekannten- und Kollegenkreis umschaue - Stadtmenschen um die 30, gut ausgebildet und weit gereist -, sehe ich nicht einen Otto, sondern 100 Ottos. Nachdenkliche Individualisten? Ja, aber als solche sind sie längst in der Mehrheit.
Was all diese an sich sympathisch vergrübelten Tempo-Gegner ausblenden, ist die Tatsache, dass sie gar nicht in der Lage wären, sich so zu beschweren, wenn frühere Generationen nicht aufs Gaspedal getreten hätten. Pathetisch gefragt: Wo wäre der Mensch angekommen, wenn er immer nur Tempo 30 gefahren wäre? Glaubt irgendjemand, wir könnten heute kritische Tweets über den vermeintlichen Tempoirrsinn in unser Smartphone tippen, wenn unsere Gattung so selbstversunken durchs Leben flaniert wäre, wie es die Slow-Freunde predigen?
Die Angst vor der Geschwindigkeit richtet sich nicht nur gegen den Stress, den der Einzelne im Leben hat oder zu haben glaubt. Sie stemmt sich gegen alles, was das Leben zu dem gemacht hat, was es heute - allen Kriegen, Finanzkrisen und Umweltkatastrophen zum Trotz - im Großen und Ganzen ist: so sicher, so lang und so aufregend wie nie.
Deshalb, mein lieber, nachdenklicher Otto: Hör nicht auf die Angsthasen aus den Slow-Redaktionen. Freu dich stattdessen auf ein spannendes, im besten Sinne unvorhersehbares Leben. Tempo sei Dank.