Das sei die Jahreszeit, "für die es sich zu leben lohnt", tröstet Jiro im Roman "Kojin" (Der Wanderer) von Sōseki Natsume seinen Bruder, dessen Ehe in der Augusthitze zerbrochen ist. Der japanische Sommer lastet bleiern auf den Menschen, er macht jede Bewegung schwer. Am ersten Abend, an dem es etwas kühler wird und die Luft klarer ist, blickt Jiro in den Nachthimmel und seufzt erleichtert. Für seine Formulierung "für die es sich zu leben lohnt", verwendete Natsume, einer der Großen der japanischen Literatur, den Begriff "Ikigai",, der sich zusammensetzt aus den Wörtern 生き, "Leben", und 甲斐, "Sinn, Ergebnis, Wert".
Leben und Sinn und dann auch noch mit lohnendem Ergebnis? Kein Wunder, dass eine Idee wie Ikigai es nun auch nach Europa geschafft hat. In einer Zeit, in der alle ständig Orientierung suchen, wird die fernöstliche Lebensphilosophie auch hierzulande populär; die Sachbuchautoren Francesc Miralles und Héctor García etwa entdecken Ikigai als Möglichkeit für Selbstoptimierer, "um gesund und glücklich hundert zu werden". Diese Definition ist nicht unbedingt falsch, würde aber die meisten Japaner erstaunen. Mal abgesehen davon, dass die Autoren unter anderem auch "Anti-Aging-Gesetze" mitliefern (zum Beispiel sollte man sich stets mit Sonnencreme einschmieren). Wer sich die Mühe macht, Japaner danach zu fragen, begreift, dass dieses Wort für jeden etwas ganz anderes bedeutet.
Mit "Ikigai" hatte der Schriftsteller Natsume 1912 einen Begriff in den Alltag eingespeist, der in der Sprache des Hofes bereits seit Jahrhunderten existiert hatte und auch in der mittelalterlichen Lyrik vorgekommen war. Aber die Fischer und Bauern, Handwerker und Händler lebten ihr Leben, ohne es kritisch zu hinterfragen. Das ist, obwohl seit den Siebzigerjahren ganze Wellen von Ikigai-Büchern durch Japans Buchläden schwappen, heute nicht anders. Viele Japaner reagieren deshalb überrascht, wenn sie nach ihrem Ikigai gefragt werden. Einige sagen, Ikigai sei ihnen wichtig, andere finden das weniger. Und alle haben Mühe, den Begriff zu definieren. "Ein Traum, nein, ein Traum ist es nicht", sagt ein junges Mädchen. Und nach langem Nachdenken: "Ikigai ist das, wofür man weiterlebt, wenn man traurig ist."
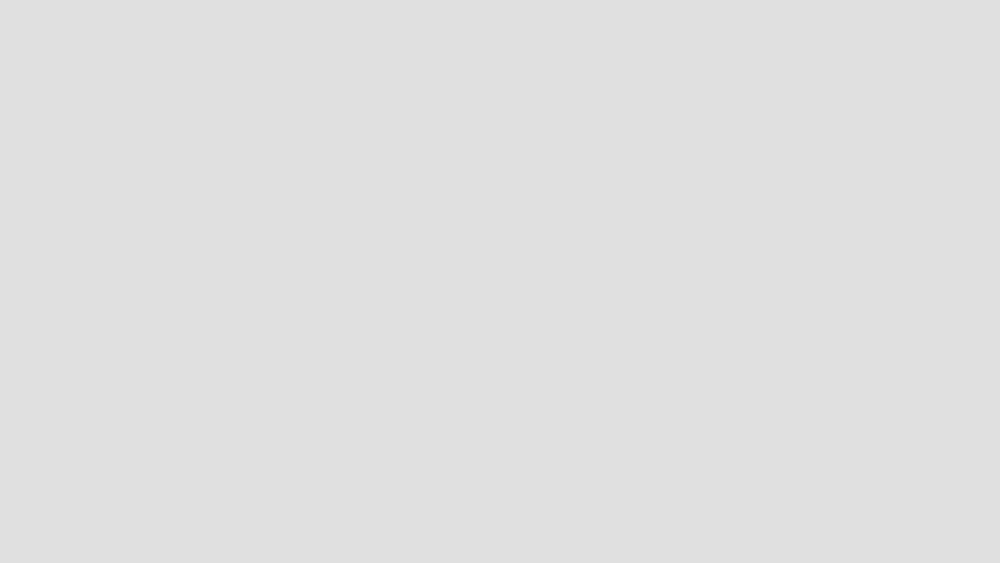
Immerhin, die Definitionen lassen sich tatsächlich nach Geschlecht und Generationen gliedern. Im Laufe ihres Lebens habe sich ihr Ikigai verändert, bestätigt eine 78-jährige Nachbarin. Jetzt wolle sie vor allem gesund bleiben, um "ohne große Probleme über die letzten zehn Jahre zu kommen und dann schnell zu sterben". Sie fürchte Krankheiten, esse deshalb gesund, achte auf ihr Gewicht und gehe täglich 10 000 Schritte. Oder fast täglich. Außerdem unterrichtet sie als Freiwillige Japanisch für Ausländer, lernt Koreanisch, geht zweimal pro Woche ins Kino und pflegt den Kontakt zu ihren Mitschülern von vor sechzig Jahren. "Aber es sterben immer mehr." Ihr Mann dagegen sitze seit seiner Pensionierung zu Hause, klagt sie, meist am Computer. Es gelinge ihr nur mit Mühe, ihn zu Spaziergängen zu bewegen.
Ein ganz auf die individuellen Bedürfnisse reduziertes Ikigai, wie es Miralles und García in ihrem Buch präsentieren, ist für die Japaner neu. Bis vor wenigen Jahrzehnten war das Ikigai der Männer die Firma, jenes der Frauen die Kinder. Die Gesellschaft ließ gar nichts anderes zu.
Im Zweiten Weltkrieg trieb die staatliche Propaganda derartiges Schubladendenken noch weiter. Sie ersetzte den Begriff mit "Shinigai", "wofür es sich zu sterben lohnt". Und es wurde debattiert, ob gefallene Soldaten in ihren letzten Atemzügen nach der Mutter riefen oder ob sie ihr Leben für den Kaiser ließen. Die Verfasser des "Kaiserlichen Erziehungsedikts" von 1890 hätten diese Unterscheidung nicht verstanden, notierte der Anthropologe Robert Smith in "Japanese Society". "Sie behaupteten, die beiden Gefühle seien identisch." Während Männer den Sinn ihres Lebens darin finden sollten, für den Kaiser zu sterben, galt für Frauen: "Umeyo! Fusayo!" ("Gebärt! Vergrößert die Nation!")
Im Krieg hat man nicht die Muße, nach dem Sinn des Lebens zu suchen. "Auch nach dem Krieg waren alle verzweifelt dabei, genug zu essen zu finden. Niemand hatte Zeit, über ,Ikigai' nachzudenken", schrieb die Psychiaterin Mieko Kamiya. Das kam erst mit dem Wohlstand der Siebzigerjahre. Dabei richteten sich schon damals viele Texte an die Älteren. Die Generation, die Japan wiederaufgebaut hatte, erreichte das Rentenalter - und blieb, anders als ihre Eltern, bis 70 und 80 fit. Zumindest die Frauen. Viele Männer, die ein Leben lang für die Firma geknechtet hatten, hockten dagegen tatenlos zu Hause und gingen ihren Frauen auf die Nerven. Seither verhöhnt man in Japan männliche Rentner, die nichts mit sich anzufangen wissen, als "sodai gomi" (Sondermüll). Sie sind das wichtigste Zielpublikum der Ikigai-Selbsthilfebücher.
Die Japaner bestehen darauf, jeder müsse seinen Platz in der Gesellschaft kennen - und ihn auch einnehmen: in der Firma, in der Gruppe, in Freiwilligen-Organisationen, als Angehöriger seiner Generation. Wer ausschert, wird geächtet. Ein anderes Gebot lautet, man dürfe niemandem zur Last fallen. Daraus leitet sich ein sozialer Druck ab, der die Rentner zwingt, sich nützlich zu machen. Vor allem mit Freiwilligenarbeit. Vize-Premier Tarō Asō sagte einmal, Alte, die keine Aufgabe mehr erfüllten, sollten besser sterben, statt dem Staat zur Last zu fallen. Ein Ikigai zu haben und sich um seine Gesundheit zu kümmern, ist für Japans Alte demnach eher Pflicht als Selbstverwirklichung.
Der Anthropologe Gordon Mathews zeigte in seiner Studie "What Makes Life Worth Living", dass Ikigai zwar ein japanisches Wort ist, das Phänomen der Sinnsuche aber in allen Gesellschaften eine Rolle spiele. Die Amerikaner, die er befragte, kannten den Begriff nicht, verstanden ihn aber genau. Doch auch Mathews fiel auf: Das Ikigai der Japaner orientiert sich mehr an sozialen Normen und Zwängen als jenes der Amerikaner. Früher war es "komplett soziozentrisch", schrieb er. Eine Einladung zum Egozentrismus wie im Westen ist Ikigai in Japan bis heute nicht, erst recht kein Zehn-Punkte-Programm zu einem besseren Leben. Wenn Japaner über ihr Ikigai erzählen, beziehen sie sich meist auf die Gesellschaft. Sie sehen sich in einem Konflikt zwischen Wunsch und Pflicht und suchen ein Gleichgewicht zwischen Wollen und Sollen.
Das Meinungsforschungsinstitut CSR hat die Japaner in einer Studie gefragt, ob sie Ikigai hätten. Drei Viertel bejahten, die Mehrheit sagte, sie finde ihr Ikigai jenseits der Arbeit. Das war noch in den Boom-Jahren bis 1991 anders, so Mathews. Das Soll-Ikigai war damals die "totale Hingebung der Männer an ihre Arbeit, und der Frauen an die Familie". In Japan nehmen die Kinder ihre Eltern anders in die Pflicht als bei uns. Vor allem die Mütter, die vom Kindergarten und der Schule in viele Abläufe eingespannt werden. Im Westen gilt ein Kleinkind als hilfloses abhängiges Wesen, das die Eltern in die Unabhängigkeit führen sollen. In Japan dagegen werden Babys vielerorts noch als asoziale Wesen betrachtet, die erst im Elternhaus und in der Schule sozialisiert werden.
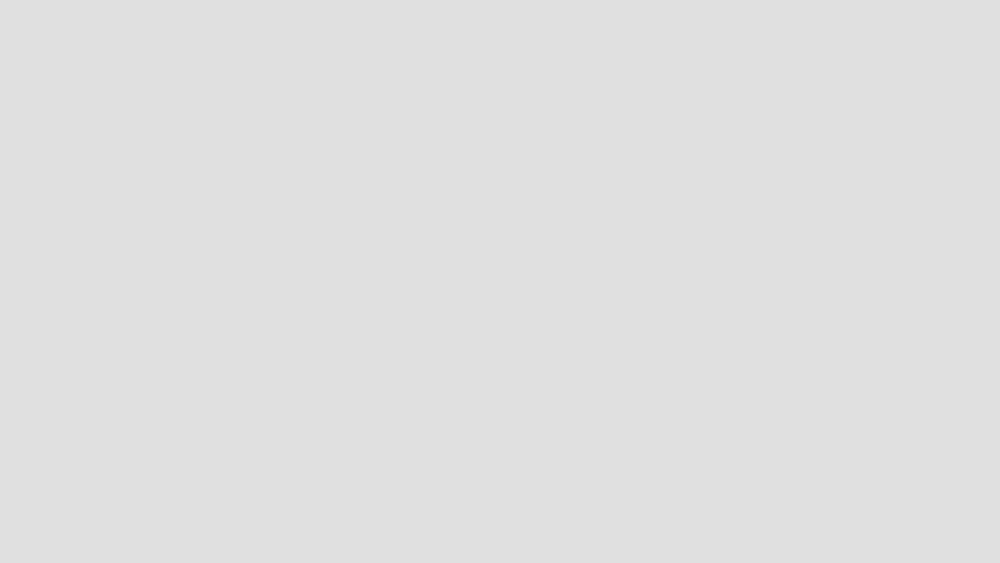
"Definitionen von Ikigai gibt es mehr, als es Japaner gibt", erläutert ein Professor der Psychologie. Aber eigentlich sei Ikigai vor allem ein Thema für Selbsthilfebücher. "Für die Frauen sind es die Kinder, auch heute noch." Und für die Männer die Firma? "Nein, das Geld - oder die Frauen." Zitiert werden wolle er damit aber nicht, sagt er lachend, zieht Pokerkarten aus der Tasche und führt Kartentricks vor. "Das ist mein Ikigai."
In Natsumes Roman fühlt Jiro körperliche Erleichterung, als er am ersten lauen Abend des Spätsommers sagt, nun lohne es sich zu leben. Eine physische Erleichterung, wenn sie ihr Ikigai gefunden haben, spüren auch moderne Japaner. Als hätten sie sich einer Pflicht entledigt.
Francesc Miralles, Héctor García, "Ikigai - Gesund und glücklich hundert werden", aus dem Spanischen von Maria Hoffmann-Dartevelle, Allegria