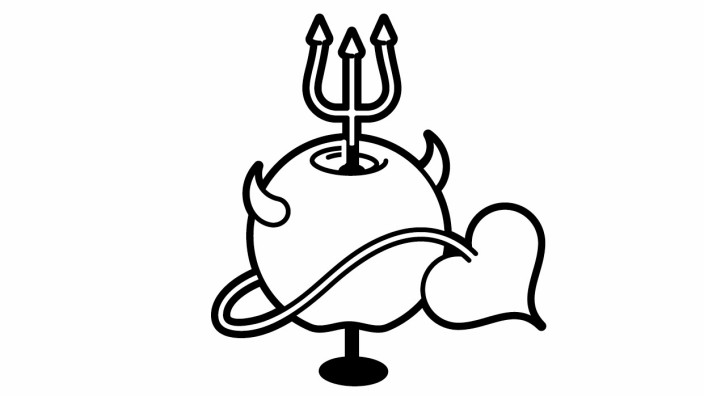Manchmal muss ich Hell's Kitchen verlassen, und das fällt mir zunehmend schwerer. Ich rede nicht davon, dass ich mal einen Abend rüber nach Brooklyn fahre, wo viele meiner Freunde wohnen, was daran liegt, dass es eine Zeit gab, in der Brooklyn viel günstiger war als Manhattan. Mittlerweile kann man in Teilen Manhattans für weniger Geld wohnen als in Teilen Brooklyns, vor allem, wenn man sich, um mal irgendein Beispiel zu nennen, für eine bescheidene Bleibe im 17. Stockwerk eines ehemaligen Schwesternwohnheims in Hell's Kitchen entscheidet statt für ein Loft mit Flussblick in Williamsburg. Ich rede auch nicht davon, dass ich kurz rauf nach Harlem schaue, wo der Fotograf W. Wohnstatt bezogen hat, dessen Fähigkeiten am Herd ebenso fantastisch sind wie an der Kamera. An manchen Tagen, wenn die Götter es gut mit mir meinen, bewegen sie W. dazu, in Hell's Kitchen anzurufen mit der Frage, ob ich am Abend auf einen Teller Nudeln mit Wodka-Soße vorbeikommen wolle. Die richtige Antwort lautet, unter absolut allen Umständen: Ja.
Im Moment befinde ich mich auf einer kleinen Dienstreise, und ich bin erstaunt darüber, wie sehr ich Hell's Kitchen vermisse. Ich neige nicht dazu, Orte zu vermissen, und ich neige nicht dazu, mich irgendwo zu Hause zu fühlen. Ich kann auch mit dem Ausdruck, man sei irgendwo angekommen, nicht viel anfangen. Man kommt, das ist meine Überzeugung, nie irgendwo an, man reist von A nach B nach C und immer so weiter, und irgendwann hat man seinen letzten Buchstaben erreicht, und das ist genau gut so.
Die Klimaanlagen surrten, von drüben winkte die Brasilianerin
Vor knapp zwei Wochen, kurz vor Beginn meiner kleinen Dienstreise, kam ich vom Einkaufen im Amish Supermarket zurück. Ich spazierte am Briciola vorbei, einem italienischen Restaurant, dem ein schwer tätowierwerter Franzose namens Cy vorsteht. 16 Uhr, Lunch war vorbei, Dinner hatte noch nicht begonnen. Cy saß auf der Bank vor dem Lokal und entspannte. "Christian", rief er mit seinem harten Akzent, als er meiner gewahr wurde. Er pflegt den Akzent, obwohl er seit 20 Jahren hier lebt. "Setz dich zu mir", sagte er. Ich setzte mich zu ihm.
Cy erzählte zum vierten oder fünften Mal, dass die Brasilianerin vom Restaurant gegenüber seine große Liebe ist. Ich erzählte zum vierten oder fünften Mal, dass ich in diesem Sommer auf meinem Balkon klitzekleine grüne Chilis gezüchtet habe. Nach einer Weile holte Cy zwei Gläser vom Hauswein, wir tranken und redeten, so verging eine Stunde. Die Klimaanlagen surrten, ein Wind zog durch die Straße, von drüben winkte die Brasilianerin, wir winkten zurück, und aus einer, wie mir schien, Laune heraus fragte ich: "Kannst du hier je wieder weggehen?" Cy lachte kurz auf. Er schaute mich an, er hob sein Glas und gab keine Antwort, weil er natürlich wusste, dass die Frage nicht an ihn gerichtet war.