Das Café Einstein in der Nähe des Berliner Regierungsviertels: weiße Tischdecken, schwarz gekleidete Kellner und ein Hinterzimmer, in dem genau geguckt wird, wer hier mit wem etwas zu besprechen hat. Die Journalistin Miriam Meckel kennt solche Ort gut aus ihrer früheren Karriere als Politikerin. Vor dem Gespräch legt sie ihr Smartphone mit einer kleinen Geste der Macht neben sich. Diskret, aber das Gegenüber soll schon wissen, dass Zeit kostbar ist.
SZ: Frau Meckel, vor fünf Jahren machten Sie Ihr Burn-out öffentlich, heute haben Sie als Chefredakteurin der Wirtschaftswoche wieder einen Turbo-Job. Ist das nicht ein Widerspruch?
Miriam Meckel: Nein, ich habe danach ja normal weitergelebt und gearbeitet, allerdings selbstbestimmter. Ich muss keine Flugmeilen mehr zählen, weil ich weniger in der Welt herumreise, und wo immer ich Hotels vermeiden kann, meide ich Hotels. Der Mensch braucht einen Ort, an dem er sich verankern kann.
Bekommen Sie noch immer Hunderte E-Mails am Tag wie damals, als Sie wegen Überarbeitung in eine Klinik mussten?
Das schon, aber ich habe gelernt: Nicht beantwortete Mails machen bei einer von hundert einen Unterschied aus, bei 99 von hundert nicht.
Und die Sonntage - können Sie sich die inzwischen freischaufeln?
Meistens habe ich frei. Wobei der wichtigste Tag des Wochenendes für mich der Samstag ist. Der ist unbelastet, während man am Sonntag die Sonntagszeitungen liest und schon mit den Gedanken bei der nächsten Woche ist.
Die Deutschland-Chefin des Dell-Konzerns sagte einmal: Die Arbeitswoche beginnt schon Sonntagabend.
Ich kenne auch niemanden in meinem beruflichen Umfeld, der nicht sonntags anfängt zu lesen, sich vorzubereiten. Früher dauerte ein Wochenende von Freitagmittag bis Sonntagabend, heute höchstens von Freitagabend bis Sonntagmittag. Das ist eine paradoxe Entwicklung seit den Nullerjahren, denn von der Verdichtung und dem Tempo unseres Arbeitslebens her gab es keine Zeit, in der wir den Sonntag dringender gebraucht hätten als jetzt. Aber wir haben ihn abgeschafft und aus Effizienzgründen mit dem Samstag zusammengelegt. Eine Art Wochenend-Merger.
Und das in einer christlichen Kultur, die den Sonntag als ihr Kennzeichen betrachtet.
Man braucht das Christentum gar nicht, um den Sonntag zu rechtfertigen. Soziologisch gesehen gehört der Tag ja nicht nur der individuellen Rekreation, sondern dient dazu, soziale Kontakte zu pflegen. Ich selbst lebe in einer Fernbeziehung, meine Freunde sind überall verstreut, die Wochenenden sind die einzigen Synchronisationsmomente. Die Diskussion um Ladenöffnungszeiten wird ja deswegen so heftig geführt, weil wir einerseits die Flexibilität schätzen, die damit verbunden ist. Andererseits ist es entlastend, nicht auch noch sonntags herumzurennen und Quality-Time verbringen zu müssen, wie dieses bekloppte englische Wort heißt. Man darf seine freie Zeit ja nicht mehr einfach nur vertrödeln. Zeit muss überhöht und mit einem Label versehen werden.
Wer hat uns den Sonntag gestohlen? Der Kapitalismus?
Wir selbst, weil wir den Prozess mitmachen, durch eine Art Kapitalismus der Selbstoptimierung. Man guckt sich die Zahl der Schritte an, die man läuft, achtet darauf, beim Sex mehr Kalorien zu verbrennen und generell weniger Kalorien zu sich zu nehmen. Dazu kommt eine permanente Selbstvermessung, durch Fitnessbänder oder Apps, in denen man seine Aktivitäten erfassen und auf Facebook posten kann.
Was tun Sie als Chefin, wenn Sie merken, dass Ihre Mitarbeiter auch in ihrer Freizeit arbeiten oder krank sind und trotzdem E-Mails beantworten?
Früher habe ich selbst Sonntagabend zwölf Mails rausgeschickt, was alles getan werden muss. Das mache ich nicht mehr. Wenn ich aber sehe, dass einer kein Problem hat, am Wochenende etwas zu erledigen, dann stelle ich mich darauf ein. Bei den großen Konzernen ist das anders, da schaltet etwa VW am Wochenende die Server ab, damit nicht mehr gemailt wird. Das ist eine gute Sache, aber ich selbst habe ein liberales Menschenbild und denke, jeder muss selbst herausfinden, was für ihn gut ist.
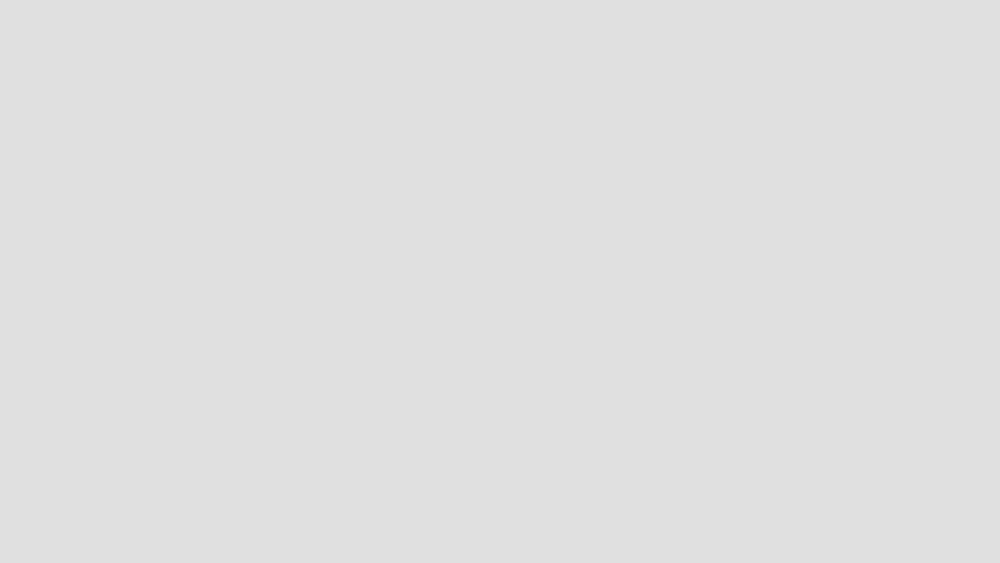
Im Umkehrschluss heißt das allerdings: Jeder ist auch für sein Burn-out selbst verantwortlich.
Durch Regulierung der Rahmenbedingungen werden wir keine Veränderungen hinbekommen. Man muss beim Einzelnen ansetzen, sonst wird man immer ein bevormundetes Männlein im Rad sein, auch wenn das Rad langsamer läuft, weil die Organisation es so will. Mich besorgt eher der Zwang zur Selbstoptimierung. Dass man dünner, achtsamer, gesünder sein muss. Inzwischen beginnen die ersten Krankenkassen, ihre Tarife mit Fitnesstracking zu verknüpfen. Wenn es aber von Fitnesstracking und vielleicht noch einer genetischen Analyse abhängt, wie ich eingestuft werde, dann geht unser ganzes Solidarprinzip den Bach hinunter, weil dann jeder sein Risiko, etwa an Krebs zu erkranken, selbst bezahlen muss.
Ist es in einem Führungsjob leichter, sich freie Zeit herauszuschlagen?
Nicht, wenn Sie etwas voranbringen wollen. Es ist aber auch nicht nur die Zeit, die knapp ist. Der Umgang mit Gefühlen ist in unserer Arbeitswelt nicht sehr ausgeprägt, und sich den Raum dafür zu nehmen, ist zusätzlich schwer. Man kann emotional veröden, und das hat irgendwann Folgen.
Wie ist es, nach einem Burn-out in der Wirtschaftswelt unterwegs zu sein, wo nur Leistung zählt?
Ich kann nicht sagen, ob ein Stigma an mir haftet, so wie ich als Frau ja auch nicht einschätzen kann, ob ich anders behandelt werde als ein Mann. Da gibt es einen blinden Fleck. Mich hat das eher entlastet, dass ich mich nicht verstecken muss, dass ein Leben nun mal Brüche hat.
Gibt es beim Burn-out eine Rückfallwahrscheinlichkeit?
Es gibt Zeiten, die gut und die weniger gut sind. Da geht nicht ein Knopf an und man hat ein Burn-out, und dann geht der Knopf wieder aus. Ich empfinde inzwischen eine Freiheit von der Erwartung, was noch alles passieren muss. Das war früher anders, da hatte ich eine klare Idee, was ich noch machen muss, wo ich noch hinwill.
Ihre Karriere begann 2001 als Staatssekretärin und Regierungssprecherin in Nordrhein-Westfalen. In der Politik sind die Sonntage die einzigen freien Tage, wie haben Sie das erlebt?
Sonntagnachmittags gab es eigentlich immer Koalitionsausschüsse oder Krisensitzungen, und wenn mal frei war, musste man Akten lesen. Unter der Woche hatte ich an sechs von sieben Abenden Termine, ein Koalitionsgespräch hier, eine Buga-Eröffnung da. Ich habe seither unheimlich viel Respekt vor Politikern. In den Job, den Angela Merkel oder Sigmar Gabriel haben, muss man sich erst mal hineinversetzen. Dazu kommt, dass das politische Geschäft immer komplexer wird. Der einzelne Politiker, die einzelne Regierung kann heute ja nicht mehr alleine handeln, und wenn dann ein europäischer Partner sagt, nein, das wollen wir nicht, folgen die schlaflosen Nächte.
Es heißt, dass sich in langen Verhandlungsnächten oft der durchsetzt, der am wenigsten Erholung braucht.
Ja, das hatten wir in den Krisensitzungen der Koalition häufiger. Um drei Uhr morgens fällt dann eine Entscheidung, die nicht immer die allerbeste ist. In der Griechenlandkrise konnte man das letztens gut beobachten, als Alexis Tsipras bei den Verhandlungen die Brocken hinwerfen wollte und zurückgerufen wurde. Das hätte in die eine oder die andere Richtung kippen können, so etwas sind Zufallsmomente. Generell kann man in der Politik Probleme aussitzen, weil die Leute müde oder mürbe werden. Das ist wie beim Mikado: Wer sich zuerst bewegt, hat verloren.
Muss man als Politiker also verinnerlichen, keine Freizeit zu haben?
Viele denken so, aber ein gutes Team muss dafür sorgen, dass jemand in einer politischen Position auch einmal einen Tag Ruhe bekommt. Sonst passieren Fehler. Das Ganze ist auch insofern unmenschlich, als die Verbindung zum realen Leben verloren geht, wenn einer denkt, die Welt bestehe nur aus Autorücksitzen, Flughäfen und Entscheidungsvorlagen. Ein Reality-Check tut jedem gut, und wenn man nur mit der Familie beim Frühstück sitzt. Mir war jedenfalls bald klar, dass die Politik nicht meine Lebensaufgabe ist.
In der Politik und später als Professorin und Unternehmensberaterin waren Sie oft die einzige Frau - wie war das?
Ich hatte immer eine Selbstreflexionsspur neben mir laufen, das Gefühl, ich werde skeptisch beäugt und muss unheimlich powern, damit ich die Position halten kann. Als ich Regierungssprecherin unter dem damaligen Ministerpräsidenten Wolfgang Clement war, gab es Leute, die gar keine Erfahrung mit einem Amt hatten, das von einer jungen blonden Frau bekleidet wurde. Da war ich ein Alien, und es wurde erst mal abgetestet: Was hat die Alte drauf. Mit einer ganz cleveren Frage im Presse-Briefing zum Beispiel. Oder es wurde eine kleine Beleidigung vorangeschickt oder ein wildes Thema angeschnitten, um zu gucken, wie empfindlich ist die.
Wie gehen Sie jetzt damit um, da Sie selbst in einer Leitungsposition sind?
In den vergangenen zwanzig Jahren hat sich zum Glück viel getan. Als ich meine erste Professur in Münster hatte, waren Studentinnen noch ganz perplex, als sie mich sahen, und sagten: Wahnsinn, wir könnten ja auch Professorinnen werden. Heute achte ich darauf, dass sich nicht gewisse Mechanismen durchsetzen. Nach dem Motto: Die Männer machen die schönen Sachen, die Frauen bleiben im Hintergrund. Die Tendenzen gibt es immer noch. Wenn Sie einen jungen Mann und eine junge Frau in einem Redaktionsteam haben, dann ist es ganz schnell so, dass er die spannenden Außensachen macht, und die Arbeit, die soll bitte sie erledigen. Da ist der Wirtschaftsjournalismus noch sehr traditionell.
Das Magazin Wirtschaftswoche verbindet man mit den stramm marktliberalen Ansichten Ihres Vorgängers Roland Tichy. Was wollen Sie auf diesem Posten?
Wirtschaft ist deutlich breiter, sie beschäftigt uns in allen Lebensbereichen. Gerade die Frage der Selbstoptimierung ist ein ökonomisches Kernthema: Produktivität. Wie organisiere ich meine Ressourcen, welche Benchmarks, um in den Begriffen zu bleiben, gehe ich an? Wie optimiere ich meine Produktivkräfte, um am Markt zu bestehen, beute ich mich selbst aus? Das ist Neuro-Kapitalismus und gehört zu einem modernen Wirtschaftsbegriff, den ich voranbringen möchte.
Was machen Manager eigentlich am Wochenende?
Es gibt Manager von Dax-Unternehmen, die machen am Sonntag tatsächlich nichts, der Tag gehört der Familie. Andere sind permanent in Aktion, weil sie Performancezwang verspüren, und dann gibt es noch die Kontrollfreaks, die sind auch always on. Wobei sich etwa in den USA die Frage, ob man sein E-Mail-Postfach mal abschalten sollte, gar nicht stellt. Dort gibt es auch viel weniger Feiertage, und die sind wiederum voller Performance. An Thanksgiving muss dann der Truthahn perfekt sein und das Familienleben wie aus einem Bilderbuch.
Sie sind in Düsseldorf als Tochter eines Theologen aufgewachsen. Wie hat sich das auf Ihre Sonntage ausgewirkt?
Ich komme aus einer traditionellen Familie mit den typischen Ritualen wie Sonntagsbraten und Nachmittagsspaziergang, und natürlich gingen wir immer zur Kirche. Als Kind spürt man die Sicherheit, die von solchen Strukturen ausgeht.
"Tatort"?
Ja, den gucke ich heute immer noch, gerne zusammen mit Freunden in einer abgefuckten Berliner Kneipe. Und ab Januar dann natürlich "Anne Will", die Talkshow meiner Lebensgefährtin. Das wird mein Wochenende noch einmal anders prägen.
Inwiefern?
Weil wir miteinander viel darüber reden, was in der Welt so los ist. Aber generell verbinde ich mit dem westdeutschen Sonntag das Gefühl, Rahmen und Rituale zu haben. Einen Tag, den man mit wichtigen Menschen verbringt und an dem man wirklich gar nichts tun muss, ja sich manchmal sogar auf gute Weise ein wenig langweilt. Dafür könnte man schon eine gesellschaftliche Bewegung in Gang setzen.
Der deutsche Sonntag sollte vielleicht eine Art Weltkulturerbe werden.
Ja, aber dieser Sonntag wird nicht mehr zurückkommen, genauso wenig wie das analoge Telefon oder der Taschenrechner. Es war die Philosophin Susan Sontag, Achtung: Namenswitz, die sagte: Zeit gibt es, damit nicht alles auf einmal passiert, und Raum, damit nicht alles dir passiert. Es kann uns nicht alles auf einmal geschehen, es muss unter unseren volatilen Lebensbedingungen feste Räume und Rituale geben, und da kommt dann der Sonntag ins Spiel.
Stichwort Sonntagabend-Depression?
Kenne ich, total. Mir fällt dann immer dieses Gedicht mit dem Reh von Joachim Ringelnatz ein.
Ja?
(beginnt zu rezitieren) Ein ganz kleines Reh stand am ganz kleinen Baum
Still und verklärt wie im Traum.
Das war des Nachts elf Uhr zwei.
Und dann kam ich um vier
Morgens wieder vorbei,
Und da träumte noch immer das Tier.
Nun schlich ich mich leise - ich atmete kaum -
Gegen den Wind an den Baum,
Und gab dem Reh einen ganz kleinen Stips.
Und da war es aus Gips.
Sehr schön.
Genauso ist es mit dem Sonntag. Wir schleichen um ihn herum, er ist ganz ruhig und friedlich und sieht wunderbar aus. Wir denken, er ist real, und dann berühren wir ihn, und er ist gar nicht echt.