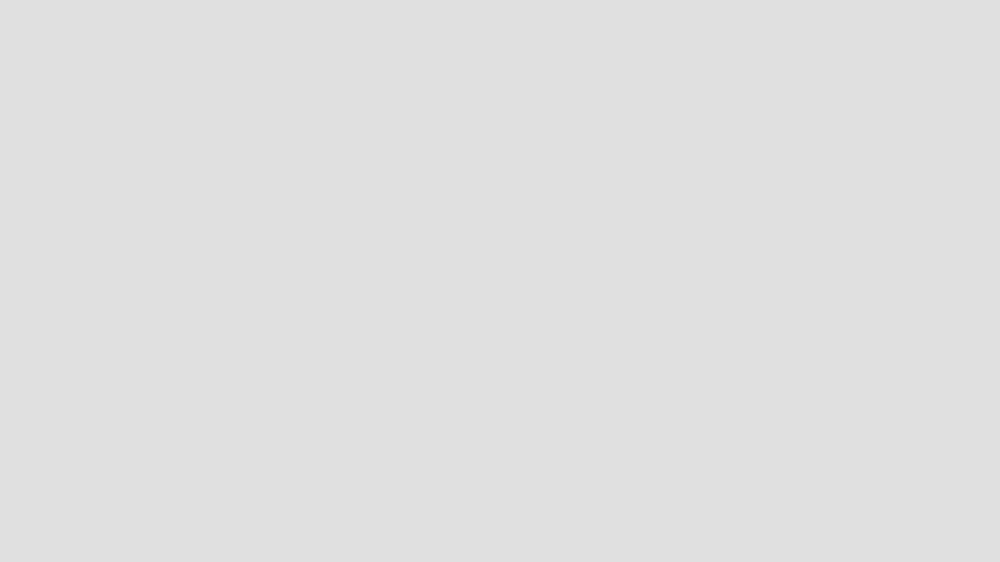Die Zitterpartie der amerikanischen Präsidentschaftswahl geht weiter. Auch die zweite TV-Debatte mit den beiden Bewerbern hat nichts zutage gefördert, was man nicht schon vorher wusste: hier der bullige, aggressive, wild schwadronierende Mann, dort die perfekt vorbereitete, sachkundige, bis in ihr Mienenspiel kontrollierte Frau. Eigentlich könnte die Sache entschieden sein.
Ist sie aber nicht: Denn die Schwäche des einen wird bei seinen Redneck-Getreuen zur Stärke, während die Stärke der anderen in den Augen vieler als Schwäche erscheint. Selbst wenn sich Donald Trump noch mehr Skandale und bizarre Lügen erlaubt, wird das seine Gefolgschaft nicht im Geringsten beeindrucken. Umgekehrt kann Hillary Clinton noch so kompetent und souverän auftreten und Wahlkampfhilfe von Michelle Obama bekommen - es macht sie dem amerikanischen Wahlvolk nicht sympathischer. So unterschiedlich die Kandidaten sind, bei zwei Dritteln der Wähler stoßen sie gleichermaßen auf Misstrauen.
Warum Trump dieses Misstrauen mehr als verdient, darüber braucht man nicht zu streiten. Aber was ist mit Hillary los? Mit großen Vorschusslorbeeren gestartet, lange Zeit als einzig ernst zu nehmende Kandidatin der Demokraten gehandelt, kam sie schon ins Strudeln, als mit Bernie Sanders eine unerwartete Alternative auftauchte. Dem alten Senator aus Vermont und seiner jungen Klientel gelang es, Clinton in den Vorwahlen so zu beschädigen, wie es kein republikanischer Herausforderer gekonnt hätte. Gegenüber dem libertär-links auftretenden Sanders wirkte sie wie die Verkörperung des arroganten Ostküsten-Establishments. Ihre Verbindungen zur Wall Street, an denen sich vorher kaum jemand gestoßen hatte, hingen ihr auf einmal wie Mühlsteine am Hals.
Es lohnt sich, über die Gründe dafür nachzudenken - über das Manko der eigentlich überlegenen Kandidatin Hillary Clinton, deren Beherrschtheit viel darüber aussagt, wie Frauen, die höchste Führungsaufgaben anstreben, in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden.
Schon einmal hat sie gegen einen charismatischen Mann den Kürzeren gezogen - 2008, als Barack Obama, ein junger unbekannter Senator aus Illinois, bei den demokratischen Vorwahlen gegen sie antrat. Auch damals war sie, ehemalige First Lady, siegesgewiss ins Rennen gegangen. Auch damals hatten ihr viele Menschen in New York und Boston, in San Francisco und Los Angeles zugejubelt. Vor allem weibliche Wähler wollten endlich eine Frau im Weißen Haus sehen, und Hillary schien bestens gerüstet. Schon als Präsidentengattin hatte sie politische Ambitionen gezeigt, obgleich sie mit ihren Plänen für eine Krankenversicherungspflicht Schiffbruch erlitt. In den demütigenden Sex-Affären ihres Mannes hatte sie Haltung bewiesen.
Unvergessen der gemeinsame Auftritt in den "60 Minutes" vom Januar 1992 zu Beginn der Vorwahlen, lange vor der Affäre um Monica Lewinsky. Mit fester, fast trotziger Stimme erklärte sie der Nation, dass sie den demokratischen Präsidentschaftsbewerber nicht deshalb unterstütze, weil man das von ihr als Gattin erwarte: "Ich sitze hier nicht als kleine Frau, die ihrem Mann beisteht wie Tammy Wynette." Jeder Amerikaner kennt das Lied der Countrysängerin "Stand by your man". Lass deinen Mann niemals im Stich, selbst wenn er etwas tut, das du nicht verstehst und das dir wehtut. Hillary wollte weder klein sein noch sich unterkriegen lassen. Aus persönlicher Enttäuschung das Handtuch zu werfen, kam für sie nicht infrage. Sie dachte und handelte politisch, sie wollte, dass Bill Präsident wurde - und sie erreichte ihr Ziel.
Sie ist meist hart, auch zu sich. Aber nur eine kleine Schwäche, und sie gilt als weinerlich
Als sie sechzehn Jahre später ihre eigene Kandidatur anmeldete, kehrte sich eben jene Entschlossenheit und Ambition gegen sie. Unvergessen auch hier ihr Fernsehauftritt, diesmal ohne Bill, kurz vor den Vorwahlen in New Hampshire. Auf die Frage einer Frau, wie sie es schaffe, nach der Niederlage in Iowa gegen Obama so "fröhlich und wunderbar" zu sein, antwortete sie, die Tränen mühsam zurückdrängend, es sei für sie nicht nur eine politische Sache, sondern auch ein persönliches Anliegen, für ihr Land zu kämpfen und es auf den richtigen Kurs zu führen. Ihre gepresste Stimme und die verhaltenen Tränen wirkten Wunder: In dem Staat, dessen Motto "Live free or die" lautet, gewann sie mehr Stimmen als der schon vorab als Sieger ausgerufene Herausforderer.
Dass es letztlich doch nicht zur demokratischen Nominierung und zum Einzug ins Weiße Haus reichte, lag nicht nur an Obamas Charisma und an der unkonventionellen Wahlkampagne seiner vorwiegend jungen Anhänger. Verdrückte Tränen und persönliche Statements konnten nichts daran ändern, dass Hillary Clinton der Ruf einer grenzenlos ehrgeizigen, über Leichen gehenden Strategin anhaftete. Gerade dass sie nicht im Windschatten ihres Mannes segelte, sondern selbstbewusst um ihren Platz in Washington kämpfte, geriet ihr zum Nachteil.
Viele vermissten an Hillary Clinton das Ewig-Weibliche. Sie hätten sie gern, zumindest ein bisschen, wie Tammy Wynettes liebende kleine Frau gehabt. Als sie dieses Bedürfnis jedoch bediente und sich in New Hampshire verletzlich, menschlich, weiblich zeigte, nahmen andere ihr das übel. Die FAZ attestierte der zuvor "angriffslustigen" Kandidatin eine neue "Weinerlichkeit" und rief damit das alte Geschlechterklischee auf: Frauen heulen, Männer handeln. Einer nah am Wasser gebauten Frau aber konnte man wohl kaum das machtvollste Amt der Welt anvertrauen.
Dieselben Klischees bestimmen auch jetzt, acht Jahre später, wieder die Melodie. Als Hillary Clinton bei den Feierlichkeiten zu 9/11, in brütender New Yorker Hitze, einen Schwächeanfall erlitt, nahm Donald Trump das zum Anlass, seine virile Gesundheit hervorzukehren und gegen sie, die vorgeblich nicht Belastbare, zu wenden. Als sie kurz darauf in angespannter Fröhlichkeit und mit verspiegelter Sonnenbrille vor die Kameras trat und ausrief, sie fühle sich gut, kritisierten selbst diejenigen, die ihr wohlgesonnen waren, das als Vertuschungsstrategie; es hätte ihr besser angestanden, ihre angeschlagene Gesundheit einzugestehen. Hätte sie bei diesem Bekenntnis dann noch eine Träne ins Auge gezaubert, hätte die FAZ wieder von der neuen Weinerlichkeit schreiben können.
Will heißen: Wie sie es auch macht, es ist immer das Falsche. Jemanden wie Trump fechten seine Fehler, Plattheiten und Übergriffe nicht an. Im Gegenteil: Seine überwiegend männlichen Fans jubeln ihm nur umso begeisterter zu. Wenn Hillary Clinton diese Klientel aber als bedauernswerte Verlierer bezeichnet, fliegt ihr das um die Ohren. Maß für Maß - aber eben nicht dasselbe.
Frauen in der Politik: Das ist immer noch eine Gratwanderung, die stählerne Nerven erfordert. Hillary hat sie, und gerade das machen ihr viele zum Vorwurf, weil es so unweiblich sei. Zugleich kann ein hohes politisches Amt Weiblichkeit angeblich nicht vertragen. So etwas nennt man dann wohl einen Teufelskreis.
Die USA haben nicht nur die erste moderne Demokratie, sondern auch eine lautstarke Frauenbewegung hervorgebracht. Dass es ausgerechnet diesem Land so schwer fällt, den Teufelskreis zu durchbrechen, ist überraschend. Immerhin haben einige europäische Länder es ja geschafft, die Phalanx männlicher Herrschaftsträger aufzusprengen: neben den baltischen und skandinavischen Staaten etwa Irland mit Mary Robinson und Mary McAleese, Großbritannien mit Maggie Thatcher und Theresa May, Deutschland mit Angela Merkel, Polen mit Beata Szydło. Auch für diese Frauen war es nicht einfach, sich durchzusetzen - und selbst nachdem sie es geschafft hatten, mussten und müssen sie sorgfältig darauf achten, weibliche Fehltritte zu vermeiden.
Mächtige Frauen stehen immer unter doppelter Beobachtung: Ihre politische Performance wird stets auch danach befragt, ob sie in irgendeiner Weise durch ihre Geschlechtszugehörigkeit geprägt ist. Was hat man nicht schon heruminterpretiert an Theresa Mays Hang zu ebenso schicken wie ausgefallenen Pumps! Gerade weil es der einzige modische Clou ist, den die nüchterne Regierungschefin sich leistet, wird so manches hineingeheimnist. Von Boris Johnsons skurrilem Gehabe einmal abgesehen, fände die Neigung männlicher Politiker zu bunt gestreiften oder gepunkteten Socken niemals eine ähnliche mediale Aufmerksamkeit. Das beweist erneut, dass die Medien einerseits auf der Suche nach Weiblichkeit sind, um sie andererseits dann, wenn sie sie gefunden zu haben meinen, gnadenlos bloßzustellen und zu verspotten.
Das betrifft nicht nur modische Accessoires, sondern auch und vor allem den Umgang mit Gefühlen. Dafür sind Frauen seit dem 19. Jahrhundert vorrangig zuständig, im positiven wie negativen Sinn. Gefühle haben aber, auch das eine Weisheit des bürgerlichen Jahrhunderts, in der Politik nichts zu suchen. Hier regieren, mit einem gern benutzten Zitat Max Webers, kühles Augenmaß und sachliches Verantwortungsgefühl. Selbst wenn "heiße Leidenschaft" hinzukommt, die Weber ebenfalls für unabdingbar hielt, muss sie in kontrollierte Bahnen gelenkt werden. Dass sie dazu fähig sind, wird Frauen gemeinhin immer noch nicht zugetraut. Sie lassen sich, so das verbreitete Vorurteil, von ihren Gefühlen überwältigen und bringen damit das Staatsschiff zum Schlingern.
So kritisierten viele die Entscheidung der deutschen Kanzlerin im September 2015, die Grenzen für die auf dem Balkan gestrandeten Geflüchteten zu öffnen, als von überschwänglichen Emotionen diktiert. Als aber dieselbe Kanzlerin auf den britischen Brexit mit einer nüchternen Rede antwortete, warf ihr der Spiegel einen "eisgekühlten" Politikstil vor. Jetzt, hieß es da, sei eine "virale Rede" nötig, die "Gänsehaut" hervorrufe. Man kann sich ziemlich sicher sein: Hätte sie eine solch viral-virile Rede gehalten, hätte der Kommentator keine Gänsehaut bekommen, sondern ihren typisch weiblichen Mangel an rationalem Pragmatismus gegeißelt.
Frauen auf dem Weg zur Macht sind es gewohnt, eine Terz tiefer zu sprechen
Angesichts dieses Dilemmas raten Spindoktoren Frauen mit politischen Ambitionen, sich nach allen Regeln der Kunst auf den Doppelstandard vorzubereiten. Sie müssen zeigen, dass sie als Alphatier unter anderen Alphatieren operieren, zugleich aber mitfühlende Wärme und fürsorgliche Führung demonstrieren. Sie müssen lernen, eine Terz tiefer zu sprechen, ohne männlich zu wirken. Hillary Clinton hat all das gelernt und praktiziert es vorbildlich. Als New Yorker Senatorin und Außenministerin bringt sie eine politische Erfahrung mit, der Trump nichts entgegensetzen kann außer den ad nauseam wiederholten Tiraden gegen die Washingtoner Regierungselite. In den TV-Debatten ist sie, wie die New York Times schreibt, die einzige Erwachsene auf der Bühne. Sie schafft es sogar, Trump auf Nachfragen etwas Positives abzugewinnen: seine Kinder, die gut geraten seien, was man ihm zugutehalten könne. Für sie "als Mutter und Großmutter" sei das ein wichtiger Wert. Seinerseits gesteht Trump der gehassten Kontrahentin zu, sie sei eine Kämpferin und gebe nicht auf. Mit Blick auf den Doppelstandard steckt in diesem Kompliment allerdings eine Giftspritze. Denn Frauen müssen auch beim Kämpfen weiblich bleiben, was heißt, ihren Ehrgeiz tunlichst zu verbergen und sich den Willen zu Sieg und Erfolg nicht anmerken zu lassen. In einer Gesellschaft wie der amerikanischen, die individuelle Leistungstriumphe überaus hoch schätzt, fällt das alles andere als leicht.
Dieser kulturelle Widerspruch zwischen dem, was Frauen geziemt, und dem, was als allgemeiner Wert honoriert wird: Er ist einer der Gründe, warum es Politikerinnen in den USA besonders schwerfällt, an die Spitze zu gelangen. Ein anderer liegt in der Art, wie Kandidaten gekürt werden. Wer es in Europa zu politischer Macht bringen will, muss sich in den Parteien profilieren und interne Kabale überstehen. Das gelingt zuweilen auch Frauen, vor allem dann, wenn das männliche Personal abgewirtschaftet hat, wie in Großbritannien 1975 und 2016 oder in Deutschlands CDU nach Helmut Kohls Parteispendenaffäre. In den USA dagegen befindet sich die Präsidentschaftskandidatur nur bedingt in den Händen der beiden großen Parteien, wie das Phänomen Trump eindrücklich demonstriert. Hier spielt die öffentliche Meinung in Gestalt erratischer Vorwahlen und deren medialer Begleitung eine sehr viel größere Rolle. Im Dschungelcamp der Mediendemokratie aber können Geschlechterklischees eine Wirkmacht entfalten, die in den politischen Hinterzimmern Europas stärker gebremst und dosiert ausfällt.
Dass solche Klischees selbst in einem so ungleichen Rennen wie dem von 2016 gegen die demokratische Präsidentschaftsbewerberin zum Anschlag kommen, heißt noch nicht unbedingt, dass sie den Ausschlag geben werden. Aber wie warnte John Hudak von der Brookings Institution schon 2015: Jede Person, die sich mit Trumps Dreier - weiß, männlich und hochgewachsen - nicht vergleichen könne, habe ein Problem und müsse mit dem Misstrauen der Wähler rechnen. Bleibt nur zu hoffen, dass weiß, weiblich und nicht so groß das schafft.
Ute Frevert , geboren 1954, forscht zur Geschichte der Gefühle. Sie ist Direktorin am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin.