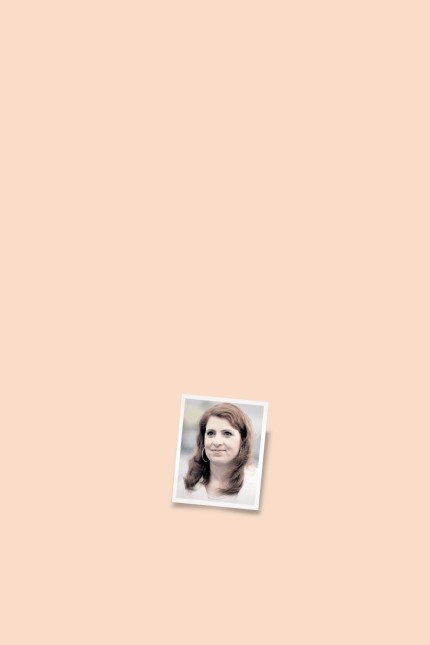Es war nur ein kurzer Abschnitt in einem langen und sehr bewegenden Interview. Für Monica Lierhaus aber brachte er erneut eine dramatische Wendung: Eben noch bewundert für ihr Durchhaltevermögen, ausgezeichnet für das "Comeback des Jahres 2014", sah sich die Sportjournalistin in dieser Woche einer Welle von Anfeindungen gegenüber.
Wieder einmal. Kaum etwas richtig machen kann Lierhaus, seit sie, von den Folgen einer Gehirnoperation schwer gezeichnet, bei der Verleihung der Goldenen Kamera im Februar 2011 zum ersten Mal wieder eine Bühne betrat. Auch damals fielen Kritiker über sie her, weil sie ihrem Lebensgefährten auf ungelenke Art, mit starrem Gesichtsausdruck und blecherner Stimme einen Heiratsantrag machte, den viele als peinlich und verstörend empfanden.
Und nun wieder so ein falscher öffentlicher Moment: "Ich glaube, ich würde es nicht mehr machen", sagte die 45-Jährige vor ein paar Tagen in einem Interview mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Sie meinte die Operation, die ihr das Leben rettete, ihr aber auch vieles nahm, weil eine unkontrollierbare Blutung Teile ihres Gehirns zerstörte. Den Hinweis, dass sie ohne den Eingriff nicht mehr leben würde, konterte sie vehement: "Egal! Dann wäre mir vieles erspart geblieben."
Was die Kritiker eigentlich meinten: Lierhaus hat gefälligst glücklich zu sein
Erspart blieb ihr auf diese Äußerung hin wenig. Mitleid hatte kaum jemand, stattdessen gab es hämische Kommentare über die "prominente Neu-Behinderte". Die querschnittsgelähmte Bloggerin Christiane Link schrieb auf Zeit online: "Wer täglich gegen das Vorurteil kämpft, dass das Leben mit einer Behinderung nicht lebenswert (...) sei, dem hat Monica Lierhaus einen Bärendienst erwiesen." Die gehörlose Bloggerin Julia Probst warf Lierhaus auf Twitter vor, das Leben von Menschen mit Behinderung abzuwerten. Und der querschnittsgelähmte Linken-Politiker Ilja Seifert, der auch Vorsitzender des Allgemeinen Behindertenverbands in Deutschland ist, sagte: "Jetzt sieht alles wieder nach Aussichtslosigkeit und ewigem Leid aus. Darum wäre es besser gewesen, sie hätte geschwiegen."
Die Debatte um Monica Lierhaus' Ehrlichkeit hat etwas Gespenstisches. Sie zeugt davon, wie unehrlich mit dem Thema Behinderung umgegangen wird. Was ist mit einer Gesellschaft los, in der Behinderte nicht mehr sagen dürfen, dass es ihnen schlecht geht? Was die Kritiker eigentlich meinten, war dies: Lierhaus hat gefälligst glücklich zu sein. Und wenn sie es schon nicht ist, dann solle sie wenigstens so tun als ob, alles andere sei fahrlässig.
Es gibt viele Behinderte, die ihr Leben schön finden. Nicht "schön trotz allem", sondern schön genau so, wie es ist. Die aus voller Überzeugung "Behindert ist man nicht, behindert wird man!" rufen und ihren Weg gehen, humpeln, rollen. Sie haben sich mit ihren Einschränkungen abgefunden oder empfinden sie nicht einmal als solche. Manche Behinderte wünschen sich gar nicht, als Nichtbehinderte weiterzuleben, vor allem dann, wenn sie von Kindesbeinen an ihr Handicap gewöhnt sind. Sie ziehen Gutes aus den Besonderheiten, die ihnen die Natur mitgegeben hat. Diese Menschen bekommen gerade wegen ihrer Behinderung oft besonders viel Zuspruch und öffentliche Bewunderung.
Nichtbehinderte blicken dagegen meist zu negativ auf ein Leben mit Behinderungen. "So wie du könnte ich nicht leben", das hören Betroffene immer wieder. Oder: "Bevor ich blind wäre, wär ich lieber tot." Das ist ähnlich großer Unsinn wie die Schönwetter-Phrasen mancher Behindertenvertreter. Gewiss: Wer selbst erlebt, dass er auch im Rollstuhl viel Bewegungsfreiheit hat oder Sprachschwierigkeiten mit technischen Mitteln ausgleichen kann, für den verliert die Behinderung einiges von ihrem Schrecken. Aber es gibt eben auch Situationen, die schlimm bleiben. Ein Leben lang. Und es gibt Menschen, die mit dem Schlimmen weniger gut zurechtkommen als andere, die unter Schmerzen, Einschränkungen oder Hilflosigkeit besonders intensiv leiden - auch dann, wenn sie psychotherapeutische Behandlung bekommen und ein hilfsbereites soziales Umfeld haben.
Für die erfolgreich Behinderten, die über ihr Handicap hinauswachsen, breitet die Gesellschaft allzu gern die Arme aus, hofiert sie, lädt sie in Talkshows. Helden der Bewältigung wie der frühere Leichtathletik-Star Oscar Pistorius, der die 100 Meter ohne Unterschenkel in weniger als elf Sekunden lief. Oder die Journalistin Zuhal Soyhan, durch ihre Glasknochenkrankheit auf 1,20 Meter geschrumpft, aber trotzdem eine Frohnatur und auch noch mit einem gesunden Mann verheiratet! Oder der Physiker Stephen Hawking, dessen Leben jüngst im Kino zu bestaunen war: Der Drehbuchautor Anthony McCarten sagte dazu in einem Interview, es sei, "als wäre Hawking einen Deal mit den Göttern eingegangen". Ein Tauschhandel quasi, der Einblick in die innerste Natur des Universums gegen den Verlust des Körpers. Was für eine absurde Überhöhung! Seit Jahren schon wird Hawking in Talkshows herumgereicht; er tritt bei "Star Trek" auf und in "The Big Bang Theory", einer Klamaukserie über gestörte Physiker. Auf Empfängen flößt ihm eine Pflegerin den Champagner mit dem Löffel ein. "Manchmal frage ich mich, ob ich nicht mehr für meine Krankheit berühmt bin als für meine Wissenschaft", sagte er einmal.
Ein ehrlicher Umgang mit Schwächen und Leid würde allen guttun
Wir lieben diese Helden am Abgrund, diese Stehaufmännchen und Kämpfertypen, weil sie uns zeigen, was alles möglich ist und dass auf den Tapferen ein Happy End wartet. Aber den Onkel, dem das Sprechen seit seinem Schlaganfall schwerfällt, meiden wir. Genauso wie die junge Frau, die sich trotz ihrer spastischen Lähmung auf den Weg zum Supermarkt macht. Öffentliches Sabbern? Ekelhaft.
Monica Lierhaus wurde, nachdem sie das Krankenhaus verlassen hatte, "angestarrt wie ein Monster"; Menschen wechselten die Straßenseite, um ihr nicht begegnen zu müssen. Nach dem Auftritt bei der Goldenen Kamera hat es nicht nur wegen ihres ungelenken Heiratsantrags hämische Bemerkungen gegeben. Sondern weil viele fanden, Menschen in einem solch desolaten körperlichen und geistigen Zustand sollten sich besser nicht in der Öffentlichkeit zeigen.
Die Solidarität endet offenbar in dem Moment, wo Gelähmte, Gehörlose, Kleinwüchsige, Spastiker eben keine Strahlemänner und -frauen sind und über ihre Situation womöglich sogar klagen. Selbst unter Behinderten ist der Diskurs über das Thema Behinderung mitunter völlig verkrampft. Dabei würde ein ehrlicher Umgang mit Schwächen und Leid allen guttun, gerade auch den Betroffenen.
Viele Behinderte würden sicher positiver auf ihre eigene Situation schauen, wenn wir ihnen mit mehr Offenheit begegneten und ihnen mehr Unterstützung zukommen ließen. Und zweifelsohne ist es inakzeptabel, wenn Außenstehende behinderten Menschen oder ihren Angehörigen einreden, dass ihr Leben nicht mehr lebenswert oder gar zu teuer oder sozial unverträglich sei.
Wer glaubt, dass in einer sozial hoch entwickelten Gesellschaft körperliche und geistige Behinderungen leicht zu bewältigen sind, liegt falsch. Es sind nicht nur Ablehnung, Ignoranz und Gleichgültigkeit, die einem schwer zu schaffen machen, es ist auch das Behindertsein an sich - vor allem, wenn es Menschen mitten im Leben trifft, durch Unfall oder Krankheit. Ob man das jetzt hören mag oder nicht: Manchmal ist es einfach nur ätzend, wenn man selbst behindert ist und die anderen eben nicht.
Und dabei sind Situationen, wie Wolfgang Schäuble sie einmal beschrieben hat, gewiss das geringste Problem: Er meide Abendveranstaltungen, sagte er, wo er sich als Rollstuhlfahrer mit Nichtbehinderten ums Buffet drängeln müsse, "um dann vielleicht auch noch von oben vollgekrümelt zu werden" oder "immer den Kopf nach oben und hinten zu verdrehen".
Dass ein Leben mit körperlichen und geistigen Einschränkungen auch gut sein kann, darf nicht zu einer Diktatur der glücklichen Behinderten führen, die den weniger glücklichen das Wort verbieten. Wehe, einer ist nicht gerne behindert! Im Schatten der großen Persönlichkeiten, die in der Behindertenbewegung aktiv sind und von Politik und Gesellschaft wahrgenommen werden, gibt es aber viele Menschen mit Behinderung, denen es schlecht geht und die hoffen, dass ihr Leben mit seinen Einschränkungen und Schmerzen nicht mehr allzu lange währt.
Behindertes Leben ist kein Wert an sich. Es ist so vielschichtig und variabel wie das Leben selbst. Es gibt eben nicht "die Behinderten", über die Behindertenvertreter zuletzt so ausführlich referiert haben, während Monica Lierhaus nur von sich gesprochen hat. Sie hat niemandes Leben abgewertet, nur ihr eigenes.
"Jedes Leben ist lebenswert", sagte dazu der Theologe Uwe Mletzko, Vorsitzender des Bundesverbands der evangelischen Behindertenhilfe. Es ist eine Anmaßung, dies über das Leben anderer Menschen zu sagen, die aus persönlicher Anschauung und auf der Grundlage von Erfahrungen, die niemand wirklich mit ihnen teilen kann, zu einem anderen Schluss kommen. Aus theologischer Sicht mag es tabu sein, das Leben nicht als Geschenk zu betrachten. Menschlich aber ist es eine Sicht, die zu akzeptieren ist.
Der Zwang zum Glücklichsein ist ohnehin schon groß genug, ein gesellschaftliches Postulat, gerade in Krisenzeiten. Viele Menschen geben an, glücklicher als zuvor zu sein, nachdem sie einen Schicksalsschlag bewältigen mussten. Sie blickten positiver auf das Leben, hätten neue, erfüllende Werte für sich entdeckt; sie berichten von einer größeren inneren Stärke. Wolfgang Schäuble sagt: "Die Erfahrung, dass von einer Sekunde auf die andere alles ganz anders sein kann, macht gelassener." Posttraumatisches Wachstum nennen Psychologen das Phänomen, das in vielen Lebenskrisen ein Segen sein kann. Doch oft folgen Menschen hier nur einem kulturellen Skript. Die Psychiaterin Jimmie Holland spricht von einer "Tyrannei des positiven Denkens", in der kein Platz mehr sei für ein Hadern mit dem Schicksal.
"Ich habe so viele Rückschläge meistern müssen, das bekomme ich jetzt auch noch hin."
Monica Lierhaus hat fast alles verloren. Sie war eine blendend aussehende, erfolgreiche Frau im Fernsehen, die viel Geld verdiente, um die Welt reiste, die Größen des Sports traf; und sie hatte eine langjährige Beziehung zu einem Mann, der sie auch nach ihrem Koma unterstützte. Seit Kurzem gehört nun auch er nicht mehr zu ihrem Leben. Lierhaus hat wohl keine finanziellen Sorgen, ihre Familie kümmert sich um sie, und sie kann ihrem Beruf inzwischen wieder nachgehen, wenn auch nicht in der Top-Liga: Und doch empfindet sie dieses Leben, das sie so nicht haben wollte, als schreckliche Belastung. Oft ist sie dabei den Tränen nahe.
Nach ihrem Koma befand sich Lierhaus auf dem Stand eines Kleinkindes. Sie kämpfte sich zurück, voller Disziplin und unter starken Schmerzen. Als die Ärzte ihr sagten, sie werde im Rollstuhl sitzen, dachte sie nur: "Die werden sich noch wundern!" Und ihr Kampf geht weiter. Heute lernt sie vor einem Interview ihre Fragen auswendig, wiederholt schwierige Wörter wieder und wieder, um sie richtig aussprechen zu können. Über das Ende ihrer Beziehung sagt sie: "Ich habe so viele Rückschläge meistern müssen, das bekomme ich jetzt auch noch hin."
Man kann dieser Frau weiß Gott nicht vorwerfen, dass sie sich hängen lässt. Selbst wenn sie sich hängen ließe, könnte man es ihr nicht vorwerfen. Schon gar nicht kann man ihr verbieten zu sagen, was sie offenbar empfindet: dass ihr Leben vor allem aus Verlust besteht und sie, hätte sie noch einmal die Wahl, den Tod vorziehen würde. Dies zu empfinden und auszusprechen ist ihr gutes Recht.
Mit Behinderten tue sich die Gesellschaft "viel Gutes an, weil sie immer eine Bereicherung des Lebens sind", sagte der Theologe Mletzko zum Fall Lierhaus. Und ein Stück weit hat er recht: Behinderte dürfen nicht als Last angesehen werden, Gesunde können viel von ihnen lernen. Aber es sind immer noch die Behinderten, die das eingeschränkte Leben führen müssen. Keiner darf von ihnen fordern, Schmerzen und allergrößte Einschränkungen fröhlich zu erdulden, damit der Rest der Gesellschaft seine Bereicherung hat.