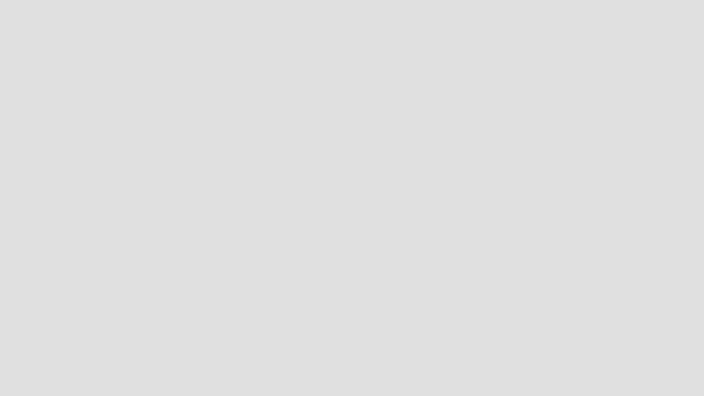Bücher über Popkultur haben bisweilen die nervige Eigenschaft, dass sie ähnlich cool sein wollen wie ihr Gegenstand. Nicht selten sind es dann auch ehemals eingeschworene Fans, die den Werdegang ins Akademische vollziehen - ganz so wie die Popstars, die von ihnen angehimmelt wurden, ins Autobiografische wechseln. Als wäre es nicht, bei Lichte betrachtet, etwas sonderbar, die eigenen Jugenderfahrungen - Comics, Punk, Techno in den frühen Neunzigern - in universitäre Eichenfässer einzulagern, quasi als nächsten logischen Schritt der Coolness: Erst tritt man als größter Fan, dann als kundigster Chronist auf.
Man kann vermuten, dass Christian Huck, Professor für Englische und Amerikanische Kultur- und Medienwissenschaft an der Universität Kiel, sich eine gewisse Faszination für Jeans, Breakdance oder Indianer nicht erst anlesen musste, sondern bereits mitgebracht hat. In seinem Buch "Wie die Popkultur nach Deutschland kam" geht es allerdings weder um seine eigene Person noch um seine Generation. Auch sonstige Zugehörigkeitszuschreibungen, Abgrenzungen und Animositäten sind nicht die eigentliche Triebkraft seiner Studie. Genüsslich, aber dank seiner distanziert-akribischen Haltung keineswegs gehässig, erzählt Huck von der Ankunft des Populären.
Zum Beispiel Breakdance: In Deutschland wurde Breakdance vor allem inspiriert durch Filme, zum Teil der Popkultur, als die ursprünglichen Tänzer aus der New Yorker Bronx längst anderen Interessen nachgingen. Amerikanische Spielfilme wie "Wild Style!" von 1982 gaben sich zwar authentisch, waren es aber vor allem hinsichtlich ihrer Begeisterung für etwas, das leider schon vorbei war.
An der Bar sind sich alle fremd
Was man unter Populärkultur eigentlich zu verstehen hat, wird gleich im ersten Kapitel deutlich: Im Jahre 1902 wird in Hamburg nach amerikanischem Vorbild die erste "Bar" gegründet, die "Hamburg-Amerika Bar" auf der Reeperbahn. Erst zwei Jahre zuvor hatte es das Wort "Bar" überhaupt in den Duden geschafft. An einem neuartigen Möbelstück (dem Tresen) werden dort neumodische Getränke verkauft (Cocktails) und tragen so zu einer ganz neuen Form von Geselligkeit bei.
Die Bar ist eben keine Weinstube und auch kein Herrenclub, in dem man gesellschaftliche Regeln zu kennen und zu beachten hätte. Genauso wenig sollte man sie jedoch mit der Schankwirtschaft verwechseln, die einen mir nichts dir nichts dazu bringt, mit fremden Tischgenossen auf Bruderschaft zu trinken.
An der Bar lässt es sich auf Barhockern nebeneinander allein sein, fremd sind sich hier alle. Kein Wunder, dass sich die Bar vor allem in Hafenstädten und Metropolen größter Popularität zu erfreuen begann. Man kann die Bar als Chiffre für das Populärkulturelle schlechthin begreifen. Sie ist weder ein Produkt der Hochkultur, noch lässt sie sich ohne Weiteres der Massen- oder Volkskultur zuschlagen. "Eine solche inklusive Exklusivität, wie sie nur die Populärkultur bieten kann, ist allerdings ein instabiles Ereignis", schreibt Huck. "Leicht kippt es in eine Subkultur, die sich abschottet, leicht kippt es in eine Massenkultur, die keinen Zusammenhalt mehr erzeugt." Es kennzeichnet sie ein barrierefreier Zugang, der potenziell jedem offensteht, aber - zumindest im historischen Augenblick - nicht von allen genutzt werden will.
Ganz ähnlich war es mit der Begeisterung für Groschenromane wie "Buffalo Bill". Auch diesem Phänomen ging eine Erschließung von bis dato unbekannten Vertriebswegen voraus. Lesestoff ließ sich jetzt nicht mehr nur in alteingesessenen Buchhandlungen erwerben, sondern schnell und einfach am Kiosk mitnehmen, sammeln, tauschen und verleihen. Hilfreiche Erkenntnis: Der Buchhandel und die großen Verlage sind auch vor Zeiten des Internets bereits schwer unter Druck geraten.
Die erste Hose "für die ganze Familie"
Die vielleicht am weitesten verbreitete Ikone der Popkultur aber ist die Jeans, die Hose der Rebellion, der Halbstarken, in der schon einige Kulturwissenschaftler eine kreative Verarbeitung, Umwandlung und Aneignung der amerikanischen Vorbilder erkannt haben. Nüchtern hält Christian Huck dagegen, dass die ersten "Nietenhosen" in Deutschland durch die sogenannten Steg-Geschäfte Verbreitung fanden, in denen Restbestände der Wehrmacht, und später auch der Besatzungsmächte verkauft wurden. Und schon 1954 wurde die Jeans im Otto-Versandkatalog angepriesen - "also noch bevor James Dean und Marlon Brando die Kinos und die 1956 gegründete Bravo eroberten".
Die Jeans, zeigt Huck, war keine Hose nur für Outsider, im Gegenteil, sie war die erste Hose "für die ganze Familie". Und auch das hatte seine - materiellen bzw. materialistischen - Gründe: Sie bestand aus einem Material, das nicht nur sehr widerstandsfähig war - das waren andere Hosenstoffe auch - sondern die eigentümliche Eigenschaft besaß, an ästhetischem Wert zu gewinnen, je abgenutzter sie aussah.
Während es Bars, Jeans und Krimis nach wie vor gibt, ist eines der heiß diskutierten popkulturellen Veranstaltungsformate der Nullerjahre allerdings schon wieder verschwunden, und auch das hat mit Hucks Zentralthese zu tun, dass Pop vor allem eine Frage der Distributionswege ist: Den LAN-Partys ist im wahrsten Sinne des Wortes die materielle Grundlage weggebrochen.
Ist die Populärkultur ein reines Phänomen?
Seit Mitte der Neunzigerjahre stellten Jugendliche ihre Computer in Hobbykellern und Turnhallen auf und verkabelten sie, um gegeneinander in PC-Spielen anzutreten (zu zocken halt!). Seit das Internet schnell und günstig genug ist, um online miteinander zu spielen, hat sich die räumliche Unterbringung unter einem Dach erübrigt, und mit ihr eben auch alles, was mit diesen eltern- und aufsichtsfreien Zusammenkünften einherging.
Die Popkultur kam auf ganz unterschiedlichen Pfaden nach Deutschland - aber aus Amerika, so viel steht für den Amerikanisten Huck fest, kam sie ganz gewiss. Über K-Pop, Mangas, Bollywood oder Döner müsste ein anderes Buch geschrieben werden. Aber hätte in das Buch die anglofone Popkultur aus Großbritannien (mit den Beatles und sämtlichen Musikrichtungen, die nach ihnen kamen) nicht noch hineingepasst? Und wie verhält sich die Popkultur, wenn wir schon über die USA im Jahrhundert ihres Imperiums sprechen, eigentlich zu dem, was in der Geopolitik "Softpower" genannt wird?
Der französische Soziologe und Philosoph Jacques Ellul hat bereits Mitte des vorigen Jahrhunderts auf den möglichen propagandistischen Gebrauch der Populärkultur hingewiesen. Auch China verfolgt heute erklärtermaßen das Interesse, nicht zuletzt auch in diesem Bereich zur Supermacht aufzusteigen, die es in ökonomischer Hinsicht längst ist. Und das ließe sich auch untersuchen, ohne dass man sich unverzüglich eines Antiamerikanismus verdächtig machte. Aber für Huck ist Populärkultur reines Phänomen: das, was erklärt werden muss. Und nur erklärt werden kann, wenn man von der Kultur einmal absieht und sich Vertriebswegen und Materialeigenschaften zuwendet.