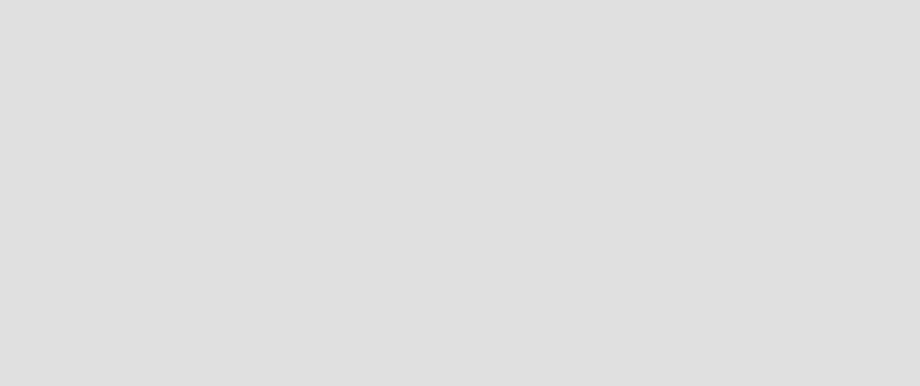Zugegeben: Es sind Banalitäten. Das Geräusch, das bei der Benutzung eines Instruments entsteht, die Verwendung bestimmter Begriffe oder der Einsatz einzigartiger Zeichen und Symbole. Kleinigkeiten, aus denen in Summe und mit der Zeit Gewohnheiten werden, die irgendwann vielleicht Traditionen begründen und schließlich als Brauchtum gepflegt, geschützt und gefördert werden. So prägen sich Identitäten, so gewinnt man Orientierung, so entsteht Heimat. Dass diese Banalitäten sich dem Zugereisten erst nicht erschließen, schmälert ihren Wert dabei keineswegs. Im Gegenteil: Die Einheimischen fühlen sich dadurch in ihrer Verbundenheit noch gestärkt.
Man muss die 2001 von dem New Yorker Autor und Lehrer Marc Prensky eingeführte Unterscheidung zwischen Einheimischen (Digitales Natives) und Zugereisten (Digital Immigrants) gar nicht bemühen, um festzustellen: Auch das Internet ist in dieser Weise zu einem heimatstiftenden Ort geworden. Dem weltweiten Netz mag die regionale Bindung an einen physischen Raum fehlen, die brauchtumsbildenden Banalitäten besitzt aber auch das Internet - wenn auch in ganz neuer, weltoffener Form: Es gibt einzigartige Zeichen und Symbole, beispielsweise @ und Emojis, außerdem eine besondere Verwendung bestimmter Begriffe, also einen digitalen Dialekt. Und bei manchen Menschen erzeugt das Einwahlgeräusch eines 56k-Modems heimatliche Gefühle.
"Heimat ist da, wo sich das Wlan automatisch verbindet", sagen Menschen, die mit der Idee der weltweiten Vernetzung aufgewachsen sind - und sie meinen damit in Wahrheit nicht das Haus, in dem drahtloses Internet verfügbar ist (und sich automatisch mit ihrem Endgerät verbindet, weil sie schon mal dort waren). Sie meinen den ortlosen Ort, der sich durch diese Verbindung eröffnet: Sie meinen das Internet selber - die Realität gewordene Idee eines Völker verbindenden Netzwerks, das Landes-, Sprach- und Religionsgrenzen überwindet, und einen Austausch zwischen Menschen ermöglicht, die nicht am gleichen Ort sein müssen. Sie meinen: Das Internet als Heimat.
Jeder Mensch hat eine Heimat. Oder nicht? Oder auch zwei? Eine Artikelreihe untersucht die Ver- und Entwurzelung in bewegten Zeiten. Alle Texte lesen.
Damit sind nicht in erster Linie die Anwendungen gemeint, die man im Internet nutzen kann, oder die Games, die man über die Internet-Infrastruktur spielen kann: Das Internet als Heimat zu verstehen, bedeutet mehr als einen virtuellen Garten zu pflegen oder in digitalen Welten virtuelle Werte zu handeln. Es geht um die Infrastruktur, die all dem zugrunde liegt, was Millionen Menschen überall auf der Welt selbstverständlich nutzen. Dass völlig unterschiedliche Systeme, auf sehr alten und brandneuen Computern in diesem durch und durch heterogenen Netzwerk der Netze miteinander kommunizieren können (ermöglicht durch das zugrundliegende Internetprotokoll TCP/IP), ist eine bedeutsame, wenn man so will, multikulturelle Erfindung.
Man muss den Nationalisten den "Heimat"-Begriff entreißen, ihn umdeuten, also: hacken
In diesem digitalen Blick begründet sich eine neue Sicht auf die Welt - und auch auf das Konzept von Heimat. Der Soziologie Andreas Reckwitz spricht von der sogenannten Hyperkultur, die eine "kosmopolitische und zugleich marktförmige und individualistische Modellierung von Kultur" zur Grundlage hat. Er stellt ihr eine Haltung gegenüber, die klassischerweise den Begriff von Heimat für sich in Anspruch genommen hat. Diese zeichnet sich für Reckwitz durch "eine Modellierung von Kultur als historischer Gemeinschaft" aus. "Sie kommt in verschiedenen Spielarten von der Identitätsgemeinschaft über den Fundamentalismus bis zum Nationalismus vor", und wird von Reckwitz als Kulturessentialismus beschrieben.
Beide stehen sich derzeit in zahlreichen Debatten konfrontativ gegenüber; auch und gerade im Web. Die hier skizzierte Heimatperspektive aufs Netz ist nicht naiv. Sie bemerkt, dass einige durchaus beunruhigende Kulturessentialisten - vom amerikanischen Präsidenten Donald Trump bis zur AfD - die digitalen Instrumente so intensiv einsetzen, dass sie dadurch auch den Diskurs über die Idee vom Internet verändern. Doch ist dessen bloße Existenz der Beweis dafür, dass Nationalismus und Ausgrenzung zwar in der Realität keineswegs abgenommen haben, aber ihre Ideen aus einer vordigitalen Zeit stammen.
Die Debatte über Hate Speech und Fake News ist notwendig und wichtig. Aber das Internet einzig auf seine negativen Aspekte zu beschränken, hieße, seinen menschheitshistorischen Wert zu unterschätzen. Denn dass es das Internet überhaupt gibt, zeigt, dass Diversität und Unreinheit (beides Aspekte, die der Kulturessentialismus gerne bekämpfen möchte) funktionieren. Es zeigt, dass die Idee von Völkerverständigung, Offenheit und Pluralismus keine Spinnerei ist, sondern greifbare Wirklichkeit. Es lohnt sich, dieser Idee zu folgen, gerade auch, um gestaltend auf die dunklen Seiten zu reagieren, die durch das Netz zuweilen befördert werden.
Das weltweite Dorf kann ebenso Heimat sein wie ein ländliches Dorf
Dass man sich mit einer solchen Perspektive in der aktuellen Debatte fast der Albernheit verdächtig macht, zeigt, wie weit der Kulturessentialismus den Diskurs um das Medium der Verbindung schon beeinflusst.
Deshalb ist es keineswegs eine Banalität zu betonen, dass das Internet die Heimat einer Generation ist, die völlig selbstverständlich mit der Idee von Völkerverständigung und Verbindung aufwächst. Auf diese Weise aufs Internet und auf die dort entstandene Heimat zu schauen, eröffnet einen völlig neuen Blick auf die Debatte um eine vermeintlich so bedrohte Identität. Es macht den Kulturessentialisten die Deutungshoheit über die Begriffe Heimat und Identität streitig und dokumentiert eine Wertschätzung für die Ideen des freien Wissens, des Pluralismus und der Meinungsfreiheit.
Wäre die Praxis des Verlinkens oder des Mail-Schreibens nicht ebenso förderungs- und erhaltenswert wie die Morsetelegrafie?
Die Angehörigen von Andreas Reckwitz' Hyperkultur sollten nicht länger leugnen, welche Bedeutung Heimat hat. Sie sollten sie, im Gegenteil, betonen und dabei umdeuten, wenn man so will: hacken. Das weltweite Dorf kann ebenso Heimat sein wie ein ländliches Dorf - gerade weil dies auf lange Sicht die Idee einer ausschließlich regional begründeten Heimat ad absurdum führt. Heimat ist im 21. Jahrhundert vielmehr ein Ort, an dem Menschen sich unabhängig von Religion, Sprache oder Nationalität verbinden können.
Dadurch verändert sich nicht nur die Debatte um Heimat und Identität. Konsequent verfolgt, lassen sich aus einer solchen Perspektive noch ganz andere Forderungen ableiten an Schulbuchkommissionen, Rundfunkräte oder sogar an ein möglicherweise zu gründendes Bundesheimatministerium. Alle diese Einrichtungen müssten künftig auch für jene eintreten, die im Netz zu Hause sind. So nimmt die Hyperkultur Einfluss auf die Agenten des Bewahrens und Konservierens.
Denn auch im Web sind in den vergangenen Jahren kulturelle Praktiken entstanden, die ebenso bedeutsam, verbindend und erhaltenswert sind wie beispielsweise die traditionelle Flussfischerei an der Mündung der Sieg in den Rhein, die sächsischen Knabenchöre oder der hessische Kratzputz. Diese drei Beispiele stammen aus dem Verzeichnis "Immaterielles Kulturerbe der Unesco" - ein 134-seitiges Werk, in dem "überlieferte kulturelle Ausdrucksformen" gesammelt werden, "die in Deutschland praktiziert werden".
Diese sind allesamt bedeutsam und sollen durch den Kontrast mit der digitalen Welt keinesfalls lächerlich gemacht werden, im Gegenteil. Es geht um die Frage, ob die Möglichkeiten des Verlinkens im Web oder die Praxis des Mail-Schreibens nicht ebenso förderungs- und erhaltenswert sind wie die Morsetelegrafie (S. 83). Ist das Prinzip der Netzneutralität nicht in gleicher Weise identitäts- und heimatstiftend wie es Märchenerzählen (S. 77), Schach- (S. 110) oder Skatspielen (S. 115) sein können? Und sollte eine gegenwärtige Gesellschaft nicht das Chatten oder die Meme-Kultur des Netzes in gleicher Weise fördern und wertschätzen wie beispielsweise das Mundart-Theater im regionalen Raum (S. 102)?
Diese Diskussionen an die Orte zu tragen, in denen es um die Pflege von Brauchtum geht, wäre ein notwendiger Schritt, um den Blick auf die Heimat, aber auch auf das Internet zu verändern. Denn die amerikanischen Angriffe auf die Idee der Netzneutralität, die Enthüllungen von Whistleblowern wie Edward Snowden und die monopolartige Übermacht der GAFAM genannten großen Fünf der Internetbranche (Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft) zeigen, dass das Internet nichts ist, was einfach immer da ist, sondern eine Erfindung, für deren Erhalt es sich zu kämpfen lohnt. Es wäre die wohl modernste Art des Heimatschutzes.