Obacht, ganz tückisches Terrain. Man ist hier gleich mittendrin im Arbeiterviertel des Pop, das da heißt "Authentizität". Rauer Flecken Erde. Die Menschen schwitzen in diesem Winkel des Genres noch die Flanellhemden und Polyesterblusen durch beim Versuch, die Mühen ihrer Arbeit auszustellen, auch wenn es sich bei dieser Arbeit um Kunst handelt. Die Hände so schwielig wie die Seelen. Die Straßen so staubig wie die Kehlen.
Bruce Springsteen gibt den Gewerkschaftsboss in dieser Welt. Bob Dylan ist eine Art Hohepriester, Neil Young der schrullige Dorfschamane. Allenthalben fallen die Wörter "Johnny" und "Cash", und dann nicken alle verständig in ihren Rye Whisky. Grobkörnige Videofilme, Jukeboxen und Tonaufnahmen auf großen, sperrigen Bandmaschinen gehören hier zu den Insignien des Echten, des Wahrhaftigen - das so oft und dann oft auch etwas unklar das Ursprüngliche zu sein hat. Sepiatöne sind auch ganz wichtig.
"Jeder kennt hier jeden. Das hier ist ein guter Ort zum Leben und Kinderaufziehen."
Wie gesagt: tückisch. Denn natürlich kann die Authentizität - für den Moment nicht komplett erschöpfend verstanden als möglichst weitgehende Deckungsgleichheit von Künstler und Werk - eine ganz enorme, eine, wie man passend wohl sagen würde, markerschütternde Kraft entwickeln. Siehe die Genannten. Aber Authentizität ist eben auch eine Pose.
Alles ist im Pop eine Pose, klar. Aber dieser geht man besonders leicht auf den Leim. Authentizität wird doch so schnell mit Tiefgang verwechselt. Dabei kann einer doch auch absolut authentisch ein ganz famoser Dünnbrettbohrer sein.
Das soll nun nicht heißen, dass The Killers Dünnbretterbohrer sind. Aber das erste Geräusch auf ihrem neuen Album ist nun mal das "Katschank" eines klobigen, mechanischen Tonbandgeräts. Dann hört man eine Frau. Im Hintergrund rauscht der Verkehr vorbei und die Stimme hebt mit einem sympathisch verdrucksten "Alright" an: "Ich bin jetzt 26, lebe also seit 26 Jahren hier." Verheiratet mit dem "Highschool-Sweetheart". Sie reise nicht wirklich, sei also eigentlich immer hier, sagt sie noch. Dann wird das Band vorgespult. Ein Mann bellt irgendwem mit bärtiger Stimme zu, er sei gerade beschäftigt. Dann erzählt er von seinem kleinen Bruder. Wieder Spulgeräusche. Wieder eine Frau: "Jeder kennt hier jeden. Das hier ist ein guter Ort zum Leben und Kinderaufziehen." Dann tupft ein düster-stumpfes Klavier los. Mandolinen zirpen. Streicher jammern ein bisschen. Verdammt gute Idee, das alles.
Autowracks am Straßenrand, Hunde streunen herum, von vielen Hauswänden hängt die Farbe in großen Fetzen herunter
Hier, das ist Nephi, Utah. Ungefähr 6300 Einwohner laut dem jüngsten Zensus aus dem Jahr 2019 - immerhin 18,4 Prozent mehr als vor zehn Jahren. Das Ortsschild, so zeigen es zumindest Bilder im Internet, ist in eine kleine Backsteinmauer eingefasst, brusthoch und nach oben sanft gewölbt. In den vier Youtube-Trailern, die das Album ankündigten, sieht man einen Ort, in dem immer wieder Autowracks am Straßenrand stehen, rostgescheckt und furchtbar einsam zurückgelassen. Aber auch, als würden sie mit ihren treuherzigen Scheinwerfern noch immer Ausschau halten und damit rechnen, dass ihre Eigentümer sie bald wieder abholen kommen. Hunde streunen herum. Von vielen Hauswänden hängt die Farbe in großen Fetzen herunter. Viel Pose.
Die Straßen sind allerdings auffallend staubfrei. Immerhin.
Brandon Flowers ist in diesem Hier aufgewachsen. Der Sänger der Killers. Da hätten wir die Deckungsgleichheit von Künstler und Werk. "Pressure Machine" (Universal) ist eine Art Biographie-Album. Nicht nur Flowers eigene Geschichte, sondern noch mehr wohl die von Menschen, die er von früher kennt. Die, die in den kurzen Sequenzen vor und zwischen den Songs ins Aufnahmegerät sprechen. Oder ihnen zumindest nachempfunden sind - ganz klar wird das nicht.
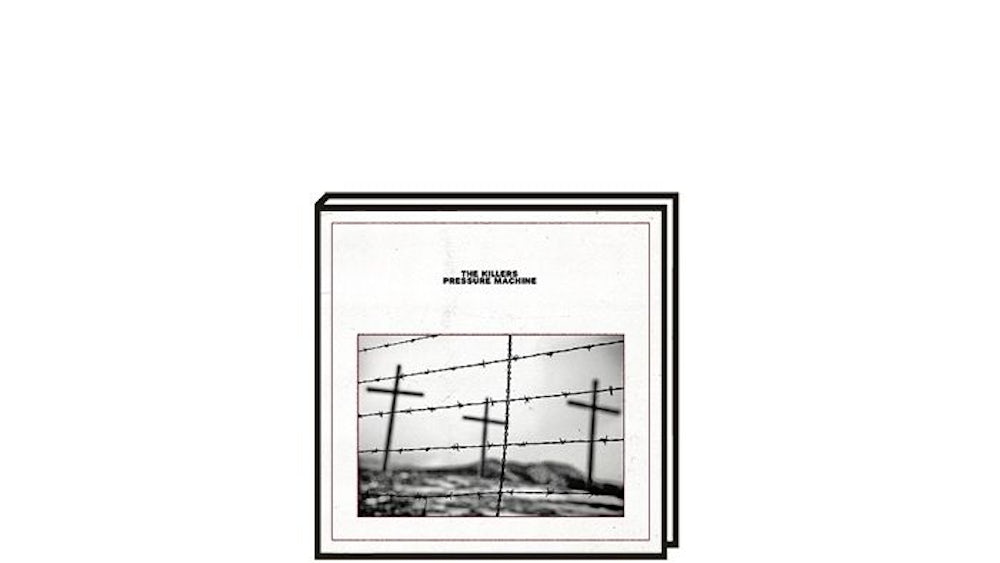
Da ist der Typ - "born right here in Zion, God's own son" -, der einst über die Felder und durch die Hecken tobte, während die anderen in der Kirche saßen. Da ist der Polizist, der eine Frau im Auto anhält, weil sie 60 gefahren ist, wo nur 30 erlaubt waren. Sie hat getrocknetes Blut an der Schulter. Aber den Ehemann, der sie so offensichtlich verdrischt, will sie nicht anzeigen. Und da ist der Mann, der morgens um drei Uhr aus dem Bett schleicht, "quiet as a mouse", sich die Haare kämmt, einen Schwall Wasser ins Gesicht wirft und zur Arbeit aufbricht.
So ist das, in dieser ruhigen Stadt, "this quiet town, salt of the land / Hard-working people, if you're in trouble, they'll lend you a hand". Die hart arbeitenden Menschen helfen einander eben noch. Oder?
Nun, wie man es nimmt. Der Polizist, verheiratet, Vater einer Tochter, beginnt in der zweiten Strophe ("Desperate Things" heißt der Song übrigens) eine Affäre mit der Raserin. In der dritten sitzt der Frauenschläger dann in Handschellen auf dem Rücksitz. Unklar, ob es von dort aufs Revier geht - oder woanders hin. "You forget how dark the canyon gets / It's a real uneasy feeling." Im Canyon wird es nun mal sehr dunkel. Und die gruseligen Gitarren, die den ganzen Song über schon stahlkalt und endlos verhallt wie eisige Gewitterwolken herumhängen, entladen sich in einem kurzen, großen Gewaltakt. Fratzenhaft, scheußlich, sehr großartig. Der Cop mag eben keine Männer, die aus den falschen Gründen zuschlagen.
Und der Mann, der sich morgens, leise wie eine Maus, aus dem Haus schleicht ("The Getting By"), fragt sich immer öfter, wofür zum Teufel er das tut. Klar: Wohlstand. Andererseits: Welcher verdammte Wohlstand denn eigentlich? "My people were told they'd prosper in this land / Still, I know some who've never seen the ocean, or set one foot on a velvet bed of sand."
Las Vegas? Eine Stadt "wie das Lächeln von Tom Cruise"
Nicht völlig verwunderlich also, dass auch god's own son im Song "West Hills" immer mehr dem "hillbilly heroin" verfällt. Den elenden Pillen, gekommen als Schmerzmittel, oft auf Rezept, geblieben als billiges Fentanyl, meistens aus China. Kaum sicher zu dosieren. Knapp 45 000 Menschen hat das Gift allein im Jahr 2020 in den USA umgebracht. Eine Epidemie, geboren aus Enge, Frust und Sprachlosigkeit: "When we first heard opioid-stories / they were always in whispering tones."
Nicht völlig verwunderlich also auch, dass Flowers als Jugendlicher ins schillernde Gegenteil flüchtete, um dort seine überlebensgrelle Stadionband zu gründen: Las Vegas, wo die Luft in den Casinos immer frisch und nie echt ist, die Oberflächen schrill und bunt und blinkend - und erst tief drinnen in den Eingeweiden das Grauen lauert. Eine Stadt "wie das Lächeln von Tom Cruise", wie er das mal gesagt hat, der verteufelt gute Storyteller.
Diesmal hatte er alle Texte fertig, bevor auch nur ein Ton Musik geschrieben war. Das merkt man. Sie sind seltsam störrisch, sperren sich gegen die Musik, die für "Killers"-Verhältnisse fast scheu ist, geduckt, ganz Dienst an der Geschichte. "Alle zwei bis drei Jahre tötet der Zug jemanden", erzählt ein Mann dem Tonband. Und dann: "Ich glaube, der Zug ist ein Weg aus diesem Leben. Wenn er dich erfasst."

