Svenja Flaßpöhler hat ein Spielchen für ihre Leser vorbereitet, einen klassischen Psychotest. Er besteht aus drei Situationen, die erste geht so: "Sie sitzen im Theater, es wird Shakespeares 'Othello' gespielt, auf der Bühne wird das 'M-Wort' ausgesprochen." Die Reaktionsmöglichkeiten: "A) Es fällt Ihnen gar nicht weiter auf." Oder "B) Sie sind geschockt und verlassen den Saal."
Das wären zwei mögliche Verhaltensweisen. Mindestens eine weitere, naheliegende Option fehlt aber - nicht nur bei diesem bipolaren Spiel in "Sensibel": C) Es fällt Ihnen auf, aber Sie sind nicht geschockt. Auch denkbar: D) Es stört Sie und Sie besprechen die Sache später mit Ihrer Begleitung. Oder E) Sie erinnern sich an Situationen, in denen Sie selbst mit M- oder N-Wort überzogen wurden, und wissen nicht, wie Sie sich jetzt verhalten sollen. Oder auch F) Sie wollten nur mal eben auf Toilette gehen und nun denken alle, es wäre eine Protestaktion gewesen, als Sie den Saal verlassen haben.
Wächst eine Generation wehleidiger Schneeflöckchen heran?
Gesellschaft und Selbst werden immer sensibler, so die Grundannahme Flaßpöhlers. Es geht es um die Grenzen des Zumutbaren, die, den Eindruck kann man bei den vielen Triggerwarnungen im Internet ja schon bekommen, irgendwie enger zu werden scheinen. Dass gerade Generationen wehleidiger Schneeflöckchen heranwachsen, die sich überall und ständig von Verletzungen bedroht fühlen und fordern, dass sich zu ihrem Schutz alle anderen anzupassen haben, ist seit mindestens zehn Jahren eine beliebte Erzählung über junge Leute. Ein bisschen Kulturpessimismus geht immer.
Ganz so leicht macht es sich die Chefredakteurin des Philosophie Magazins zwar nicht, geht es ihr doch darum, die angeblich verhärteten Fronten zwischen Empfindlichen und Unempfindlichen aufzulösen. Als Gegenstück zur Sensibilität wählt sie die Resilienz, also die seelische Widerstandskraft. Berührungspunkte zwischen den beiden Konzepten möchte sie herausarbeiten, "denn wenn es gelänge, die Resilienz mit der Kraft der Empfindsamkeit in ein Bündnis zu bringen, wäre der Konflikt, der gegenwärtig die Gesellschaft spaltet, in etwas Drittem aufgehoben".
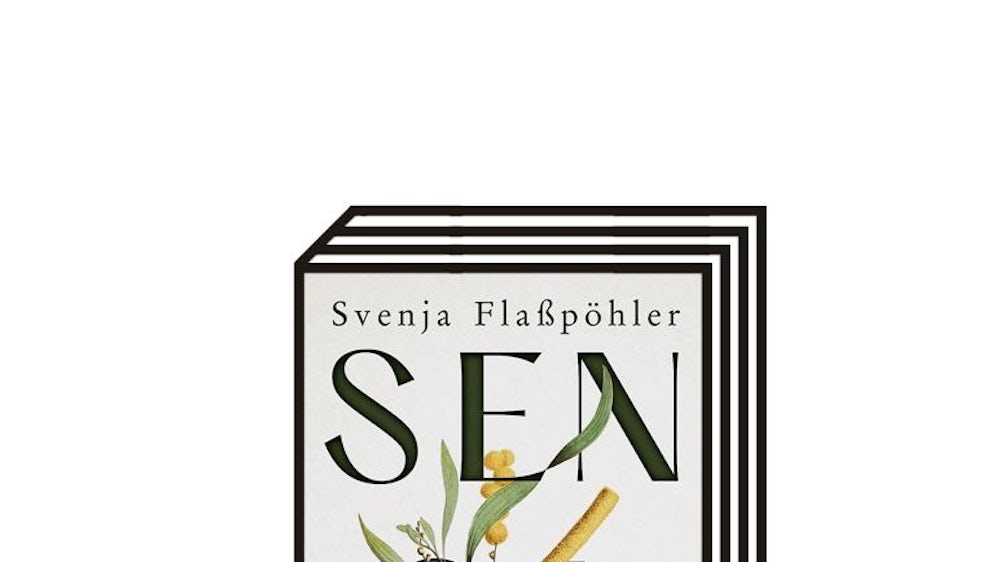
Fraglich nur, ob man das erst erreichen muss oder dieses Bündnis nicht schon existiert. Denn die Prämisse des Buchs, dass sich Sensible und Resiliente heutzutage oder sogar prinzipiell unversöhnlich gegenüberstünden, will selbst nach vielen interessanten Betrachtungen des Sensibilitäts-Verständnisses von Rousseau, Foucault und Freud, auch von der Sprachsensibilität nach Ferdinand de Saussure bis Judith Butler nicht einleuchten.
Flaßpöhler löst also Widersprüche auf, wo keine sein müssten. Um nur auf der individuellen Ebene zu bleiben: Warum sollte jemand Sensibles - ob eher empfänglich veranlagt oder weinerlich - nicht auch Widerstandskraft beweisen? Dass Verletzlichkeit eine Stärke sein kann, erklärt inzwischen sogar Heidi Klum ihren Mädchen bei "Germany's Next Topmodel".
Dennoch meint Flaßpöhler das Trend-Thema der Resilienz verteidigen zu müssen. Gleichzeitig stellt sie klar, dass hier genauso wie im Fall der Sensibilität zu viel des Guten zu viel ist. Zur Veranschaulichung entwirft sie fiktive Figuren, Johan, einen nonnenschändenden Ritter des 11. Jahrhunderts und dessen mimosenhaften Widerpart Jan aus dem 21. Jahrhundert, der für die Tiere vegetarisch isst und für die Frauen gendert.
Das Mittelaltermonster und die Großstadtheulsuse: Strohmänner ersetzen Studien
Immer wieder erkennt Flaßpöhler dann, dass bestimmte Dinge "zwei Seiten einer Medaille" sind und ein Mittelweg zwischen Extremen gut wäre, dass Sensibilität wie Resilienz in bestimmten Kontexten hilfreich sein können und in anderen hinderlich. Dass seelische Verpanzerung etwa Kriegszeugen beim Überleben hilft, ist genauso nachvollziehbar wie die Tatsache, dass man es mit Forderungen nach "Safe Spaces" auch übertreiben kann. Flaßpöhler erläutert das aber nicht etwa anhand von Studien, die reihenweise zur Verfügung stünden, sondern intuitiv - und leider auch mit Strohmännern wie dem herzlosen Mittelaltermonster und der modernen Großstadtheulsuse.
Die richtige Intuition, die Flaßpöhler auf die Sensibilität als ein Thema unserer Zeit gebracht hat, zeigt sich erst in späteren Teilen des Buchs. Denn zum Beispiel die Entgrenzung des Trauma-Begriffs, die Frage, ob man sich bei Forderungen nach Sprachtabus auf die Genderforscherin Judith Butler berufen kann, die Überlegung, wo Grenzüberschreitungen beim Sex anfangen - sie alle sind relevant. Dafür in verschiedene Denkschulen zu sehen und anhand von Theorien zu ordnen, ist gleichfalls hilfreich.
Nur - auch wenn sie sich explizit bemüht, es nicht zu tun - holt Flaßpöhler immer wieder zu völlig überzogener Gegenwartskritik aus: Etwa schauten "weite Teile der Bevölkerung, anstatt ihre Umwelt auch nur aus den Augenwinkeln wahrzunehmen, starr und stur auf ihr Smartphone". Sätze, die zum Staubwischen animieren.
Zu Beginn behauptet Flaßpöhler noch, kein polemisches Buch geschrieben zu haben. Gerade ihre Dosis an Polemik ist es jedoch, die vielleicht auch Überzeugungsarbeit leistet, den einen oder anderen ignoranten Polemiker abholt und ihn zur goldenen Mitte führt. Denn dass heute allerorts nicht mehr Argumente, sondern Empfindung über Recht und Unrecht entschieden (und das auch noch von Menschen, die auf ihr Smartphone starren!), beweinen ja nicht nur alte weiße Männer.
Der Ansatz, zwischen Sensiblen und Resilienten zu vermitteln, bleibt aber unsinnig, weil unnötig. In einer Welt, in der mehr Menschen denn je ihre Wirkmacht erkennen, das Wort ergreifen, ihr Verhalten in Therapien bereitwillig ändern wollen und Unrecht anklagen, muss man nicht pauschal allen erklären, dass sie die Dinge übrigens auch selbst in die Hand nehmen können.
Vielleicht ist dies ein grundsätzliches Missverständnis, das schon Flaßpöhlers Kritik an "Me Too" erahnen ließ: Frauen hätten sich in der Debatte in die Opferrolle ergeben, argumentierte ihre Streitschrift "Die potente Frau" von 2018. Ausgerechnet Frauen, die aktiv gegen widerfahrenes Unrecht vorgingen, sollen die eigene Autonomie vergessen haben? Und solche, die sich aus guten Gründen dagegen entschieden, an die Öffentlichkeit zu treten, sind dann keine Opfer? Oder die besseren Opfer? Die einen sensibel, die anderen resilient? Manche Gegensätze konstruiert man besser nicht. Auch nicht, um sie selbst wieder aufzulösen.
