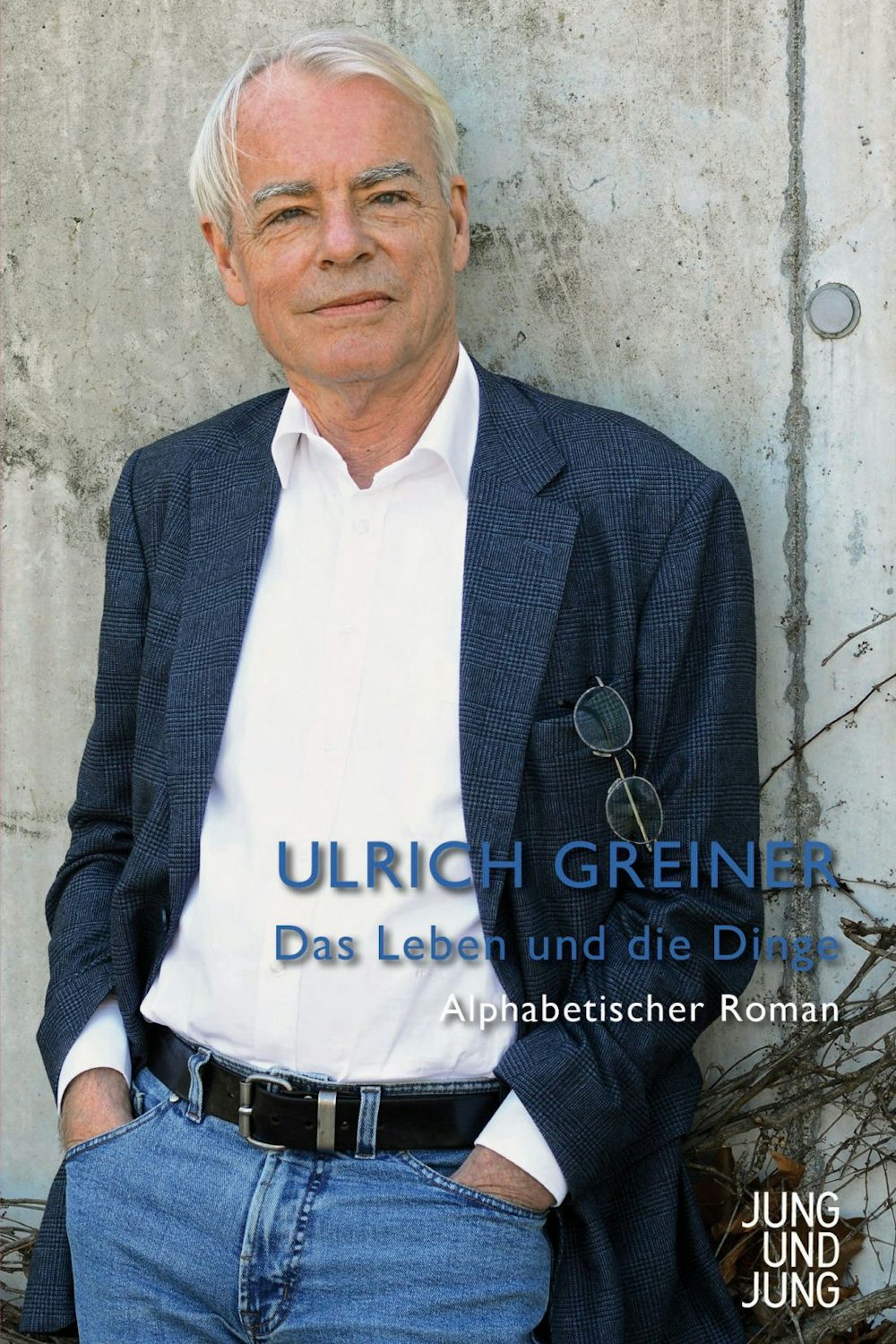Wer über die Endlichkeit des Lebens nachdenkt, sollte nicht Jahre zählen, sondern Dinge. Wie viele Bücher kann man noch lesen? Wird man sich überhaupt noch einmal ein Bett kaufen oder ein Auto? Kann es sein, dass man mit der gerade laufenden Musikanlage bis zum Ende durchkommt? Wer sich solche Fragen stellt, hat eine bestimmte Schwelle schon überschritten. Das ist der melancholische Untergrund eines schönen, leichtfüßigen und nachdenklichen Erinnerungsbandes von Ulrich Greiner, der am 19. September seinen 70. Geburtstag feierte.
Greiner war von 1986 bis 1995 Feuilletonchef der Zeit, in einem politisch-literarisch aufgewühlten Jahrzehnt, das vom Historikerstreit über die Wiedervereinigung mit dem deutsch-deutschen Literaturstreit um Christa Wolf bis zu den Jugoslawienkriegen reichte. Er hat es glänzend gemacht, die Zeit war ein führender Mitspieler im Meinungskampf des Debattenfeuilletons, ohne an ihrer ästhetischen Kernkompetenz Abstriche zu machen. Danach und bis heute wirkte Greiner als Literaturkritiker - ein gründlicher, bedachter Leser, dessen Urteil eine Art Goldstandard darstellt. Dass ein so erfahrener Autor auch mit ästhetischen und kulturkritischen Grundlagenbüchern hervortrat, erscheint fast selbstverständlich; ihre Qualität ist es nicht.
Nun also ein Band mit Erinnerungen, die Greiner zu einem "alphabetischen Roman" der Dinge seines Lebens angeordnet hat, als handgreifliche Inventur. Er reicht von "Agfa Clack" bis "Zimmer". Das erste Stichwort handelt von den Bildern, die das Leben des Siebzigjährigen erst sparsam begleiteten, die er bald selber machte, um dann vor einer Flut zu kapitulieren, die uns alle überschwemmt, seit Telefone auch Fotoapparate sind (solche übrigens, die den verbleichenden Ton alternder Farbabzüge perfekt simulieren können). "Zimmer" ist ein Existenzial, das sogar erlaubt, über künftige Grabbeigaben nachzudenken. Das Letzte, an das Greiners Lebensbuch erinnert, ist das Altersheimzimmer einer Tante, die ihm einst Stifters Erzählung "Bergkristall" vorgelesen hatte - dass sie Steine sammelte, ist da fast zwingend.
Eine bürgerliche Welt also, unaufdringlich zur Anschauung gebracht und sorgfältig durch die deutschen Nachkriegsjahrzehnte begleitet. Autofahren, Motorradabenteuer, Fliegen, ein ziemlich bewegtes Liebesleben - all das kommt vor, und jeder kann vergleichen. Der Erinnerungsband bietet ebenso viel Alltagsgeschichtsschreibung wie diskrete Innenschau. Wie überhaupt Greiners Form eine perfekte Balance von Diskretion und Offenheit erlaubt, denn sie entbindet den Autor von dem pompösen Anspruch, eine Entwicklungsgeschichte, gar einen Bildungsroman zu schreiben, ohne die naturgemäß-historischen Veränderungen auch der Person zu verschweigen. Diese Veränderungen spiegeln sich in Dingen und Verhältnissen, und das ist großartig zu lesen.
Greiners Sprache kommuniziert unangestrengt mit einer Tradition, die sich mit Namen wie Adalbert Stifter und Peter Handke bezeichnen lässt, ohne sich auf die herrischen Manierismen des von Greiner gleichfalls bewunderten Botho Strauß einzulassen. Ein reineres Deutsch kann man heute kaum lesen, und wer glaubt, die Presse verderbe die Sprache, wird hier eines Besseren belehrt.
Dabei scheut Greiner auch scharfe Worte nicht. Die Einträge zu "Blei", "Büro", "Feuilleton", "Presse" umreißen die Geschichte seines journalistischen Berufs - in der FAZ, wo Greiner begann, durfte er Marcel Reich-Ranicki in die Kunst des Umbruchs im Bleisatz einführen. Das Büro in der Zeit wurde Stätte von Intrigen, deren Akteure mit Namen benannt werden. Die Geringschätzung des Rezensionsfeuilletons mit seiner kritischen Funktion durch allzu flauschige, aufs Populäre bedachte Chefredakteure kommt ebenso zu Sprache wie der von Frank Schirrmacher auf die Spitze getriebene Ehrgeiz, die Gegenstände der Zeitung durch eine Art faustischer Laborzeugung selbst in die Welt zu setzen.
Die schärfste Beobachtung zu Schirrmacher enthält der Eintrag "Hand". Ein paar Mal sei er ihm begegnet, erzählt Greiner, "und wann immer wir uns die Hand zum Gruß reichten, war ich irritiert, beim Nachdenken sogar angewidert von der Schlaffheit seiner kleinen, irgendwie formlosen Hände. Ich wusste, dass er ein Machtmensch von äußerster Härte sein konnte, und habe daraus gelernt, den Händedruck sozusagen umgekehrt zu lesen." Ist das indiskret? Wenn man bedenkt, wie vielen Menschen Schirrmacher die Hand gegeben haben muss, doch wohl nicht.
Ein solches Buch kann man von vorn bis hinten lesen, aber genauso gut in ihm springen und blättern, bis man, von jeder Seite verlockt, alles genossen hat. Auch diese Freiheit gehört zur entschiedenen Höflichkeit des klugen, brillanten Autors Ulrich Greiner.