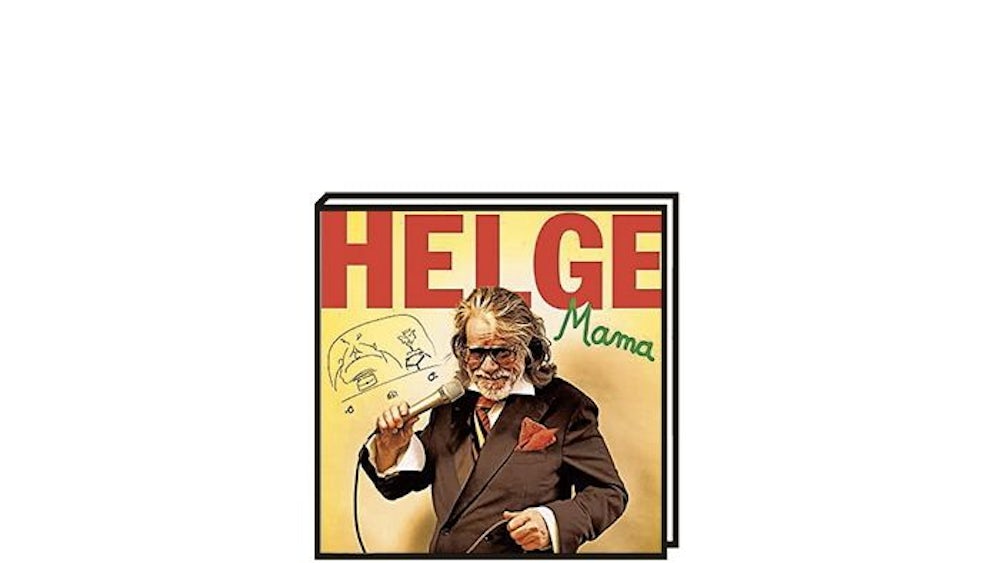
Wie viel Humor verträgt eigentlich so eine Krise? Oder anders: Über wie viel Spaßmacherein kann man eigentlich noch lachen in der Corona-Gegenwart? Einen besseren Testballon für diese Frage als ein neues Helge-Schneider-Album kann es eigentlich nicht geben. Der große Virtuose des deutschen Witzhandwerks liefert auf "Mama" (Roof Music) die Essenz seiner Kunst: eine liebevoll verballerte Verschränkung von gagaesken Humor und Jazz-/Weltmusik. Der 64-Jährige hat die ganze Platte komplett alleine aufgenommen, arrangiert und jedes Instrument von Trompete bis Kontrabass eingespielt: Spur für Spur wird daraus der Schneider'sche Jazz-Klamauk, bei dem sich Mongolei auf Spotify reimt, einsame Herzen bei Ebay reingestellt werden und Roswitha aus der "Schriptease-Bar" ihren großen Auftritt hat. Schöne Blues-Schleicher stehen neben Quarantäne-Schlagern, Space-Funk-Stücke neben Mini-Hörspielen über blutige Friseurbesuche. Dazu kann man mit den Füßen wippen und über die kleinen Blödeleien kichern. Hat in einem Krisensommer noch niemandem geschadet.
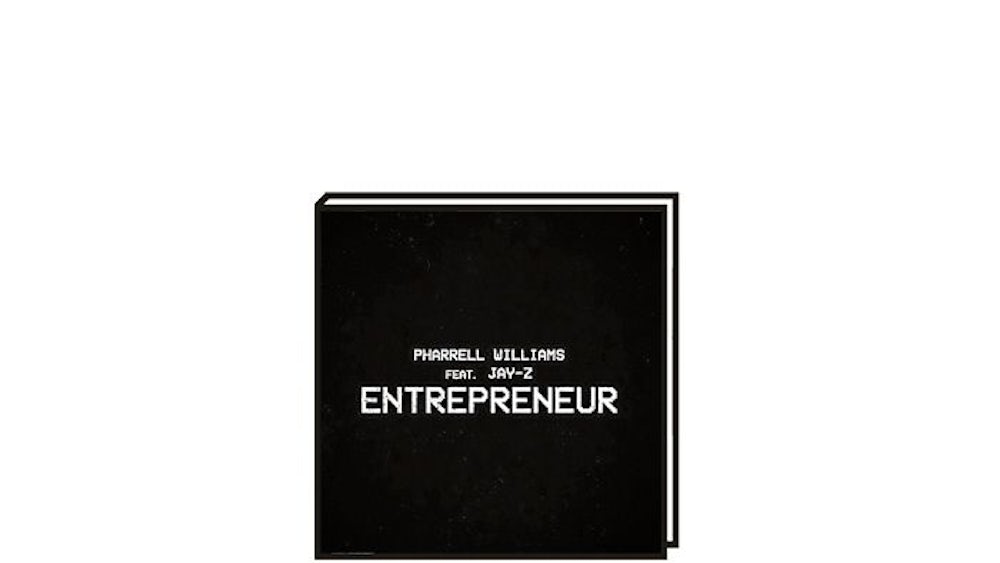
Für jeden in Gucci-Klamotten investierten Dollar, stecke zwei in FUBU, das von Schwarzen geführten Streetwear-Label! Das empfiehlt Jay-Z in seiner Gaststrophe der neuen Single von Pharrell Williams: In "Entrepreneur" (Columbia) erklären die beiden US-Rapper ihre Version der schwarzen Revolution als kleine kapitalistische Fabel vom Geld. Dazu gibt es einen warmen, triumphierend federnden Beat, bellende Sprechchöre und Pharrell, der mit schwüler Falsettstimme im Refrain den schwarzen Unternehmer besingt. Musikalisch ist das so geschmeidig wie trittfest. Und inhaltlich? Die beiden Rap-Superstars haben da natürlich einen Punkt. Sie kennen ihr Land gut genug, um zu wissen, dass nicht über Bürgerrechte sprechen kann, ohne auch darüber zu reden, wer wie viel an was verdient - und wer nicht. Trotzdem wird man gerade bei Jay-Z das Gefühl nicht los, dass seine Business-Ratschläge nur Leuten was bringen, die auf der Business-Leiter schon ein paar Stufen höher sind.

"Whole New Mess" (Jagjaguwar) heißt das neue Album von Angel Olsen. Bis auf zwei Songs besteht es zwar eigentlich nur aus unveröffentlichten Akustikversionen ihres letzten Albums, die klingen aber so anders, so unmittelbar und auf brutale Weise roh, dass die beiden Platten nicht unterschiedlicher sein könnten: Wo die Songwriterin letztes Jahr auf dem Album "All Mirrors" mit üppigen Orchestrierungen überraschte, erzählt "Whole New Mess" in einer intimen Grundstimmung und nur mithilfe von Gesang und schläfrig gezupfter Gitarre vom Gefühlsleben einer Frau, die verlassen wurde: von den armselig durchgeheulten Stunden auf dem Fußboden und der gefakten Tapferkeit, mit der sie erst mal weitermacht. Olsen geht dahin, wo es richtig wehtut, textlich genauso wie stimmlich, was auf zwanghafte Weise fesselnd ist.
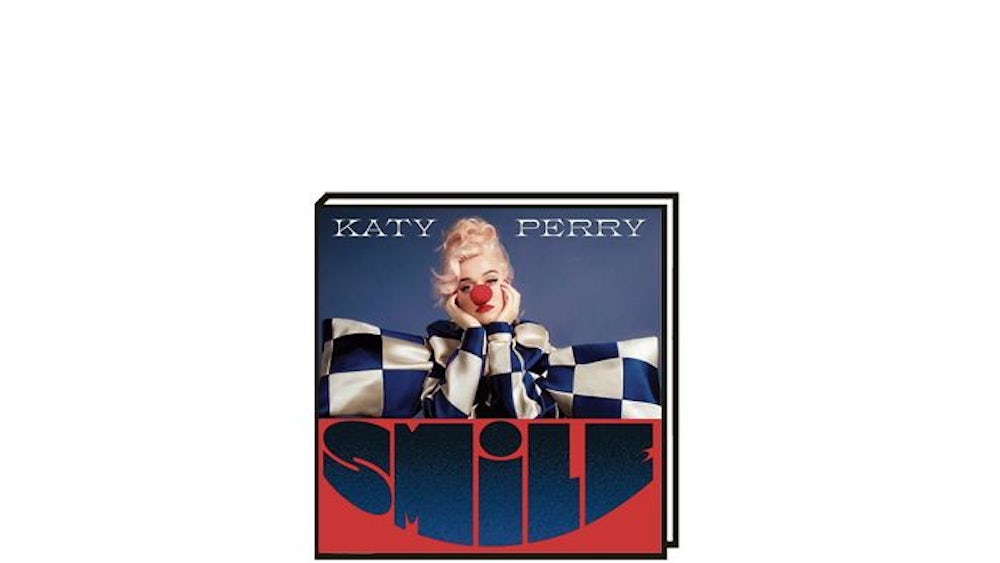
Dass der Zeitgeist ein viel zu glitschige Sache ist, als dass man sich als Popstar ewig an ihm festklammern kann, weiß wohl niemand besser als Katy Perry. Seit 2008 hat mit ihren hyperstilisierten, knallbunten Highscore-Pop-Hits eine dermaßen erfolgreiche Karriere hingelegt, dass es einen nicht wundert, wenn sich die Sängerin auch auf ihrer neuen Platte nicht so recht aus der musikalischen Komfortzone heraus traut. Die Songs auf "Smile" (Capitol) klingen genauso, wie Perry-Songs immer geklungen haben: Stadium-Pop, mal mit hohem Kohlensäuregehalt, mal mit Midtempo-Synthies, aber immer mit Vorschlaghammer-Refrains. Kurzum: bombastisch ja, aufregend nein. Irgendwie wollen sich selbst die neu hinzugekommenen Themen - Unsicherheit, Depression, überhaupt die ganze große Selbstreflexionsrunde - nicht im Sound niederschlagen. Katy Perry bleibt die unverbesserliche Optimistin, das ewige Durchhalte-Häschen und eine der ganz wenigen Popsängerinnen, die im Jahr 2020 mit voller Ernsthaftigkeit eine Zeile wie diese singen können: "I know there's gotta be rain/ If I want the rainbows" - ohne Regen gibt's auch keinen Regenbogen. Für die Supermarktbeschallung taugt das allemal, für den nächsten TikTok-Viral-Hit eher nicht. Und vielleicht ist das in diesen überdrehten Zeiten auch vollkommen okay.