Wenn die moderne deutsche Universität überhaupt Helden hervorbringen kann, trotzige Helden des intellektuellen Widerstands, so war einer von ihnen dieser: Friedrich Kittler, ein Mann mit einem erstaunlichen Gedächtnis, zuletzt Professor für Ästhetik und Geschichte der Medien an der Humboldt-Universität zu Berlin und Gastprofessor an einem halben Dutzend internationaler akademischer Elite-Institutionen, betrieb, als Lehrer und Forscher, die "Austreibung des Geistes aus den Geisteswissenschaften" - so der Titel einer seiner frühesten Publikationen, eines Sammelbands aus dem Jahr 1980.
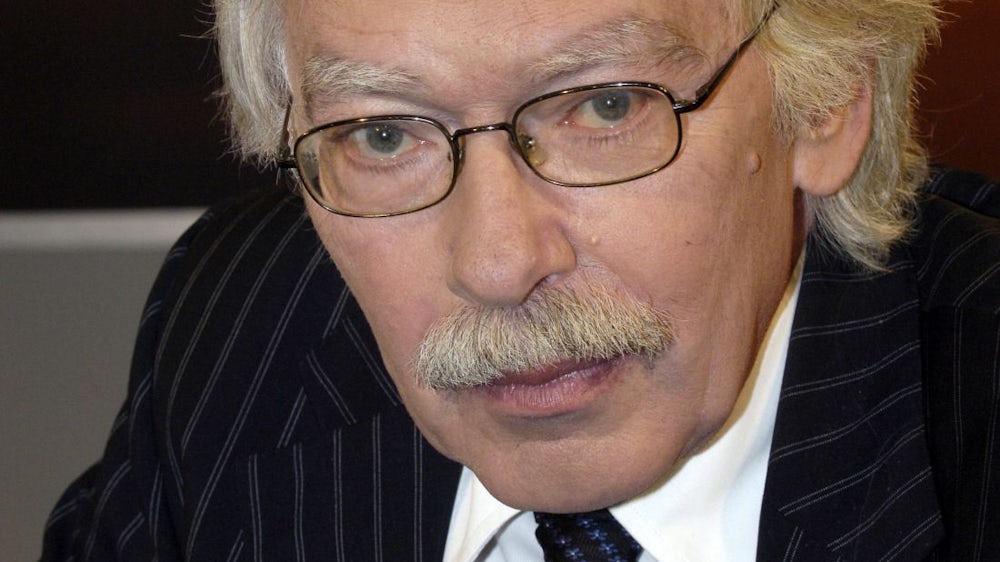
Mit der "Austreibung" gemeint war ein Materialismus der Medien: Nicht um die Erschließung von "Sinn" oder "Bedeutung" solle es in den Geisteswissenschaften gehen, sondern um die Erkenntnis, dass alle Kultur auf Zeichen beruhe. Darum, dass alle Zeichen durch ihre materielle Existenz definiert sind. Und darum, dass sich in allen Zeichen eine Macht geltend macht.
Mit dieser, von Michel Foucaults Theorien der Macht inspirierten, aber ins Technische gewandten Lehre, die alles auf den Kopf stellen wollte, was die Geisteswissenschaften als ihre Aufgabe betrachtet hatten, rannte Friedrich Kittler zunächst gegen eine Wand: Dreizehn Gutachter sollen ihre Köpfe über seine Freiburger Habilitationsschrift gebeugt haben, die in ihrer publizierten Form "Aufschreibesysteme 1800/1900" hieß, zwei Jahre soll das Verfahren gedauert haben.
Doch als das Werk dann erschien, im Jahr 1985, wurde es zu einem der wenigen Bücher, die in den Philologien, in der Philosophie und in den historischen Fächern quer durch die Universitäten gelesen wurden: So faszinierend war die Geschichte, wie sich, beginnend mit der allgemeinen Alphabetisierung im achtzehnten Jahrhundert, die Zeichen nicht nur als Träger aller kulturellen Prozesse durchsetzten, sondern buchstäblich die Macht übernahmen - über die Mechanisierung der Schrift und des Geistes im späten neunzehnten und frühen zwanzigsten Jahrhunderts, etwa in der Psychophysik, bis hin zu "Datensätzen", die nur noch untereinander kommunizierten, in Gestalt von Computern. Was mit dem Glauben an die Befreiung des Menschen durch die Kultur begann, sollte also in der Auslöschung des Menschen durch den universalen Zeichenverkehr enden.
Georg Wilhelm Friedrich Hegel, der Propagandist des "Weltgeistes" und seines unaufhaltsamen Weges zu sich selbst, war der Gegner und einer der wichtigsten Gegenstände dieser Theorie. Doch während Friedrich Kittler meinte, mit seinem medialen Materialismus die Geschichtsphilosophie ein- für allemal aus den Geisteswissenschaften auszutreiben, wiederholte er sie unter umgekehrten Voraussetzungen: von der absoluten Herrschaft des Geistes voran zur absoluten Herrschaft des Materials.
Wenn die Alphabetisierung die welthistorische Durchsetzung eines Datensatz-Prinzips sein soll, der Bildungsroman eine Dressuranstalt und das Lesen eine bürgerliche Droge, dann wird auch dieser Prozess der abendländischen Zivilisation von einer Geschichtsphilosophie beherrscht - denn an seinem Ende steht das von allem Sinn befreite Zeichen. Als umgekehrter Hegel (was er durchaus wusste, und womit er kokettierte) zog Friedrich Kittler in die Universität ein: in dieselbe Universität schließlich, an der auch Hegel gelehrt hatte, nervös, hochfahrend, wenn man ihm widersprach, als ein Professor, die wie ein alter Ordinarius regieren konnte, der Schüler um sich scharte und, was an der zeitgenössischen Universität selten geworden ist, eine Schule schuf. Und als ein Professor, der in seinen Seminaren mit gewaltigen Schimpfreden über Microsoft-Software herfallen konnte.
Im Marbacher Literaturarchiv steht ein primitiver Synthesizer, den Friedrich Kittler in den siebziger Jahren baute, vermutlich weniger aus Begeisterung für die elektronische Musik als vielmehr in einem Akt der Teilhabe am letzten Kapitel der Menschheit, so wie er es sah. Denn "zu sich selbst", wie der alte Hegel gesagt hätte, kam dieser Apparat in einer Theorie, die Friedrich Kittler zu einem Song der englischen Popgruppe "Pink Floyd" formulierte.
Denn diese hatte in den späten sechziger Jahren ein System von Verstärkern, Lautsprechern und Lichteffekten entwickelt, das den räumlichen Abstand zwischen der Musik und den Hörern auslöschte, das Konzert in den Köpfen des Publikums stattfinden ließ und in nicht wenigen von ihnen dauerhafte Verwirrung auslöste. "There's someone in my head but not me", lautet die Zeile aus dem Song "Brain Damage" (1973), die Friedrich Kittler als Bestätigung seiner Medientheorie begriff: "Der Kopf, nicht bloß als metaphorischer Sitz eines sogenannten Denkens, sondern als faktische Nervenschaltstelle, wird eins mit dem, was an Information ankommt." Am Ende aller Schaltungen aber warteten die Raketen aus Thomas Pynchons "Gravity's Rainbow", wartete der totale Krieg. Der Satz, Rockmusik sei "Missbrauch von Heeresgerät", wurde ein Hit. Man konnte für Rockmusik auch vieles andere einsetzen.
Wie Hegels Geschichtsphilosophie universal sein sollte, keine Ausnahmen gelten ließ und jeden Gegenstand erfasste, so trieb Kittler seine Idee in immer neue Wissensgebiete. Wie stirbt Dracula in Bram Stokers Roman - gewiss, durch das Bowiemesser, das ihm Quincey ins Herz stört, aber viel mehr noch durch die Datentechnik, wie sie sich in Mina Harkers Schreibmaschine manifestiert. "Nur was schaltbar ist, ist überhaupt", lautet einer der bekanntesten Merksätze Kittlers, und in seinem Gefolge entstand ein neuer Kanon in den Geisteswissenschaften, gebunden an Mathematiker, Techniker, Kybernetiker wie Alan Turing, Heinz von Foerster, Claude Shannon.
Irgendwann, in den neunziger Jahren, hörte Friedrich Kittler auf, für seine Wissenschaft den Namen "Medientheorie" zu verwenden, und wurde vollends grundsätzlich. Er nahm Martin Heideggers Kategorien der Seinsgeschichte und setzte immer dort, wo bei Heidegger die Etymologie Auskunft über Ursprung und Wesen geben sollte, die Mathematik ein - bis es zumindest so aussah, als müsse "Sein und Zeit" durch die Turingmaschine vollendet werden.
Und schließlich widmete er sich den alten Griechen, den Anfängen nicht nur der Schriftkultur, sondern aller durch Abstraktionen geordneten Artikulation. Die Mathematik und die Musik wurde ihm dabei zu Gegenständen, über die er mit gleicher Heftigkeit spekulierte wie zuvor über die Laute und die Buchstaben. Und so nahe rückten ihm dabei die Hellenen, dass ihm die Übersetzung ihrer Werke ins Latein Ciceros als Katastrophe erschien - bis am Ende die antiken Römer den amerikanischen Imperialisten von heute glichen, während die Deutschen und die Griechen, wie zu Zeiten Friedrich Hölderlins, einander immer näher rückten.
Friedrich Kittler war ein professoraler Spekulant, ein besessener Gedankenspieler, wie es ihn seit dem Ende der großen idealistischen Weltgebäude des frühen neunzehnten Jahrhunderts nicht mehr gegeben hat. Und wenn manches an seinen Werken - etwa die Sprache seiner frühen Schriften, der systematische Versuch, das reflexive "sich" zu vermeiden, um die Technik selbst sprechen zu lassen - schon heute merkwürdig veraltet erscheint, so war er doch auch ein Prophet: Wenn ihm, in den achtziger Jahren, der "Computer" den Plural des Begriffs "Medien" aufzusaugen schien, dann ahnte er in ihm schon das Medium, als das er erst im einundzwanzigsten Jahrhundert zu erkennen ist, das Medium, in dem alle anderen aufgehen werden.
Und noch etwas hat Friedrich Kittler geleistet, womöglich wider Willen: Die Neuordnung der geisteswissenschaftlichen Disziplinen, wie sie sich in den vergangenen zwanzig Jahren in den Kulturwissenschaften, in der Historisierung der Wissenschaften (auch der Naturwissenschaften) sowie in der interdisziplinären Forschung geltend machte, wäre ohne ihn und seinen unermüdlichen Ideengenerator sicherlich anders verlaufen, in Deutschland, aber auch anderswo. Am Dienstag dieser Woche ist Friedrich Kittler, erst achtundsechzig Jahre alt, in Berlin gestorben.