Ein junger Pariser Doktorand der Ethnologie hat Großes vor. Seine karge Unterkunft in einem kleinen bäuerlichen Dorf im Département Deux-Sèvres tauft er kurzerhand "Das wilde Denken". Unter den fünfhundert Seelen von La Pierre-Saint-Christoph fühlt er sich wie ein Argonaut im westlichen Pazifik, und wie der Ethnologe Bronisław Malinowski möchte er bei seinen Feldstudien vierhundert Kilometer westlich von Paris sowohl aktiver Teil der indigenen Bevölkerung werden wie auch wissenschaftlicher Chronist der Fremde und des Prozesses ihrer Erkenntnis.
Fünfhundert Seiten später bezieht der junge Bauer, der ein Jahr zuvor noch Student war, den eigenen Bauernhof "Aux Bons Sauvages", "Zu den guten Wilden", zusammen "mit zwei Katzen, einem alten Hund, zwei Schweinen, etlichen Feldmäusen, einer Igelfamilie, Millionen unsichtbarer, mehr oder weniger schädlicher Kleinstlebewesen" und einer neuen Geliebten, die in dieser Aufzählung mit guten Gründen als "Hominide" aufgeführt wird. Welch eine Glücksgeschichte! Der wildwiesenbunte Traum eines verkopften Großstädters unserer Tage, von Levi Strauss zur eigenen Apfelplantage, "ein paar bepflanzte Hektar, die Tonnen von CO₂ aus der Atmosphäre saugten", und auf zum letzten Satz des Romans, mit dem in bester bombastisch-universalistischer Stimmung das richtige Leben jenseits des Romans beginnt: "Ich startete den Motor, legte den ersten Gang ein, und wir fuhren los, den Planeten zu retten."
So gelesen, ist Mathias Enards Roman "Das Jahresbankett der Totengräber" ein gut gelauntes französisches Seitenstück zu aufgeklärt-skeptischen, aber doch umweltmoralisch gutwilligen Landromanen hierzulande, wie sie in jüngster Zeit Lola Randl, Juli Zeh oder Dörte Hansen geschrieben haben. Gut zu lesen, lehrreich, nah an Windkraft, Saftsäure und Photosynthese. Man könnte sich mit dem ersten und letzten Kapitel dieses Romans so lange aufhalten, dass der labyrinthische exuberante Rest zur romanexperimentellen Fußnote schrumpfte, über die man dann schimpfen und spekulativ bramarbasieren könnte. Denn es ist schwer zu fassen, was in den fünf Kapiteln dazwischen geschieht, in der Sache und in der Sprache.
Mäßig fremd die Leute allesamt, viel weniger urig, als einem Fremdenforscher lieb sein kann
Die Form des ersten und letzten Kapitels ist das Tagebuch des jungen Möchtegern-Anthropologen David Mazon. Etwas großsprecherisch geht er seine Ethnologie des Inlands an, verfasst einen Plan für hundert Interviews mit den Eingeborenen, skypt mit seiner Pariser Freundin Lara, wobei schon der Seidenschimmer ihres Nachthemds genügt, webcambasierten Sex zu initiieren, wonach es mit dem klapprigen Mofa Jolly Jumper und später einem durchgerosteten postgelben Renault-Kastenwagen über Stock und Schlaglöcher geht.
Natürlich führt kein Weg an der Dorfkneipe vorbei, einem von Trinkern und Spielern besetzten "Anglercafé", wo der Wirt Thomas und der Bürgermeister Martial, zugleich Chef der örtlichen Totengräber, als zentrale soziale Relaisfiguren fungieren, rau und herzlich, vielleicht auch bös und verschlagen, zumal beide gelegentlich die menschliche Gestalt verlassen. Daneben Mathilde und Gary, die Vermieter des teilnehmenden Beobachters, Lucie, die toughe Marktbäuerin, Max, der abgedrehte Künstler, ferner der melancholisch trinkende Pfarrer Largeau, ein englisches Pendler-Paar, Paco und der Fleischer Patarin - mäßig fremd die Leute allesamt, viel weniger urig, als einem Fremdenforscher lieb sein kann, der sich kompensatorisch übertreibend schon mal "unter der Maske der Andersartigkeit" wähnt, wie er mit gewählter Levinas'scher Begrifflichkeit sagt.
Enard kostet den Witz der vergeblichen Anstrengung, Abstand aufzubauen, um Nähe zu gewinnen, weidlich aus. Er lässt David im Tagebuch eher sprechen als schreiben, noch so gerade das universitäre Über-Ich im Nacken (Sorbonne und Doktorvater), aber schon bald von Essensgelüsten, Verliebtheitsgefühlen und Zukunftsträumen hingerissen. Immer stärker konzentrieren sich der Roman und sein Held auf die Frau mit dem in Anthropologenohren verführerisch klingenden Namen Lucie. Von ihr und ihrer schwer beschädigten Rumpffamilie geht dann auch der galoppierende Wahnsinn der fünf zentralen Romanteile los.
Enard hat sich beim Buddhismus bedient und übernimmt das Prinzip der Wiedergeburt
Enard wechselt mit dem zweiten Großkapitel von der Ich-Form zum freien auktorialen Erzählen, das auch schon mal personal verengt werden kann, zum Beispiel zur Perspektive eines wilden Keilers auf dem Rücken einer sexuell beglückten Bache, oder einer Wanze im Bett von Napoleon vor seiner Reise nach St. Helena. Romandramaturgisch löst Enard sich von allen Fesseln. Jeder und alles Lebendige überhaupt, so das Prinzip seines Romans, kann sich nach seinem Ableben in etwas anderes verwandeln.
Das könnte jeder divers und multipel beschwingte Erzähler auch freihändig inszenieren, mit herzstärkenden Referenzen zu Ovid und Joanne K. Rowling. Doch Mathias Enard, im literarischen Nebenerwerb Kultur- und Religionswissenschaftler, wie wir aus seinem erfolgreichen west-östlichen Roman-Diwan "Kompass" (2016) wissen, hat sich für seine Verwandlungstricks beim tibetischen Buddhismus bedient und das tief in Zeit und Raum reichende Prinzip der Seelenwanderung übernommen, des Lebensrades und der Wiedergeburt. Voilà, ein neues Perpetuum mobile der Romanproduktion ist erfunden und sogleich im westlichen Frankreich zwischen Loire und Gironde installiert. Grenzen braucht schließlich auch der bunteste Romanteppich, und sei es, um sie zu überfliegen.
Wir befinden uns also in der Herkunftsregion des viel reisenden, meist in Barcelona lebenden Autors Mathias Enard. Hier kennt er sich mindestens so gut aus wie zwischen Damaskus, Teheran, Wien und Istanbul in "Kompass", und er zieht sogar noch einige historisch-kulturelle Fäden mehr, was auch diesen neuen Roman kompendiös und seinem gastrointestinalen Thema entsprechend adipös macht. Das zweite Kapitel, "Der Zeh des Gehenkten", beginnt mit dem Tod des trinksüchtigen Ortspriesters Abbé Largeau, der sich in einen frisch geworfenen Frischling verwandelt, ein Eber übrigens, während Mathilde, seine geheime Liebschaft, bittere Tränen weint, weil sie für ihre mit Rotwein verlängerten herzhaften Suppen nun keinen Empfänger mehr hat.
Die Frage ist, wie ein Autor diesem ewigen Kreisen eine Konsistenz abgewinnen kann
Nehmen wir den wilden Eber, immer hungrig und fortpflanzungsbereit, als ein Erzählbeispiel für viele andere. Im Fortgang des Romans begegnet er uns wieder als Unfalltier, das den Renault-Lieferwagen des Kneipen-Thomas rammt und schwer angeschlagen in denselben verfrachtet wird. Wir folgen dem Dialog der Fahrer Thomas und Martial. Solche Tierunfälle müssten den Behörden gemeldet werden, so der Amtsinhaber, doch der mit Jagdflinte bewaffnete Thomas bettelt um einen sauberen Schuss ins Gesicht des Schweins. Zweimal drückt er ab, die Schnauze fliegt auseinander, das Blut rinnt auf den rostigen Boden, das Schrot reißt Löcher in Rückenlehnen und Armaturenbrett, das ganze Auto stinkt sein Schrottleben lang nach Tod und Verwesung, was auch David Mazon kaum aushält, der spätere Besitzer.
Die begattete Bache indes, irritiert über Unruhe im Unterholz, flüchtet panisch in eine Trafostation und verursacht einen derartigen Kurzschluss, dass es weithin blitzt und raucht und in großem Umkreis der Strom ausfällt, sodass David Wachskerzen aus Abbé Largeaus verlassener Kirche klaut; und die Polizei einen Terroranschlag der Bürgerbewegung gegen die riesigen Wasserspeicher im Marais vermutet; weshalb auf dem nahen Markt die schöne Bäuerin Lucie verhaftet wird; was bei David Sorgen auslöst und so weiter, nach einem Kettenprinzip, von dem es im Roman religiös gelassen heißt, "das Schicksal, wo alles miteinander verbunden ist, in einem riesigen Geflecht unsichtbarer Fäden, kennt keine Zeit".
Die Wiederentdeckung des unendlichen buddhistischen Lebensrades durch Mathias Enard beschert uns Lesern eine buchstäbliche Roman-Revolution. Alles dreht, verkehrt und verwandelt sich, schreitet vor und zurück, ein ewiges Vorübergehen - und die Frage ist allein, wie ein Autor diesem quasimetaphysischen wirkmächtigen Organizismus eine Konsistenz abgewinnen kann. Enard hält die Zügel erst recht fest in der Hand, lässt sie von Kapitel zu Kapitel lockerer, manchmal scheint er sie fahren zu lassen, derart häufen sich die Geschichten, von Cäsars dreigeteiltem Gallien über Chlodwigs I. Christianisierung, Karl Martells Sieg über die Araber, dem guten Heinrich IV. bis zu Napoleon, dem Zweiten Weltkrieg und Putin. Natürlich nicht in dieser Reihenfolge. Und als Zeugen, also indirekte Erzähler fungieren Barden und Soldaten, Maden und Troubadoure, Füchse und fuchsfarbene Pferde, Baumwurzeln und Totengräber, das Lebendige selbst als ewiges Medium.
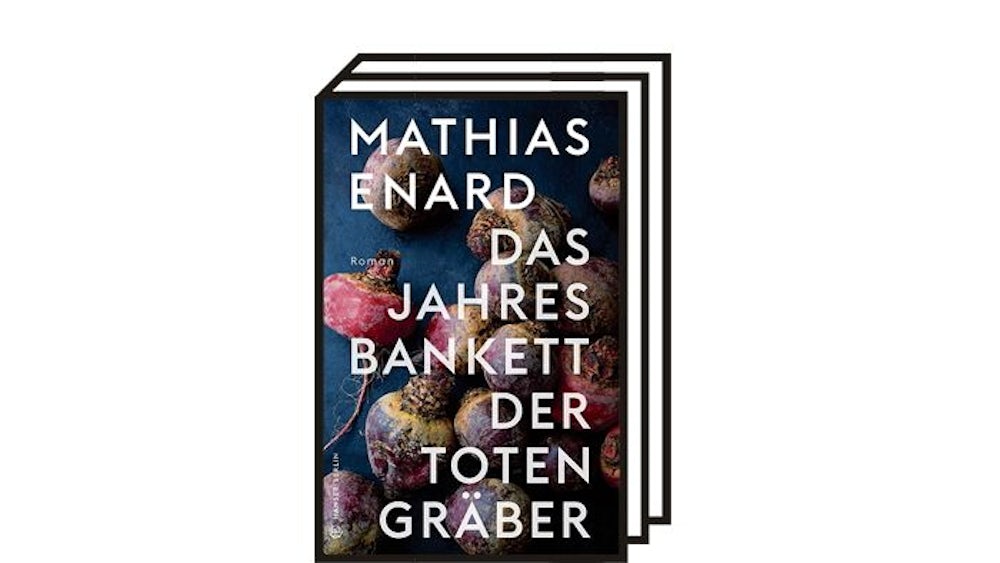
Gemeinsam ist ihnen der Bezug zur Landschaft zwischen Nantes, La Rochelle und Bordeaux, auch ein übermütiger Ton des Alleskönnens, der Erzählton eines gelehrten Universalisten und postromantisch gestimmten kosmischen Hallodri. Den Wiedergeburtsteil des Romans leitet er höhnisch mit einem Zitat von Gilles Deleuze (über Leibniz) ein: "Was kann ein Mensch herausschreien, der an die Vernunft glaubt? Er kann nur eines herausschreien: Was auch immer geschieht und was auch immer man mir zeigt, all das muss einen Grund haben."
Enard möchte an der Stelle von Gründen Geschichten erzählen, die wiederum Geschichten initiieren, kopieren und darauf anspielen. Er möchte komponieren und orchestrieren, kurz: er möchte im vollen Sinn des Wortes Autor sein, Schöpfer der Fülle; Gott mithin, wie jeder Autor mit universalem Anspruch. Dieser monotheistischen Position ist Enard näher als dem klug instrumentalisierten karmisch betriebenen Rad des Schicksals.
Das mittlere der sieben Kapitel trägt den Romantitel selbst. Es erzählt von dem dreitägigen, den Tod aussetzenden großen Fressen und Saufen der neunundneunzig Totengräber der Region. Als Maßstab für die mit betrunkenen Traktaten gespickte hundertseitige Orgie kann nur Rabelais' "Gargantua und Pantagruel" gelten. In der von Rabelais erfundenen Abbaye de Thélème findet das jeder Beschreibung spottende Fest des Überflusses statt. Ein utopischer Ort, der seinerseits inspiriert ist vom Venezianer Francesco Colonna und als erste Utopie der französischen Literatur gelten darf. Überdeteminiert also auch dieses nur scheinbar anarchische Gastmahl. Eine Art stilistisch beherrschter Kataklysmus, der erst recht die Frage nach der Lesbarkeit der Welt und dieses Buches stellt.
Es ist ein großes Wimmelbild, aus dem man einzelne Geschichten hervor- und zurücktreten lassen kann. Sie hängen untereinander und mit der Geschichte des Ortes zusammen, am Ende mit dem Personal der Erzählung von David Mazon und seinem westpazifischen Bauerndorf. Ein großes heiteres Kunststück, das gutwillige und mitunter hartnäckige Leser braucht.

