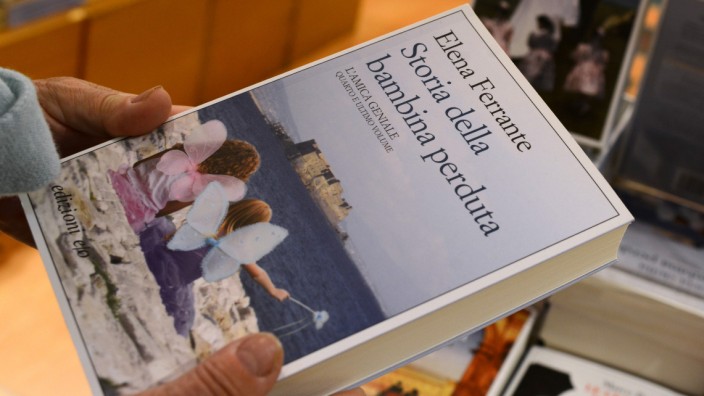Nino Sarratore ist ein Lügner. Ein Blender, intelligent und begabt, der sich intellektuellen Moden anpasst, geltungssüchtig, politisch wankelmütig, berechnend. Dass er jede Frau verführt, die ihm über den Weg läuft, versteht sich fast von selbst. Nino Sarratore ist eine erfundene Figur, einer der Helden in Elena Ferrantes großer Neapel-Tetralogie "Meine geniale Freundin". Die Ich-Erzählerin Lenù verwendet Jahre ihres Lebens auf Nino. Er ist die schlimmste Ausprägung der patriarchalen Gesellschaft, das schlimmste Beispiel für einen italienischen Mann. Seine herausragende Eigenschaft: die der Selbstermächtigung.
Mit dieser Haltung hat der Journalist Claudio Gatti sich in der Wirtschaftszeitung Il Sole 24 ore darangemacht, das Pseudonym "Elena Ferrante" zu lüften. Unterstützt von seiner Zeitung und drei weiteren internationalen Medien, darunter auch der FAZ, gibt er Auskunft über die Vermögensverhältnisse des Ehepaares Anita Raja und Domenico Starnone. Denn deren Einkünfte sind das zentrale Argument seiner Recherche, derzufolge die Übersetzerin Anita Raja die durch den Erfolg ihrer Bücher plötzlich reich gewordene Autorin "Elena Ferrante" ist.
Eine typische "follow the money"-Strategie. Private Details, wie der angebliche Spitzname des Ehemannes, sind erfunden, andere verzerrt. Der Tonfall von Gattis Text ist der einer Enthüllungsrecherche, die einem Vergehen auf die Spur kommt - so als habe niemand ein Recht, die eigene Autorschaft zu verbergen, schon gar nicht eine Frau. Umsatzsteigerungen, die eigentlich niemanden etwas angehen, sind bei einer Intellektuellen offenkundig ebenfalls obszön.
Römische Freunde wussten: Anita Raja und ihr Mann Domenico Starnone gelten als Urheber
In einem zweiten FAZ-Artikel erzählt Claudio Gatti die Lebensgeschichte der Mutter von Anita Raja, die als Tochter einer jüdischen Familie im Alter von zehn Jahren nach Italien kam, den Holocaust überlebte, in Neapel aufwuchs und dort heiratete. Geld, Geheimnisse, ein Pseudonym, Judenverfolgung. Brisanter geht es kaum. Doch wer hätte diese Geschichte erzählen dürfen? Höchstens Elena Ferrante.
Ist es wichtig, die Autorin samt ihren Vermögensverhältnissen hinter dem Pseudonym hervorzuziehen und ihrer Familiengeschichte den Status eines Passepartouts zuzuschreiben, der erst jetzt das "wahre" Verständnis des Werks ermöglicht? Anita Raja und Domenico Starnone haben sich entschieden, sich nicht zu Wort zu melden und auch nicht Auskunft darüber zu geben, ob lediglich einer von ihnen oder beide die Urheber der Ferrante-Bücher sind, ob einer schreibt und der andere konzipiert. Sie sind ernsthafte, zurückgezogene Personen, die eine genuine Leidenschaft für Literatur haben.
Anita Raja, Jahrgang 1953, war bis vor kurzem Bibliothekarin; sie zählt zu den besten italienischen Übersetzerinnen aus dem Deutschen, was sie in ihren Übertragungen von Christa Wolf häufig gezeigt hat. Kaum jemand hat mehr Gespür für Satzrhythmus und sprachliche Gestaltung, für die Färbung einer Figurenrede als sie. Und vermutlich hat kaum jemand ein empfindsameres Ohr für einen falschen Zungenschlag.
Wie ihre gesamte Generation war sie von den Umbrüchen, die in die Neapel-Serie einfließen, direkt betroffen, sie hat die Radikalisierung der Linken in den Siebzigerjahren und den Niedergang der Kultur unter Berlusconi erlebt. Dem Literaturbetrieb stand sie immer distanziert gegenüber, und selbst als in Italien ihr Name und der ihres Mannes im Zusammenhang mit Elena Ferrante zu kursieren begannen, schwieg man unter den römischen Freunden darüber.
Unangenehm ist der Gestus der Enthüllung: Als habe die Autorin ihre Leser getäuscht
Starnone, 1943 in Neapel geboren, hat eine Reihe sehr guter Romane veröffentlicht, er war Lehrer von Beruf, hat später als Journalist bei der linken italienischen Tageszeitung Il Manifesto gearbeitet, Drehbücher verfasst und zudem an der Turiner Schreibschule von Alessandro Baricco unterrichtet. Über seine Kindheit in einem schwierigen Milieu in Neapel und die eruptive Gewalt hatte er in seinem Roman "Via Gemito" geschrieben. Zu seinen Bestsellern gehörte der 1995 erschienene Band "Solo se interrogato", dessen Erzählungen vom Schulalltag in Italien handeln. Die Abgründe der Welt des Films prangert er in "Spavento" an, "Schrecken", der 2009 erschien, und scheint einige Auswüchse der aktuellen Geschehnisse vorwegzunehmen. 2014 erschien "Lacci", "Schnürsenkel", ein Roman über eine Ehe, die in die Wirren der 68er-Bewegung gerät.
Womöglich war die Verwendung eines Pseudonyms zunächst ein Spiel
Beide, die Übersetzerin Anita Raja und der Autor Domenico Starnone, kennen die Spielregeln der Literatur. Womöglich war die Verwendung eines Pseudonyms für sie zunächst eher ein Spiel. Für Anita Raja: eine Möglichkeit, in einem geschützten Raum neben ihrer Übersetzertätigkeit die Rolle einer literarischen Autorin zu erproben und zu entfalten. Und für ihren Mann mag es ein Reiz gewesen sein, einmal unter weiblichem Namen zu schreiben. Vielleicht hat Anita Raja die Geschichte geschrieben, vielleicht stammt die Dramaturgie von Starnone. Vielleicht ist sie allein die Urheberin.
Das Schreiben in einer eingeschworenen Gemeinschaft passt auch zu Sandro Ferri und Sandra Ozzola, die in einer kleinen Wohnung in der Via Camozzi nahe beim Vatikan ihren Verlag e/o betreiben. Mit ihrem Verlag, den sie 1979 in ihrem Wohnzimmer gründeten, wollten sie den Blick auf die Länder jenseits des Eisernen Vorhangs richten und boten ein Programm mit osteuropäischen Autoren. Ozzola ist Slawistin, und zum ersten Mal erschienen in ihrem Verlag Schriftsteller wie Bohumil Hrabal und Kazimierz Brandys auf Italienisch. Dass Christa Wolf und Christoph Hein ins Spiel kamen und ihre Bücher nach dem Mauerfall noch an Gewicht gewannen, lag nahe. Sandro Ferri hielt unter seinen Freunden nach einer Übersetzerin Ausschau, und so begann Anita Raja mit ihrer Arbeit. In einer Erklärung des Verlages deutet er die Enthüllung des Pseudonyms als Versuch der Abwertung: Statt die Bücher von Elena Ferrante als Werke ernst zu nehmen, gehe es nur um die Person.
In einem Interview für den Paris Review befragten er und seine Frau Elena Ferrante. Es gibt sogar eine Schriftprobe. Wieder ein Spiel mit Realität und Fiktion, wieder ein Spiel mit Rollen, wie in der Romanserie. Wer sich mit doppelten Böden, der Inszenierung der Schriftstellerfigur und Fiktionalisierung von Wirklichkeit beschäftigen will, wird hier viel Material finden. Gerade darin zeigt sich das Vermögen der Autorin.
Nicht nur in Italien hat Gattis Text zu Protesten geführt
Die Verwendung von Pseudonymen hat eine lange Tradition in der europäischen Literatur. An der Enttarnung Elena Ferrantes berührt unangenehm der Gestus, hier werde eine illegitime Irreführung des Publikums aufgedeckt. Nicht nur in Italien hat Gattis Text zu Protesten geführt, unter jenem Teil des Publikums, der sich das lieb gewordene Pseudonym als Projektionsfläche nicht nehmen lassen mag, aber es sind auch viele Leser dabei, die das Recht, sich ein Pseudonym zu wählen, gegen den Verdacht verteidigen, es könne dafür kein anderes Motiv geben als ein ökonomisches.
Der Ton der Enthüllungsreportage passt zu Sarratone, der Figur in Ferrantes Roman. Es ist der Ton des Sensationsjournalismus. Auf Literatur wirkt er zerstörerisch.