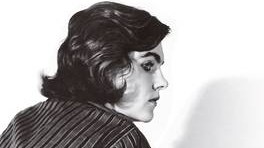Wer war diese hochgewachsene Frau, die ein bisschen aussah wie Liz Taylor, eine southern belle, stets elegant, aber mit einem Flachmann in der Clutch, eine Sechzigerjahre-Erscheinung in Kostüm oder Twinset wie für die Serie "Mad Men" gecastet, auch wenn sie nur zum nächsten Liquor Store schlurfte, zum Waschsalon oder zurück zum Trailerpark?
Eine Frau, die in ihrem Leben durchschnittlich alle neun Monate umgezogen ist, von Montana nach Texas, von Texas nach Chile, von Chile nach New Mexico, von dort weiter nach New York City und wieder zurück in den Süden: nach Kalifornien, Mexiko, Arizona und Colorado und zuletzt wieder nach Kalifornien. Die ganz allein vier Söhne großzog, obwohl sie drei Mal verheiratet war, sich als Putzfrau durchschlug, als Nachtschwester, Hilfslehrerin, Telefonistin und Arzthelferin. Die dem Alkohol verfiel, die Sucht besiegte, um ihr erneut zu erliegen. Die abstürzte und immer wieder aufstand. Und die nebenher Geschichten schrieb, wüste Geschichten von leuchtender Dunkelheit, Geschichten einer Frau, die eine Heilerin sein wollte in einer heillosen Welt.
Ein posthumes, zweites Debüt
76 dieser Geschichten veröffentlichte sie bis zu ihrem Tod an ihrem 68. Geburtstag im November 2004. In den Achtzigerjahren erschienen sie in drei Bänden und dann noch einmal, ergänzt um weitere Arbeiten, in den Neunzigern.
Lange Zeit hatte Lucia Berlin nur einen kleinen Kreis von Lesern. Bis im vergangenen Jahr 43 ihrer Geschichten unter dem Titel "A Manual for Cleaning Women" bei Farrar, Straus and Giroux erschienen, zum Bestseller wurden und ihren Rang bestätigten als eine der besten Autorinnen, die das 20. Jahrhundert hervorgebracht hat. Elf Jahre über ihren Tod hinaus hatte dieser Durchbruch auf sich warten lassen, keine literarische Wiederauferstehung, sondern ein Comeback aus dem Nirgendwo, ein posthumes, zweites Debüt.
Nun ist der Band auf Deutsch verfügbar, genauer gesagt eine Auswahl der Auswahl. 30 Geschichten umfasst die von Antje Rávic Strubel übersetzte Ausgabe "Was ich sonst noch verpasst habe".
Das Leben schreibt keine Geschichten. Dazu bedarf es der Kunst des Erzählens
Lucia Berlin schrieb über das, was sie nur zu gut kannte: über vernachlässigte Kinder und zerrüttete Ehen, über Krankheit, Alter und Tod. Sie schrieb über ein Schulmädchen, das zur Verräterin wird, als es eine kommunistische Lehrerin denunziert. Oder über einen alten Apachenhäuptling, der über einen Waschsalon herrscht, ein lebender Totempfahl der domestizierten Freiheit. Oder über eine schwangere Drogenkurierin, die ihr Baby verliert, weil sie den Stoff in ihrem Unterleib transportiert.
Lucia Berlin fand ihre Geschichten an den Hintertüren des amerikanischen Traums, sie war eine Desillusionistin, wie Richard Yates oder John Williams Desillusionisten waren, und eine Mimose aus Stahl, die ihr Schreibideal einmal so beschrieb: "Keine Gefühle zeigen. Nicht weinen. Lass niemanden an dich ran." Aber ohne alle Elendsbukolik oder Larmoyanz. Ihre Geschichten sind alles andere als Prekariats-Pornografie, sondern präzise Feuerstöße aus dem Pandämonium der Deklassierten.
Lucia Berlin zu lesen ist manchmal, als müsste man Diamanten essen. Ihre Geschichten bestehen aus hochverdichteter Wirklichkeit, aber so geschliffen, dass man daran innerlich verbluten kann - wie die Autorin selbst, die ein entgleisendes Leben mit einer Fassung trug, als sähe sie nur aus der Ferne einem Unfall zu, obwohl sie doch zugleich dessen Opfer ist. Am scharfkantigsten an ihrem Schreiben aber ist ihr grimmiger Humor. In einer Geschichte beispielsweise muss der Vater mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Darauf sagt die Mutter: "Könnt ihr unterwegs anhalten und ein paar Bananen kaufen?" In einer anderen hat eine junge, illegal eingewanderte Mexikanerin ihr Baby zu Tode geschüttelt, damit es aufhört zu schreien, sonst wären beide aus dem Obdachlosenheim geflogen. Als sie erfährt, dass das Kind tot ist, sagt sie bloß: "Fuck a duck." Denn das ist eine der Floskeln, die sie in den USA aufgeschnappt hat. Diese Pointe ist so grausam, dass es einen schier zerreißt.
In einer der kürzesten Geschichten "Mein Jockey" arbeitet die Ich-Erzählerin in der Notaufnahme, und sie tut es gern, weil man dort Männer kennenlernt: "Echte Männer, Helden, Feuerwehrmänner und Jockeys." Besonders die Jockeys haben es ihr angetan, weil sie so klein und zierlich sind und weil sie sich ständig die Knochen brechen, weshalb es von ihnen "wundervolle Röntgenaufnahmen" gibt. "Ihre Skelette sahen aus wie Bäume, wie rekonstruierte Brontosaurier. Wie der heilige Sebastian." Einer dieser Jockeys, der bewusstlos eingeliefert wird, erinnert sie an die "Miniatur eines Aztekengotts", als sie ihn entkleidet, "ein verzauberter Prinz" mit dem prachtvoll zerbrochenen Körper einer antiken Statuette. Und als sie ihn zum Röntgen bringen soll und er sich nicht auf die Bahre legen will, da "trug ich ihn über den Flur, wie King Kong".
Mit dem Vergleich spielt Lucia Berlin auf ihre eigene Körpergröße an, "Bohnenstange" riefen ihr die Kinder in der Schule nach. "Ich war sicher, wenn sie (die Ärzte) meine Wirbelsäule richten würden, wäre ich zweieinhalb Meter groß", heißt es in "Nach Hause finden" einmal. Seit ihrer Jugend litt Lucia Berlin an einer Skoliose, einer krankhaften Verkrümmung der Wirbelsäule, die sie zeitlebens zwang, ein Stahlkorsett zu tragen. In ihren letzten Lebensjahren brauchte sie stets eine Sauerstoffflasche in ihrer Nähe.
Im Bergwerk der amerikanischen Seele
Lucia Berlin, die so tief im Bergwerk der amerikanischen Seele schürfte, wird 1936 als Tochter eines Bergbauingenieurs in Alaska geboren. Die Familie folgt dem Vater in die Minenstädte von Idaho, Kentucky und Montana; als er 1941 eingezogen wird, lebt Lucia mit ihrer Mutter und ihrer jüngeren Schwester in El Paso, wo der Großvater als Zahnarzt praktiziert. An den Fenstern steht in riesigen goldenen Lettern "Dr. H. A. Moynihan. Ich arbeite nicht für Neger." An einem Sonntagmorgen, erzählt sie in einer Geschichte, nimmt der Großvater sie mit in die Praxis. Das Mädchen soll ihm zur Hand gehen, wenn er sich, nur mit Bourbon betäubt, sämtliche Zähne zieht. In das noch wunde Zahnfleisch setzt er das vorbereitete künstliche Duplikat seines Gebisses ein und fletscht die falschen Zähne zu einem "Bela-Lugosi-Lächeln". Eine grausig-komische Kastrationsszene ist das und doch kein Sieg über das Monster, das seine Enkelin und deren Schwester sexuell missbraucht.
Ruhelose Jahre
Nach dem Krieg und der Rückkehr des Vaters übersiedelt man nach Santiago de Chile, nippt für kurze Zeit am Kelch des mondänen Lebens. Lucia heiratet früh, noch während des Studiums bekommt sie zwei Söhne, und sie beginnt zu schreiben. Mit 34 Jahren steht sie als Alleinerziehende mit vier Kindern und drei gescheiterten Ehen da. Es folgen ruhelose Jahre. Lucia Berlin zieht von einem Ort zum anderen, von einem Aushilfsjob zum nächsten. Von 1994 an unterrichtet sie kreatives Schreiben an der Universität von Colorado in Boulder. Drei Jahre vor ihrem Tod gibt sie diese Tätigkeit wegen ihrer schlechter werdenden Gesundheit auf und geht erneut nach Kalifornien, um in der Nähe ihrer Söhne zu sein. Sie wohnt dort bis zu ihrem Tod in einer umgebauten Garage.
Die vielen Umzüge hängen auch damit zusammen, dass Lucia Berlin wegen ihres Alkoholproblems immer wieder Arbeit und Status verliert. Eine Geschichte handelt von einer Frau, die nachts nicht in den Schlaf findet, weil sie weiß, ohne Alkohol wird sie nicht durchhalten bis zum Morgen, wenn sie funktionieren und ihre Söhne auf den Weg zur Schule bringen muss. "In der tiefen, dunklen Nacht der Seele sind die Spirituosenläden und die Bars geschlossen", so beginnt diese Geschichte. Also kramt sie ihre letzten vier Dollar zusammen, Geld, das sie nach dem letzten Entzug überall im Haus versteckt hat. Der Bottle Shop in Berkeley öffnet erst um sieben Uhr, bleibt nur der weite Weg zu Fuß zum Uptown-Laden, der schon um sechs aufmacht. Dort warten bereits die anderen Alkis im Morgengrauen und überbrücken die letzten zittrigen Minuten mit Hustensaft, dem blauen Tod, wie er genannt wird. Ein alter Mann lächelt sie an: "Was ist, Mama, ist dir schlecht? Tun dir die Haare weh?" - An diesem Morgen müssen die Söhne mit nassen Socken zur Schule gehen. Ihre Mutter war nicht früh genug zurück, um den Wäschetrockner rechtzeitig anzuwerfen.
Lapidare Lockenwickler-Lakonie
Die Alkoholkrankheit ist Teil der täglichen Normalität, so wie der schlimmste anzunehmende Zustand immer der Normalzustand ist bei Lucia Berlin. Am prononciertesten kommt diese Gleichzeitigkeit in der Titelgeschichte der amerikanischen Ausgabe zum Ausdruck. Dort geht es um eine Frau, die als Putzhilfe in den tagsüber verwaisten Häusern von Suburbia zur Spurenleserin der schleichenden Entfremdung in den Ehen und Familien wird. Sie klaut, wie so viele andere Putzfrauen auch, aber sie klaut keine Perlenohrringe oder Silberlöffel, sie klaut sich eine tödliche Dosis Schlaftabletten zusammen. Denn bei ihren Reflexionen über das verwüstete Leben in aufgeräumten Häusern läuft immer die Trauer um den geliebten Mann mit, der vor Kurzem gestorben ist. "Was wirst du nur ohne mich machen, Maggie?", hatte er sie wieder und wieder gefragt. Darauf sie: "Makramee, du Drecksack."
Die tragische Wucht trifft einen hier wie ein Handkantenschlag, aber die Wirkung kommt gerade durch den lässigen Ton zustande, die lapidare Lockenwickler-Lakonie, mit der Lucia Berlin diese Totenklage camoufliert. Und durch viele Beobachtungsdetails, die Erinnerungen wachrufen und die Fülle eines Lebens heraufbeschwören, das für die Erzählerin jeden Sinn verloren hat. Wenn sie kündigt, das hat sie sich geschworen, dann will sie alle Stecker der Digitaluhren herausziehen. Denn für sie ist die Zeit bereits stehen geblieben, als ihr Mann starb.
Eine überaus selbstreflektierte, formbewusste und skrupulöse Autorin
Man sagt bei solchen Geschichten gerne, dass sie das Leben schreibt. Aber das Leben schreibt keine Geschichten, kaum ein anderer Autor zeigt das so deutlich wie Lucia Berlin, deren Storys wie pure Osmose wirken. Doch damit der Soundtrack des Lebens vernehmbar wird, bedarf es der scheinbar kunstlosen Kunst einer großen Erzählerin. In "Point of View" erläutert sie, warum manche Geschichten als Ich-Erzählung nicht funktionieren. Eine Geschichte beispielsweise über eine alleinstehende Frau Ende fünfzig, die mit dem Bus zur Arbeit fährt und jeden Samstag ihre Wäsche macht, die also "all diese zwanghaften, obsessiv langweiligen Details im Leben dieser Frau" ausbreite, funktioniere nur, wenn sie in der dritten Person geschrieben sei. Erst die auktoriale Erzählhaltung verleihe der Geschichte Gewicht, denn: "Der Leser denkt: Zur Hölle, wenn der Erzähler meint, dass etwas an dieser traurigen Kreatur es wert ist, darüber zu schreiben, dann muss es wohl so sein."
Es ist nahezu unverzeihlich, dass dieser Text, in dem Lucia Berlin Auskunft gibt über ihr Schreiben, genauso wenig in die deutsche Ausgabe aufgenommen wurde wie das Vorwort von Lydia Davis, die mit ihr befreundet war. Denn Berlins Schreiben war eben nicht "unbehauen" und "urwüchsig", wie Antje Rável Strubel in ihrem Vorwort zu wissen glaubt. Berlin war vielmehr eine überaus selbstreflektierte, formbewusste und skrupulöse Autorin. Über Raymond Carver, mit dem sie ebenso oft verglichen wird wie mit Renata Adler oder Joan Didion, schrieb sie, sie habe seine Geschichten gemocht, "bevor er ausnüchterte & den Schluss seiner Texte versüßte". Und in einer Geschichte, die in Mexiko spielt, übersetzt die Hauptfigur in Gedanken ein Gedicht aus dem Spanischen. Doch wie die letzte Zeile heißen muss, fällt ihr erst ein, als ein Muscheltaucher ertrinkt: "Und so kehrt alles Blut / an den Ort seines inneren Friedens zurück". Das Gedicht bildet die Klammer der Erzählung, aber Kunst, so die implizite Botschaft, gelingt erst, wenn das Leben den Worten Atem einhaucht. Und manchmal bedarf es des schwarzen Kairos eines Unglücks, um die richtigen Worte zu finden.
Bleiben wird Lucia Berlin als ungekrönte Gypsy Queen der kleinen Form
Lucia Berlins eigene Vorbilder waren Flaubert und Tschechow. Und auf Proust bezog sie sich, als sie in "B. F. und ich", ihrer letzten Geschichte, schrieb: "Seine Ausdünstungen waren für mich wie eine Madeleine." Ausdünstungen, nicht der Duft von Gebäck und Lindenblütentee in einem Pariser Salon. Das ist der Unterschied. Denn es geht hier um einen verfetteten, alten Fliesenleger mit Schnapsfahne, der ins Haus kommt und von dem es heißt: "Ich mochte ihn sofort." Denn: "Üble Gerüche können nett sein."
Die Geschichten von Lucia Berlin sind autofiktional, aber sie sind deshalb nicht unmittelbar autobiografisch. Manchmal wird jedoch gesagt, sie seien Teile eines Ganzen, ein Roman in Splittern. Diesen Eindruck unterstützt auch die deutsche Ausgabe, indem sie die Geschichten so anordnet, als ergäben sie die fortlaufende Chronologie eines Frauenlebens von der Jugend bis zum Alter. Dadurch wird eine vermeintliche Naturhaftigkeit des Schreibens konstruiert, die im Grunde die schöpferische Leistung der Autorin herabsetzt und so tut, als wäre alles nur aus ihr herausgeflossen. Zudem ist es irreführend für den Leser, der verleitet wird, nach einem stärkeren inneren Zusammenhang der einzelnen Geschichten untereinander zu suchen, als es ihn tatsächlich gibt. Das Beispiel zeigt, dass es nicht immer von Vorteil ist, wenn der Übersetzer zugleich das Vorwort schreibt und sozusagen zum Kurator wird. In diesem Fall zwingt die gewählte Abfolge den Korpus der Geschichten in das Korsett eines künstlichen Narrativs.
Die Übersetzung dagegen schmiegt sich so eng ans Original, wie das dem starren Fachwerk des deutschen Satzbaus möglich ist. Nur kleine Ungenauigkeiten sind zu bemängeln: "round swing" wird einmal mit "Schaukel" übersetzt, gemeint ist aber ein Karussell. Und wenn eine Krankenschwester den diensthabenden Arzt ruft, wäre "anpiepen" gewiss verständlicher und einfacher als "anpagen". Ebenso ist ein "charity case" eher ein "Sozialfall" als "ein Fall für die Nächstenliebe", und "pussywillows" sind eindeutig Weidenkätzchen, nicht "Kätzchenweiden". Die Ordenstracht der Nonnen, den Habit, übersetzt Antje Rávic Strubel im Plural originellerweise mehrmals mit "Habitate" statt mit "Habite".
Lucia Berlin war so etwas wie die ungewaschene Schwester von Doris Day, eine Hausfrau der Hölle, wenn man so will, die mitten durchs Fegefeuer flanierte. Eine Schutzflehende der Sozialfälle und schreibende Kümmermutter schon auch. Bleiben aber wird sie als ungekrönte Gypsy Queen der kleinen literarischen Form. Rückblickend schrieb Lucia Berlin einmal: "Wie oft war ich in meinem Leben gewissermaßen auf der hinteren Veranda statt auf der vorderen?" Mit so schlichten Worten kann man ein ganzes Leben zusammenfassen - ein Leben, unter dessen Veranda direkt der Abgrund lauerte.
Lucia Berlin: Was ich sonst noch verpasst habe. Stories. Aus dem Englischen von Antje Rávic Strubel. Arche Verlag, Zürich 2016. 384 Seiten, 22,99 Euro. E-Book 17,99 Euro.