In Berlin ist vor Kurzem eine Ausstellung mit Bildern des japanischen Fotografen Nobuyoshi Araki eröffnet worden, und es gab Protest dagegen.
Beides ist erst einmal nichts Ungewöhnliches. Seit Jahrzehnten wird ständig irgendwo eine Araki-Ausstellung eröffnet. In letzter Zeit schienen sie sich noch einmal zu häufen, vielleicht weil Araki mittlerweile 78 ist. Und falls wirklich gerade mal keine zu sehen sein sollte, lässt sich die kurze Pause problemlos mit einem seiner 500 Fotobücher überbrücken. Genauso lange und genauso regelmäßig gibt es auch Protest gegen seine Arbeit; der Protest gehört fast schon integral dazu. Der Künstler könnte nicht immer wieder als "kontrovers" angepriesen werden, wenn es keine Kontroversen um ihn gäbe. In Japan waren seine Fotos immer schon ein Fall für die Zensur, die mit Bildern von Sexualität von Gesetz wegen sehr restriktiv umgeht. Aber auch im Westen wurde seine Arbeit zuverlässig von Pornografie-Vorwürfen begleitet, allerdings nicht der Sichtbarkeit entzogen. So wurde Araki über die Jahrzehnte selbst zu einer ikonischen Figur: der Sexbesessene mit der Clown-Ferdinand-Frisur und den gefesselten nackten Frauen.
Alle Diskussionen über Araki seien längst geführt. Die Aktivistin will seine Fotos nie mehr sehen
Inzwischen haben sich die Zeiten allerdings geändert. Denn der Vorwurf von Pornografie ließ sich, einer alten Tradition der Moderne folgend, immer noch zum Beleg emanzipatorischer Furchtlosigkeit umbiegen. Jetzt lautet der Vorwurf aber auf Sexismus, und das ist ein Unterschied, der die Dinge auch in den Konsequenzen in ein anderes Licht rückt. Mitten in die Laufzeit der sehr populären Araki-Ausstellung im New Yorker Museum of Sex platzte letztes Frühjahr eine Anklageschrift von Arakis langjährigem Lieblingsmodell, einer Frau, die nur unter dem Vornamen Kaori bekannt ist und sich von der "Me Too"-Bewegung inspiriert fühlte, an die Öffentlichkeit zu gehen. Sie bezichtigte ihn nicht sexueller Übergriffe, sondern emotionaler Ausbeutung. Kaum hatte die Araki-Ausstellung in New York geschlossen und dafür in Warschau eine aufgemacht, kam es dort zu einer Protestaktion eines Künstlerinnenkollektivs mit Bisonmasken (die Gruppe heißt "Bisondamen, wir sagen nein"), die sich mit Kaori solidarisch erklärten.
Vor der Fotografie-Ausstellungshalle C/O Berlin waren es nun zwanzig Aktivistinnen einer Gruppe, die sich "Angry Asian Girls Association" nennt und zu "Widerstand gegen sexuelle Ausbeutung im Kunstbetrieb" aufruft. Prompt kam das Angebot der Ausstellungsmacher, diese Kritik im Gästebuch oder online unter dem Stichwort #Arakidebatte zu formulieren. Aber die Angry Asian Girls lehnten das ab: Sie, als asiatische Frauen, sähen sich selbst in diesen Bildern, zur ästhetischen Erbauung dargeboten wie das Bild einer Landschaft. Hier wäre von der Warte eines europäischen Mannes aus zwar kurz einzuwenden, dass ästhetische Erbauung nicht zwingend das ist, was sich einstellt, wenn Frauen eingeschnürt wie Rollbraten herumliegen oder von der Decke hängen. Aber darum geht es jetzt nicht. Eine Vertreterin der Angry Asian Girls begründete die Diskussionsverweigerung im Gespräch mit dem Kunstmagazin Monopol damit, dass alle Diskussionen über Araki längst geführt seien, dass jede Teilnahme an einer weiteren solchen Diskussion am Ende auf Werbung für die Ausstellung und damit Komplizenschaft hinauslaufe - und dass es vielmehr darauf ankomme, eine Araki-Ausstellung gar nicht erst zu eröffnen, die Bilder schlicht nicht zu zeigen oder anzuschauen.
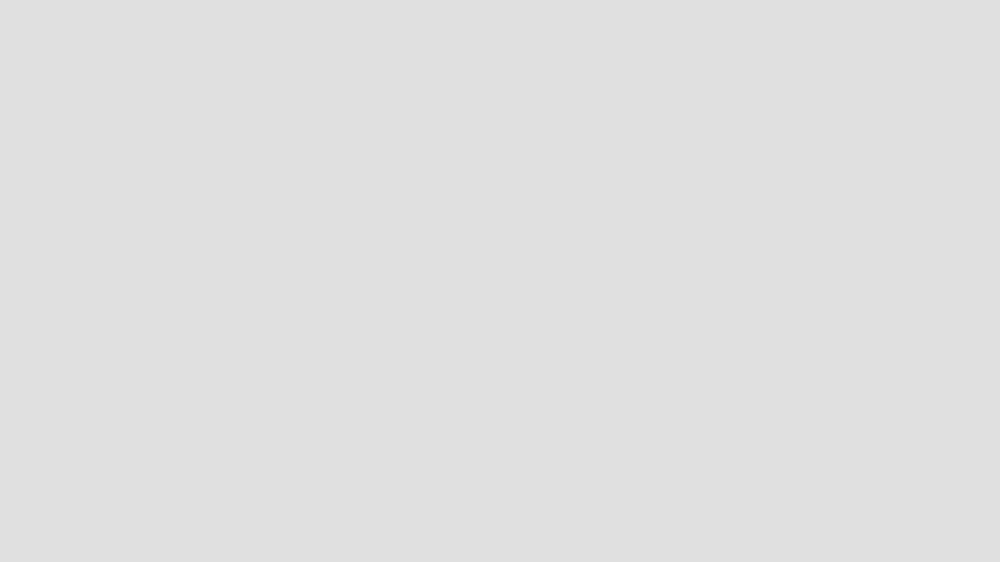
In der Logik eines derart radikalen Protests stellen sich Fragen der Verhältnismäßigkeit insofern nicht mehr, als reine Zahlenverhältnisse in solchen Debatten eben ausdrücklich kein Argument mehr sind: Der Protest der zwanzig kann durch die vielfache Menge derer, die sich die Ausstellung anschauen werden, nicht aufgehoben, sondern nur bestätigt werden. Es ließe sich auch nicht mit dem Zahlenverhältnis der verschnürten Frauen zum Rest des Werkes dagegen argumentieren. Denn die von Felix Hoffmann kuratierte Ausstellung mit dem Titel "Impossible Love" (bis 3. März) zeigt in Wirklichkeit vor allem alles andere: Stillleben, Polaroids, Arakis selten zu sehendes Frühwerk, viel Stadtfotografie von einer bemerkenswert melancholisch-verregneten Neonlicht-Schönheit, aber eben auch viel Tokioter Rotlichtmilieu, gespreizte Schenkel und ja, hin und wieder sogar auch eine Frau, die mit der rituellen Fesseltechnik Kinbaku-bi in Taue verschnürt ist.
Auch die Deutung, dass diese speziellen Bilder gewissermaßen bestimmte Verschnürungen des Herzens drastisch an der Außenseite des Körpers abbilden, zu der Silke Hohmann von dem erwähnten Kunstmagazin Monopol in einem Gespräch mit Araki kam, könnte letztlich nicht dagegen ankommen, dass selbst zum Zweck solcher Metaphorik zunächst der Körper einer Frau von einem Künstler hergenommen, inszeniert und zur Ansicht ausgestellt wird. Das "primäre oder natürliche Sujet", wie der Kunsthistoriker Erwin Panofsky das genannt hat, was man sieht, bevor man mit dem Deuten beginnt, wird in der Sichtweise der Protestierenden dermaßen primär und schwerwiegend, dass sich weiteres Deuten im Prinzip erübrigt.
Im Reiseanzug und mit Rollkoffer ließ sich der Berliner Künstler im Fetisch-Club verschnüren
Deswegen - und weil sie in der Ausstellung wirklich kaum eine Rolle spielen - zeigen wir anstelle einer von Arakis gefesselten jungen asiatischen Frauen hier lieber einen von einer Frau gefesselten mittelalten europäischen Mann.

Dieses Bild stammt aus der jüngsten Arbeit des Berliner Künstlers Christian Jankowski. Er hat sie soeben in Japan zum ersten Mal gezeigt, und sie dreht eigentlich fast alles, was man Araki vorwirft, um, hat davon abgesehen aber nur indirekt mit ihm zu tun.
Sie heißt "Traveling Artist" und verdankt sich Jankowskis Gefühl, als vielreisender Künstler von den jeweiligen Erwartungen an seine Auseinandersetzung mit vorgefundenen Kulturkontexten regelrecht eingeschnürt zu werden, gleichzeitig als Handlungsreisender seiner Kunst oft genug ohne festen Boden unter den Füßen im Ortlosen zu taumeln. Auch ihn trieb dieses innere Empfinden zum äußeren Abbild über den Körper. Von der Fetisch-Technik des Kinbaku-bi wusste er allerdings nicht erst durch die Fotos von Araki. Es sei vielmehr geradezu ein Klischee, das man mit Japan verbinde, sagt Jankowski der SZ. Also typisches Material für ihn.
Er hatte den Fetisch-Club in Kyoto bei einem Japan-Aufenthalt kurz vor der Abreise besucht, auf dem Weg zum Flughafen, im Reiseanzug und mit Rollköfferchen, und sich dort komplett der Fessel-Fachfrau überlassen. Sein Auftrag an sie lautete: Er und alles, was er dabei hat, muss unter die Decke. Ihre Forderung an ihn hieß: Hose ausziehen. In ihrem Club verkehrten Geschäftsmänner, die immerhin viel Geld dafür bezahlten, hier erotisch unterhalten zu werden. Ob die etwas windelartig aussehende Unterhose, die Jankowski von der Fesselkünstlerin verordnet wurde, diesem Zweck zuträglich war, können nur die japanischen Geschäftsmänner beantworten, die, sagt Jankowksi, aber ohnehin etwas überrascht waren, auf einmal einen blonden Deutschen über sich baumeln zu sehen. Für ihn selbst habe es sich zuerst erheiternd angefühlt, dann beängstigend; gegen die Klaustrophobie helfe aber reden. Dass sein Reden leider von niemandem im Raum verstanden wurde und auch der Dolmetscher kein wirklich zuverlässiges Englisch sprach, führte wiederum zu einem Panikanfall. Das Hängen selber und das Gedrehtwerden sei heikel, weil nur mit der richtigen Fesseltechnik keine Blutbahnen und Nerven abgeklemmt werden. Den Schwebezustand selbst habe er als bereichernd erfahren - und den Zustand danach, nach der Entfesselung sozusagen, als euphorisiert und gleichzeitig entspannt. Er würde es wieder machen, sagt er, und er würde es jedem empfehlen.