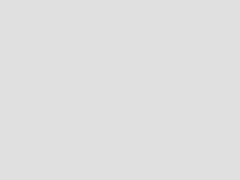Der Katalog ist im Druck und auch die Kunst in vielen Räumen und Kabinetten fertig gehängt: So eine gewaltige Ausstellung wie "Forever Young" zum zehnjährigen Bestehen des Museums Brandhorst ist nicht nur Feier, sondern auch Risiko. Achim Hochdörfer ist seit 2013 der Direktor des Museums, das jetzt die Ankäufe der vergangenen Jahre präsentiert. Der Ankaufsetat des Museums gilt als unvergleichlich in Zeiten, in denen alle öffentlichen Häuser erhebliche Kürzungen hinnehmen müssen. Nur wenige Kunsthistoriker können in Europa noch so arbeiten wie Hochdörfer, der sich darüber freut, wie jung Cy Twomblys Meisterwerke in Gesellschaft von frühen Selbstporträts von Albert Oehlen und Amy Sillman wirken.
SZ: Stimmt es, dass Sie in den vergangenen 10 Jahren mehr als 500 Werke angekauft haben?
Achim Hochdörfer: Das ist gut möglich. Der Vertrag, den Udo Brandhorst nach dem Tod seiner Frau Anette im Jahr 1999 mit dem bayerischen Staat geschlossen hat, ist von unvergleichlicher Großzügigkeit. Neben der Sammlung schenkten die Brandhorsts auch ihr Vermögen und sicherten so den Etat über Jahrzehnte hinaus ab. Die Öffentlichkeit profitiert davon, dass uns jährlich drei bis vier Millionen Euro für Ankäufe zur Verfügung stehen.
Das ist mehr, als jedes andere deutsche Museum hat.
Ja, das ist durchaus außergewöhnlich. Abgesehen von Häusern wie dem Museum of Modern Art in New York und der Londoner Tate Gallery tun sich öffentliche Institutionen zunehmend schwer. Und das in Zeiten, in denen der Kunstmarkt boomt und die Preise sich vervielfachen. Dank der Brandhorst-Stiftung ist es sogar gelungen, ein paar Lücken in der Sammlung zu schließen. Ein Beispiel ist Wolfgang Tillmans, von dem wir seine erste Rauminstallation, insgesamt sechzig Arbeiten, erworben haben. Einen neuen Schwerpunkt konnten wir mit dem Ankauf von zwanzig Arbeiten von Albert Oehlen setzen.
Das klingt, als hätte die Sammlung in Bezug auf die Gegenwart viel nachzuholen.
Anette und Udo Brandhorst sind in den frühen 1970er-Jahren in die Kölner Kunstszene eingetaucht und haben eine großartige Sammlung der Neo-Avantgarde aufgebaut: Minimal, Pop, Arte Povera und Konzeptkunst. Anette und Udo Brandhorst kauften dann in den Achtziger- und Neunzigerjahren konsequent weiter. Und so kamen früh Werke von Cady Noland, Mike Kelley, Christopher Wool und Robert Gober dazu, deren Preise heute in die Millionen gehen und deshalb für öffentliche Häuser nicht mehr erschwinglich sind. In den vergangenen Jahren ist es uns nun gelungen, die Sammlung bis in die Gegenwart zu verjüngen und zu erweitern.
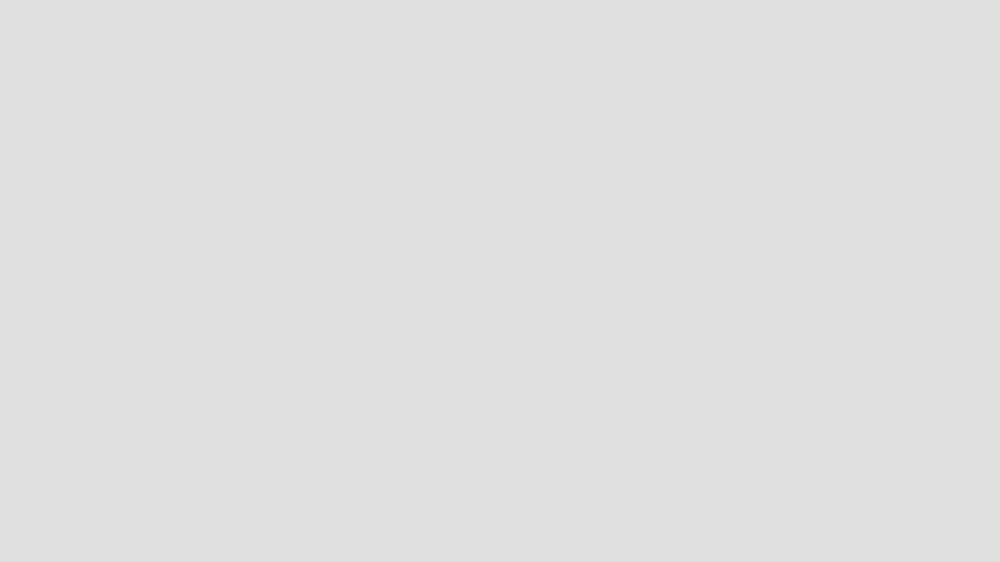
Wobei der Schwerpunkt nicht nur auf amerikanische und westlich geprägte Malerei beschränkt war, sondern vor allem auch auf männliche Positionen .
Es stimmt, wie in vielen anderen Museen waren Frauen in einer Weise unterrepräsentiert, die im Rückblick erstaunlich ist. Mittlerweile sind jedoch zahlreiche Künstlerinnen bei uns vertreten, darunter so bedeutende Namen wie Amy Sillman, Kerstin Brätsch, Jutta Koether, Charline von Heyl, Nicole Eisenman oder Laura Owens.
Immer noch wirkt die Sammlung westlich und weiß.
Es genügt nicht mehr, unseren westlichen Kanon feigenblattartig mit ein paar nicht-westlichen Positionen zu garnieren. Eine Ausstellung wie El Anatsui im Haus der Kunst ist ein Blockbuster, der mehr Besucher als viele deutsche Künstler anzieht. Unsere westliche Perspektive auf die Kunstgeschichte wird zunehmend von alternativen Darstellungen herausgefordert. Mit Arthur Jafa zeigen wir in unserer Jubiläumsausstellung einen der wichtigsten afroamerikanischen Künstler der letzten Jahrzehnte.
Heute sind viele Künstlerinnen - von Ana Mendieta bis Maria Lassnig - auch nicht mehr einfach zu bekommen, oder?
Unser Weltbild ist komplizierter geworden, und so wurden in den letzten Jahren auch viele Künstlerinnen, die bislang nicht in das Schema der Kunstgeschichte gepasst haben, wiederentdeckt. Die Galerie Hauser & Wirth hat ein Geschäftsmodell daraus gemacht, das Werk vergessener Künstlerinnen aufzuarbeiten, in den Kanon zu integrieren und teuer zu verkaufen.
Die Galerien werden so immer mächtiger im Verhältnis zu Museen, die traditionell die Hüter von Nachlässen waren.
Viele Galerien geraten durch den sich globalisierenden Kunstmarkt und die damit zusammenhängenden Konzentrationsprozesse unter Druck. Diese Entwicklung kann sich zu einer echten Krise auswachsen, das ganze Galeriensystem steht zur Disposition. Das ist ein Problem, weil es traditionell die Galeristen waren, die junge Künstler aufbauten, betreuten, ihre Archive pflegten und Ausstellungen vermittelten. Die Sogwirkung, die von den globalen Playern ausgeht, ist gewaltig.
Die Folge der Konzentration von Kapital in den Händen weniger Superreicher ist im Bereich der Kunst, dass ein Francois Pinault, ein Bernard Arnault oder ein Eli Broad ihre Kunst mit viel Geld und Marktmacht durchsetzen wollen.
Es ist eine der spannendsten Fragen unserer Zeit, ob und, wenn ja, wie sich die Sammlungen von Pinault in Venedig, Arnault in Paris oder die Jumex Collection in Mexico City auf Dauer institutionalisieren werden. Das Gleiche gilt für große Galeristen, von denen einige ja bereits offen über ihr Erbe nachdenken. Marian Goodman hat gerade den früheren Direktor des Kölner Ludwig-Museums Philipp Kaiser zu ihrem Nachfolger ernannt. Einen ganz anderen Weg schlägt dagegen Larry Gagosian ein. Nach dem Modell von Amazon baut er gerade eine umfassende Vertriebsstruktur auf, die von der Beratung über Kauf, Transport und Lagerung alle Aspekte des Kunstkaufs unter einem Dach vereint.
Die meisten großen Kunstmuseen wurden gegründet, um solche Sammlungen aufzunehmen.
In der Vergangenheit waren fürstliche und private Sammlungen darauf angewiesen, dass die Öffentlichkeit irgendwann die Verantwortung übernimmt. So wie bei uns oder bei der New Yorker Sammlung der Guggenheims. Umgekehrt muss man sich fragen, ob heute nicht ein Iwan Wirth sogar eher in der Lage ist, eine Institution zu stemmen, als eine verarmte Stadtkasse. Wenn sich nicht einmal das Metropolitan Museum mehr ein Gebäude wie das Met Breuer leisten kann.
Wer wird dann das Korrektiv sein ?
Die Frage wird sein, ob es den neuen Institutionen gelingt, auch eine überzeugende wissenschaftliche und inhaltliche Arbeit zu leisten. Dazu gehört ein institutioneller Apparat, der auf Dauer gesichert ist und unabhängig agieren kann. Im Moment sehe ich die diskursive Autorität immer noch bei den öffentlichen Häusern. Deshalb halte ich die Struktur des Museums Brandhorst für einen Glücksfall. Der Staat garantiert den Betrieb und die wissenschaftliche Aufarbeitung der Sammlung, während die Stiftung eine strategische Ankaufspolitik ermöglicht. Aber angesichts der enormen Veränderungen verändert sich die Kunstgeschichtsschreibung selbst.
Inwiefern?
Ein Symptom des Umbruchs liegt doch schon allein darin, dass wir gar keinen Namen mehr für die Stile und Tendenzen der Kunst unserer Zeit haben. Noch bis in die Neunzigerjahre hinein tobte geradezu ein Wettstreit: Wer erfindet den neuesten Stil, wer gibt einer Dekade ein Thema vor? Während schon Anfang der Achtzigerjahre die Wiederkehr der Malerei ausgerufen wurde und zu Beginn der Neunzigerjahre die Institutionskritik, sind solche Bestandsaufnahmen seit der Jahrtausendwende ausgeblieben. Es gibt keine Ismen mehr.
Vielleicht auch, weil Kunst stellvertretend für andere öffentliche Bereiche erst einmal politische Forderungen erfüllt? Weil sie Frauen kanonisiert, Kontinente erschließt und Randgruppen integriert?
Völlig richtig. Hinzu kommt die Digitalisierung. Obwohl die ständige Verfügbarkeit von Bildern gewaltige Auswirkungen auf unsere Wahrnehmung hat, bewegen wir uns keineswegs in einem geschichtsfreien Raum. Es war deshalb auch richtig, dass die Tate Modern bei ihrer Eröffnung einmal damit Schluss gemacht hat, die Kunstgeschichte nur chronologisch zu erzählen. Es muss uns heute gelingen, Kunstwerke so zu kombinieren, dass wir ihre existenziellen und gesellschaftlichen Potenziale immer wieder neu zum Sprechen bringen.