Bücher und Artikel darüber, dass die Demokratie vor ihrem Niedergang und Zerfall stehe, gibt es genug. Und jeden Tag werden es mehr. So luzide wie das neue Werk "Krisen der Demokratie" des hierzulande viel zu unbekannten, auch in seinem einundachtzigsten Lebensjahr noch putzmunter an der New York University lehrenden Politikwissenschaftlers Adam Przeworski gibt es aber notorisch viel zu wenige. Wobei besonders eindrucksvoll ist, wie es Przeworski unter Rückgriff auf empirische Studien gelingt, ein methodisch extrem gewissenhaftes Grundlagenwerk zu Geschichte und Gegenwart der Krisen der Demokratie zu entfalten, in dessen Mittelpunkt dennoch immer wieder die essayistisch tastende Überzeugung steht, dass wir uns in gefährlichen Zeiten vor allem erst einmal darüber klar werden müssten, was wir alles nicht wissen, bevor wir entscheiden können, was wir tun sollen.
Allzu einfachen Kausalitäten - Wirtschaftskrise! Neoliberalismus! Ungleichheit! Rechtsruck! - und leichtfertigen historischen Analogien steht er skeptisch gegenüber, betont eher die Macht des Zufalls in der Geschichte. Und er vergisst nie, dass die Demokratie als Regierungsform menschheitsgeschichtlich jung und immer noch außergewöhnlich ist. Zwischen 1788 und 2008 sei die Macht auf der Welt 544-mal durch Wahlen, aber auch 577-mal durch einen Umsturz in andere Hände übergegangen.
Zwei ernüchternde, aber nach der Lektüre zwingend realistisch erscheinende Schlussfolgerungen Przeworskis stechen hervor: Einmal die historische Lehre, dass "Demokratien keine institutionellen Mechanismen aufweisen, die sie davor schützen, von einer rechtmäßig gewählten Regierung, die sich an die konstitutionellen Regeln hält, untergraben zu werden". Das war einst bei Hitler so, aber auch der derzeit in Polen herrschenden PiS-Partei sei es gelungen, schrittweise das parlamentarische Verfahren für die Einbringung von Gesetzesvorlagen der Regierung so zu ändern, das sie keiner öffentlichen Anhörung mehr unterzogen werden müssen.
Es ging darum, die Regierung für die Eliten vor den Armen zu schützen
Andererseits hänge, so Przeworski, in der Demokratie alles davon ab, ob Personen, "denen die Demokratie am Herzen liegt, die langfristigen Auswirkungen bestimmter Schritte voraussehen" - oder nicht. Das klingt trivialer, als es im laufenden politischen Prozess ist. Um sich heute gegen eine Regierung zu erheben, die "irgendwann in der Zukunft möglicherweise die Demokratie zerstören wird", müssten Menschen, die gegenwärtig von der Politik dieser Regierung profitierten (er denkt dabei etwa an die Türkei Erdogans bis 2014 oder Venezuela bis 2011), die langfristigen Auswirkungen dieser Politik erkennen. Die große Gefahr für die Demokratie sei, dass sie "unbemerkt erodiere".
Der folgende Abschnitt, in dem Przeworski das Albtraumszenario einer legalen Abschaffung der Demokratie in den USA skizziert, ist ein furchterregend plausibles Meisterstück so eiskalter wie tiefenscharfer spekulativer Politikwissenschaft. Die Bedeutung von Bidens Sieg erscheint danach noch einmal in einem vollkommen anderen Licht. Wobei die kühle Pointe am Ende genügend Raum für zukünftige Beunruhigungen lässt: auch nach der Abwahl von demokratiefeindlichen Populisten bleibe die große historische Hypothek unserer repräsentativen Regierungssysteme mit demokratischen Wahlen bestehen. Die Tatsache nämlich, dass sie "aus der Angst vor der Partizipation der breiten Bevölkerungsmasse" entstanden, die "zu einem Großteil aus Armen und Analphabeten" bestand. Man komme, so Przeworski furchtlos umsichtig, der Wahrheit ziemlich nahe, wenn man annehme, "dass das strategische Problem der Gründerväter fast überall darin bestand, wie sie die repräsentative Regierung für die Eliten errichten und vor den Armen schützen" konnten.
"In der Demokratie geht es darum, mit Niederlagen klarzukommen"
Eine gute Ergänzung zu diesen Überlegungen zur vermeintlichen oder tatsächlichen Neuheit der politischen Situation ist das Buch "Lüge und Täuschung in den Zeiten von Putin, Trump & Co." des bis 2017 an der RWTH Aachen lehrenden Politologen Helmut König. Ihm geht es weniger um die Spaltung als um die Spalter, wobei aber auch hier der Ausgangspunkt ist, was nun historisch gerade wirklich beispiellos sein könnte, denn auf die eine oder andere Weise gelogen und getäuscht wurde in der Politik ja doch immer schon.
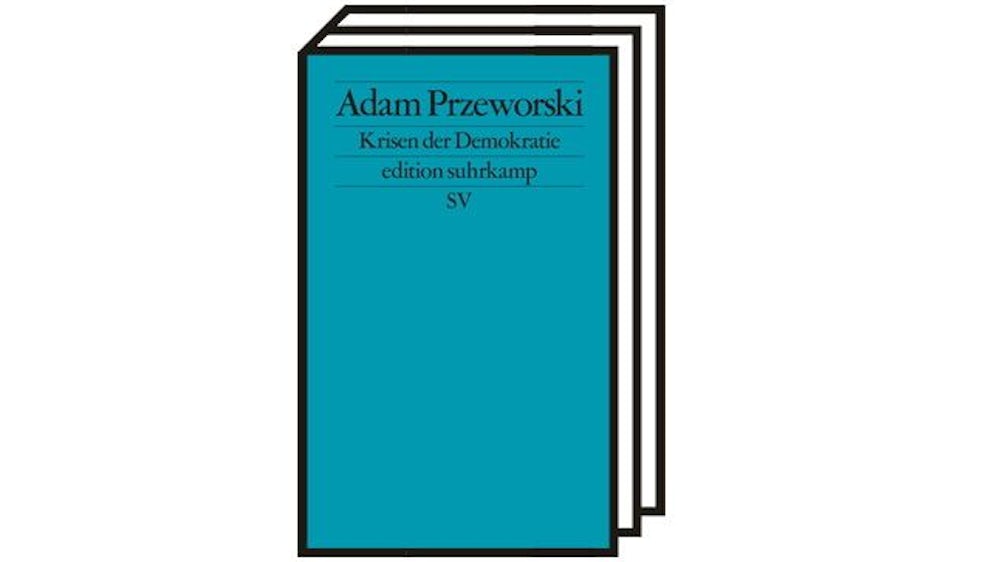
Adam Przeworski: Krisen der Demokratie. Aus dem Englischen von Stephan Gebauer Suhrkamp Verlag, Berlin 2020. 256 Seiten, 18 Euro.

Helmut König: Lüge und Täuschung in den Zeiten von Putin, Trump & Co. Transcript, Bielefeld 2020. 360 Seiten, 30 Euro
Den Umgang mit dem Lügen von Mächtigen wie Trump und Putin stellt für König eher in dem Sinn etwas kategorisch Neues da, als sie es systematisch als zentrales Mittel ihrer Politik einsetzen und dennoch - oder gerade deshalb - offenkundig gegenüber weiten Teilen ihrer Bevölkerungen plausibilisieren können. Nur jeder auf seine Weise.
Putin, so König, lüge, um fortwährend Verwirrung und Ungewissheit zu schaffen, "so dass eine rationale öffentliche Selbstverständigung über die politische Lage und die aus ihr zu ziehenden Konsequenzen gar nicht erst entstehen" könne.
Trumps Lügenpraxis sei dagegen eine Art Lackmustest auf Treue und Ergebenheit, daher auch die ungewöhnlich vielen Entlassungen in seiner Amtszeit. Sie waren und sind weniger der emotionalen und intellektuellen Instabilität von Trumps Charakter geschuldet. Sie sind vielmehr die logische Folge eines Politikstils, der darauf fußt, dass sich Komplizen ständig versichern müssen, dass sie noch Komplizen sind. Gemeinsame Grundlage wiederum ist die alle Demokratie zersetzende Überzeugung, dass die Politik kein Projekt ist, das Bürger prinzipiell eint, sondern ein "Schlachtfeld", auf dem sich "immer und überall nur die Starken" durchsetzen. Allenfalls die Gründe für den Anteil, den der Westen selbst daran hat, dass seine Politik in vielen Weltgegenden auch so wahrgenommen wird, wenn ungleich integerere Politiker wie Barack Obama oder Angela Merkel an der Spitze stehen, kommt in beiden Bücher womöglich etwas zu kurz. Es fiele allerdings auch wenige in die Politologie als in die Ideologiekritik.
Und was bliebe nun also zu sagen zur Lage der Demokratie? In seinem jüngsten Buch "Demokratie und Emotion - Was ein demokratisches Wir von einem identitären Wir unterscheidet" erinnert der deutsche Theologe und Philosoph Jürgen Manemann am Ende daran, dass die Demokratie ein Versprechen sei, das sie selbst nicht halten könne. Er meint damit den Umstand, dass sie wesenhaft nicht der goldene Weg zur Lösung aller Probleme ist, sondern vielmehr in erster Linie ein Wir-Ereignis, um nicht zu vergessen, dass sich um die Lösung von Problemen gemeinsam gekümmert werden muss. Oder - mit Jürgen Kaube - nüchterner gesagt: Das Wesen der Demokratie ist das "Abfangen von notorisch irrtumsanfälligen, aber ständig verlangten Entscheidungen". Nicht mehr, nicht weniger.
Ist die Demokratie ein Versprechen, das sie selbst nicht halten kann?
Przeworskis Hinweis, dass es in der Demokratie in erster Linie darum gehe, mit Niederlagen klarzukommen, ist deshalb für den Moment, den wir gerade erleben, von kaum zu überschätzender Bedeutung. Der Politologe ist der Ansicht, dass wir gerade Zeuge einer "tief greifenden Veränderung" werden, über die wir nicht verzweifeln sollten. Wir hätten aber auch "wenig Grund zu Optimismus". Mit Verweis auf Julia Azari sieht er die politsche Gegenwart des Westens von einer "intensiven Parteilichkeit mit schwachen Parteien" geprägt. Mit demokratischen Parteien könnten Konflikte jedoch nur dann dauerhaft friedlich beigelegt werden, wenn es den politischen Parteien gelinge, diese Konflikte zu strukturieren und politische Maßnahmen in Wahlen zu kanalisieren. Wofür sie besser nicht schwach, sondern stark sein sollten. Stark sind sie allerdings nur, wenn es ihnen gelingt, das Alltagsleben der Bevölkerungsmehrheit zu verbessern, was Przeworski in den USA und Europa in naher Zukunft für unwahrscheinlich hält. Die Unzufriedenheit mit "System" und "Establishment" werde in der Folge daher eher größer als kleiner. Was die Zukunft anbelangt sei er dementsprechend "moderat pessimistisch", in den meisten westlichen Ländern steht seiner Ansicht nach zwar nicht die "Demokratie an sich" auf dem Spiel, er kann allerdings auch "nichts erkennen, was uns von der gegenwärtigen Unzufriedenheit befreien würde". Heute die Demokratie zu lieben, heißt also höchstens, das wachsame Verlieren zu lernen? Tja, mit Przeworskis neuem Buch kann man in diesem Sinn immerhin die Demokratie gegen ihre falschen Freunde verteidigen. Und zwar nicht nur gegen die bösen falschen Freunde von rechts, die die Demokratie nur brauchen, um an die Macht zu kommen und sie dann abschaffen zu können, sondern auch gegen die allzu eigenbrötlerisch-idealistischen guten falschen Freunde von links, die "Institutionen stützen, aber Mehrheiten verachten", wie der Verfassungsrechtler und Politiktheoretiker Christoph Möllers einmal die emotionale Grundeinstellung von Wählern der Grünen skizzierte.
Jede und jeder, die oder der künftig informiert über die Krise der Demokratie nachdenken will, sollte "Krisen der Demokratie" gelesen haben.