Enoch zu Guttenberg hat viele große Auftritte gehabt im Leben. Seinen womöglich größten aber konnten seine Bewunderer im März 2011 beobachten, nur ein paar Schritte entfernt vom Schloss derer zu Guttenberg in jenem fränkischen Dorf, das den Namen des Dirigenten trägt: Guttenberg. Der Mann, den sie dort den "Baron" nannten, konnte sein Leben lang nichts mit halbem Herzen tun, schon gar nicht irgendwo auftreten. Er wirkte immer angefasst, von dem, was er tat. Kaum je aber dürfte er so angefasst gewesen sein wie an jenem Samstag im Spätwinter 2011, seinem vielleicht spontansten Auftritt.
Beobachtern wird ein unwirkliches Bild in Erinnerung bleiben. Der damals 64-Jährige hatte eigentlich vom Oberfränkischen aus nach Süden aufbrechen wollen an diesem Tag, in seine zweite Heimat in Oberbayern. Als er aber vor die Schlossmauern fuhr, stand da diese Menge von Menschen aus seinem Heimatort, viermal mehr, als das Dorf Einwohner hat. Eine solche Menschenmenge hatte dieser Ort noch nicht gesehen in seiner 750-jährigen Geschichte: eine Art Dorfdemonstration zugunsten eines schwer taumelnden Bundesministers, des Sohns von Guttenberg. Die Menschen trugen Transparente in den Händen und riefen "Herr Baron, Herr Baron".
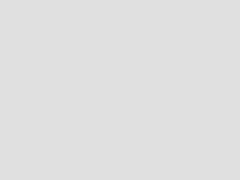
An der Plagiatsaffäre knabbert die Familie von Ex-Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg weiterhin. Nun meldet sich der Vater des CSU-Politikers zu Wort. In einem Interview-Buch spart er weder mit Lob für seinen Sohn, noch mit Kritik an den Medien.
Guttenberg ist zunächst vorbeigefahren, bevor er sich entschied, noch mal zurückzukehren. Der Vater des Mannes, der damals noch Bundesverteidigungsminister war, hat etwas loswerden wollen an diesem Tag. Erst machte er sich Notizen, über das, was die Leute da auf ihre Plakate geschrieben hatten: "Ohne KT, Deutschland ade" und "Ein Guttenberg tritt nicht zurück. Er nimmt nur Anlauf." Als dann die "Herr Baron, Herr Baron"-Rufe immer lauter wurden, stieg Guttenberg, einem römischen Volkstribun nicht unähnlich, auf einen Traktoranhänger. Sagte zunächst: "Ich bin doch der Falsche." Und hielt dann eine Philippika gegen Medien, die seinen unter Beschuss geratenen Sohn Karl-Theodor angeblich viel zu gröblich anfassten.
Wer Guttenberg kannte und sich nicht nur in den pathetischen Momenten seines Lebens mit ihm austauschte, der wusste, dass dieser Mann viel zu intelligent war, um nicht zu wissen, dass sein Sohn bestimmt nicht zu Unrecht kritisiert wurde. Niemand anders dürfte mehr unter der Affäre Guttenberg gelitten haben, als er, der Vater. Und natürlich wusste Guttenberg in dem Moment, dass der Jubel der dörflichen Verehrer seines Sohnes ihm gewiss sein wird; dass er in der Öffentlichkeit aber hart angegangen werden würde für seine polemischen Worte von einem Traktoranhänger herab. Das aber war Guttenberg in dem Moment egal. Ein Vater wirft sich vor den Sohn, wenn der im Sturm steht. Auch wenn er selbst überzeugt davon ist, dass der Sohn Mist gebaut hat.
Wenn es sein musste, konnte Guttenberg ein Don Quijote sein
Gegen den Strom zu schwimmen, war etwas, das Enoch zu Guttenberg mit Überzeugung tat. So sehr er angewiesen war auf Applaus, so sehr fürchtete er auch den Gegenwind nicht. Das war schon so, als er 1975 den Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland mitgründete - damals beileibe noch keine Einrichtung, die auf allgemeine Zustimmung hoffen durfte. Als die ihm dann für seinen Geschmack zu vehement für Windräder eintrat, brach er mit alten Öko-Freunden und duellierte sich sogar vor Gericht mit ihnen. Wieder konnte er kaum auf allgemeinen Applaus hoffen. Und das Argument, dass da offenbar nur einer gegen die angebliche Verschandelung der Natur durch Windräder wettere, weil diese dem dirigierenden Herrn Baron rein ästhetisch nicht in seine reichhaltigen Waldgebiete in Oberfranken passten - dieses Argument konnte er sich auch vorher ausmalen. Er kämpfte trotzdem gegen die Windmühlen. Wenn es sein musste, konnte Guttenberg ein Don Quijote sein. Und war es gern.
"O Gott, der Bub wird Künstler!" Das war der Schreckensschrei in der Familie, die mit dem Bub anderes vorhatte; er sollte den Familienbesitz verwalten. Er aber übernahm 1967, mit gerade mal 21 Jahren, lieber die Chorgemeinschaft Neubeuern. Ein Zufall, Guttenberg lebte gerade in dem idyllischen oberbayerischen Ort, studierte Musik, der Dirigent fiel aus, er sprang ein und acht Jahre später sang die Laientruppe zum ersten Mal in München, in den Achtzigerjahren folgten internationale Tourneen bis nach Südamerika. Aus der Chorgemeinschaft war ein Spitzenensemble geworden, die Bierkästen, auf denen man 1967 noch währen der Proben saß, waren längst verschwunden. Mittlerweile hat der Chor Asien bereist, die USA, sang in der Carnegie Hall.
In Neubeuern war er nie der Baron, da war er der Enoch oder der Guttei. Dort konnte er auch die Stimmen der Neider vergessen, die ihm den Reichtum der Familie vorwarfen - solle er doch das von ihm im Jahr 2000 gegründete und bis zuletzt geleitete Herrenchiemsee-Festival aus eigener Tasche bezahlen, tönten die Ignoranten. Aber Guttenberg war gesegnet mit einer großen Unlust, die Dinge einfach hinzunehmen. Ein familiäres Erbe. Die Großeltern waren im Widerstand gegen Hitler involviert, ein Großonkel wurde nach Stauffenbergs Attentat hingerichtet, der Vater stand vor dem Kriegsgericht, weil er sich als 19-Jähriger weigerte, während des Polenfeldzugs Juden zu erschießen. Ein besonders aufwühlendes Konzerterlebnis war für Enoch zu Guttenberg, als er 2010 Schostakowitschs 13. Symphonie dirigierte. Diese trägt den Titel "Babi Jar", den Namen einer Schlucht am Rande von Kiew, wo SS und Wehrmacht 1941 Zehntausende Juden massakrierten.
Natürlich war Guttenberg einer der Ersten, der den Echo-Preis zurückgab, aus Protest gegen die Verleihung des Preises an die beiden umstrittenen Rapper. Er hatte ihn für eine Einspielung von Bruckners vierter Symphonie erhalten, zusammen mit dem Orchester, das er 1997 gegründet und nach eigenen Maßstäben geformt hatte, der Klangverwaltung. Deren Beginn war durchaus disparat, doch bald wuchs das Orchester zusammen, tourte mit ihm und auch ohne Chor. Immer dabei der natürlich bewusst gewählte Name, aufreizend bürokratisch, im größten Kontrast zu Guttenbergs eigener Auffassung von Musik. Immer wieder und immer wieder neu konnte man über Jahrzehnte hinweg diese Auffassung erleben bei Guttenbergs Interpretationen der großen Oratorien Johann Sebastian Bachs.

An was erinnert sich eine Gesellschaft und was vergisst sie? Es sind sehr aktuelle Fragen, die die Kulturwissenschaftler Aleida und Jan Assmann in ihren Schriften stellen.
Seine spirituelle Leidenschaft ist hierbei immer unabdingbarer geworden. Weit mehr als 100 Mal hat er Bachs Passionen dirigiert, unermüdlich an der Interpretation gefeilt, Wissen um die Historie mit extremer Leidenschaft verknüpft, und doch, wenn man im vergangenen Jahr zur Eröffnung der Herrenchiemsee-Festspiele Guttenberg, die Klangverwaltung und die Chorgemeinschaft im Münster von Frauenchiemsee erlebte, da hatte man das Gefühl, da habe einer eben ein Werk, das ihn bis auf den Urgrund der eigenen Existenz erschütterte, für sich entdeckt. Enoch, der Unabdingbare, machte in der "Johannespassion" den darin enthaltenen Antisemitismus Martin Luthers spürbar, begann das Werk als nervöses Mysterium, als eine Schöpfung, die zur Katastrophe oder zum Hymnus führen könnte. Und als die Spannung im Orchester annähernd unerträglich wurde, explodierte der Chor in einem Wort: "Herr!" Ein musikdramatisches Erlebnis.
Enoch zu Guttenberg wurde oft als "Bekenntnismusiker" bezeichnet
Enoch zu Guttenberg war nicht gläubig im Sinne eines naiven, kirchlichen Verständnisses. Er war ein spiritueller Humanist, allerdings einer, der vor Leidenschaft barst. Nicht nur war sein Frack nass nach jedem Konzert, auch war sein Geist scharf in jedem Gespräch. Er war einer, der Sätze sagen konnte, die bei fast jedem anderen völlig irrsinnig wirken würden: "Wenn ich an den Irakkrieg denke, weiß ich, wie ich das Ende von Verdis Requiem zu dirigieren habe." Oder, etwas milder, zur Frage, ob dieses Requiem Verdis Oper oder geistliche Musik sei: "Es geht um die zerrissene Auseinandersetzung eines Atheisten mit seinem alten Gott." Guttenberg meinte Verdi, nicht sich selbst.
Mit neuer Musik tat er sich schwer, er fand darin einfach nicht die "Größe der Menschlichkeit", wie er sie bei Bach, Bruckner, Beethoven fand. Enoch zu Guttenberg wurde oft als "Bekenntnismusiker" bezeichnet, was ihn selbst amüsierte. Er verneinte diese Bezeichnung für sich, erklärte anhand von Bruckner auch, warum: "Aus meiner Sicht ist Bruckner ein ganz großer Bekenntnismusiker. Er ist der große kleine liebe Gott von einem großen kleinen Mann. Oder umgekehrt, von einem kleinen großen Mann der kleine liebe Gott. So ungefähr."
Am Freitag ist Enoch zu Guttenberg überraschend gestorben, im Juli wäre er 72 Jahre alt geworden. Er hinterlässt vier Kinder. Und ein kompromissloses Eintreten für die Musik. Er wird fehlen, da helfen weder die CDs noch seine Briefe hinweg.
