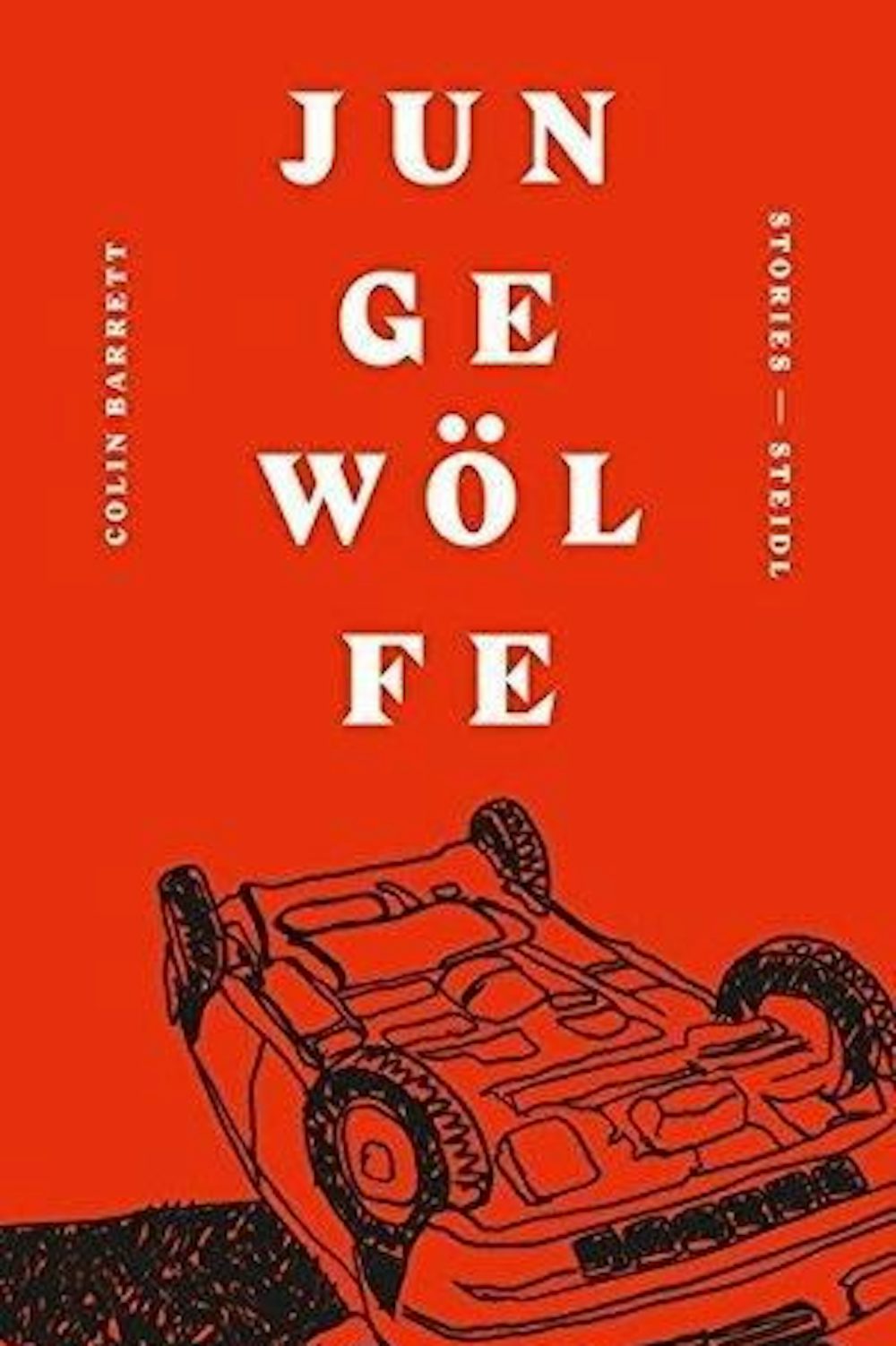Der eher schmächtige Dympna versorgt seine Kleinstadt mit Marihuana. Sieh dich vor, sonst leg ich meinen Arm um dich, sagt er zu Leuten, die ihm blöd kommen, und mit Arm meint er seinen Leibwächter Douglas Armland. Arm war mal Boxer und den Grund, warum er das Boxen aufgegeben hat, erklärt er so: Sie müssen Leuten wehtun wollen. Das ist der Antrieb. Dauernd müssen sie Leuten wehtun wollen. Arm hat einen fünfjährigen behinderten Sohn, den er manchmal zu seiner Reittherapie begleitet. In der Geschichte "Ruhig mit den Pferden" geht ein Pferd plötzlich durch, mit dem kreidebleichen Arm auf dem Rücken. Der Titel der Geschichte täuscht. Am Ende werden die Kleinstadtganoven durchdrehen, und eine filmreife Spirale der Gewalt wird drei Tote produzieren. Der junge irische Autor Colin Barrett, der mit dem Erzählband "Junge Wölfe" sein gelungenes Debüt hinlegt, stammt aus der Grafschaft Mayo. Seine sieben Geschichten, im Originaltitel "Young Skins", spielen eben dort, im Nordwesten Irlands: Der Atlantik, das zerklüftete Kinn des Küstensaums mit seinen von Möwen heimgesuchten Felsvorsprüngen, ist nah. Es ist eine wilde, etwas herbe Landschaft, aber diese jungen Wölfe, die auf der Suche nach irgendetwas, nach Liebe oder wenigstens Sex, über Straßen und leere Parkplätze, Tankstellen und durch alkoholgeschwängerte Pubs und Clubs streifen, haben oft keinen Sinn für die Schönheiten der Natur. Ich bin jung, und von uns Jungen gibt es hier nicht viele, aber ich übertreibe nicht, wenn ich sage, die Stadt gehört uns, sagt jemand in der ersten Geschichte vertraulich. Sie sind Türsteher oder Kleinstadtganoven, und oft erfahren wir gar nichts über ihre Jobs, nur dass sie in Kneipen rumhängen, eimerweise Guinness trinken, geschickt Billard spielen und irgendwelchen Mädchen nachtrauern, die sich längst abgeseilt haben.
"Galway ist nicht weit", sagt jemand, "aber für Dich könnte es auch der Mond sein."
Ein Gegenstück zu der actiongetriebenen, sehr langen Erzählung im Drogenmilieu ist die kurze, aber atmosphärisch ebenso starke Story "Der Mond". Sie spielt - in sehr gemächlichem Erzähltempo - in einem phlegmatischen namenlosen Nest an einem namenlosen Fluss. "Galway ist zwar nicht so weit weg", sagt Martina Boran zu Val, die wie sie in der Peacock Bar arbeitet, "aber für Leute wie dich könnte es auch der Mond sein". Martina studiert in Galway, die Arbeit in der Bar war nur ein Sommerjob für sie, die Bettgeschichte mit Val nur ein Intermezzo. Doch Val, der dort als Chef-Türsteher arbeitet und diesen Chef gegenüber den noch nicht volljährigen, aber erlebnishungrigen Teenagern auch gern mal raushängen lässt, hat sonst nicht viel gelernt, und damit stehen seine Chancen, das kleine Nest zu verlassen, gleich null. Galway ist für ihn tatsächlich so unerreichbar wie der Mond. Es ist eine kleine, grausame Geschichte.
Die jungen Wölfe schweigen viel, besonders über ihre Gefühle, wovon sie reichlich haben, und wenn sie reden, dann in einem coolen Slang der Straße, mit kleinen Tupfern ironischer Selbstreflexion. Von diesem manchmal auch groben Ton hebt sich die erzählende Stimme, die wie in "Der kleine Clancy" auch der unglückliche "Held" der Story sein kann, sprachmächtig ab, nuanciert bis in feinste Verästelungen.
Oft entspinnen sich von Pausen gesäumte Gespräche, in denen das Entscheidende ungesagt bleibt. Und häufig macht sich der erzählende Beobachter, der alles weiß, aber nicht alles preisgibt, über seine jungen Wölfe lustig. Oder sie besorgen das selbst: "Lass gut sein, Tug, will ich sagen, aber ich sage nichts. Eigentlich besteht Freundschaft genau darin: nichts zu sagen, statt etwas zu sagen." Oft scheinen diese Freundschaften unter den schweigsamen jungen Männern tiefer als die unentschlossenen und tristen Bettgeschichten.
Auch in "Der kleine Clancy" geht es um ein geheimnisvolles Band zwischen zwei jungen Männern: zwischen dem erzählendem Ich, smart, ironisch, auch durchaus lebenserfahren, und seinem Freund Tug, einem Riesenbaby mit Bärenkräften, dessen Äußeres Marlon Brando in "Apocalypse Now" nachempfunden ist. Auch hier hat sich ein Mädchen abgeseilt, von einem anderen Mann schwängern lassen. Die Tätowierung einer Sonnenuhr ziert Marlenes inzwischen wieder windhundstraffes Bäuchlein. Hardcore, sagt Tug ergriffen über die Gefühle seines Freundes, der sich schnoddrig über seinen Schmerz hinwegschummeln will. Tug wird dem unglücklich Verliebten zu helfen versuchen. Nur soviel zu seinem unkonventionellem Freundschaftsdienst: auf dem roten Leineneinband der deutschen Ausgabe sehen wir ein umgedrehtes Auto, das hilflos wie ein Käfer seine vier Räder in die Luft streckt.
Doch auch hier hat der Titel der wunderbar ironisch getönten Geschichte nichts mit dem Thema zu tun. "Der kleine Clancy", das bezieht sich auf den erst zehnjährigen Jungen Wayne Clancy, der spurlos verschwunden ist, und um den Tugs Gedanken immerfort kreisen. Doch wir erfahren nicht, was dem kleinen Clancy widerfahren ist, ob er tot ist oder noch lebt. So wie überhaupt nicht alles aufgelöst wird bei Colin Barrett, lieber lässt er viele weitere Geschichten hinter einer einzigen lauern.
Mit seiner sprachlichen und psychologischen Finesse ist dieser feine Erzählband, von Hans-Christian Oeser angemessen ins Deutsche übertragen, ein starkes literarisches Debüt, dem man viele Leser wünscht.