Im April 1972 schaut Jonas Mekas bei Jackie Kennedy vorbei. Er will wissen, wie es der Familie geht, "film-wise". Und tatsächlich haben Jackie, Caroline und John Jr. die Super-8-Kamera, die Mekas ihnen besorgt hat, immer dabei. Die Kinder haben sogar eben einen 3-Minuten Film gedreht. Titel: "Die erste Rasur". Der Koch der Kennedys spielt den mit einer Axt zu Werke gehenden Barbier, und John Jr. und Caroline streiten sich, wessen Film es nun ist, Johns, der das "Drehbuch" geschrieben hat und als eingeschäumter zwölfjähriger Hauptdarsteller auch Regie führt, oder Carolines, die die Kamera bedient. Mekas ist das egal, er freut sich über diesen echten "Autoren"-Film.
Der 1922 in einem litauischen Dorf geborene Mekas gilt als Godfather des New Yorker und damit des amerikanischen Avantgardefilms. Nach deutscher Kriegsgefangenenschaft und Jahren in diversen Displaced-Person-Camps kam er 1949 nach New York, gründete die Zeitschrift Film Culture, schrieb jahrzehntelang eine Filmkolumne für die Village Voice und schuf Anfang der Sechzigerjahre mit der "Film-makers' Cooperative" den zentralen Ort der amerikanischen Filmkunst. Hier machte er Andy Warhol mit der Band The Velvet Underground bekannt, hier gaben sich Robert Frank und Yoko Ono die Klinke in die Hand. Frank ermöglichte Mekas durch einen Arbeitsvertrag den Aufenthalt in den USA.
Glamour interessierte Mekas allerdings nicht im Geringsten. Ihn interessierte nur die Kunst. So wie die Menschen in amerikanischen Städten, schreibt er in seinem Tagebuch, zur Selbstverteidigung häufig zur Waffe greifen, greift er zur Filmkamera und "schießt" seine Bilder: "Um mich davor zu bewahren, von der Trostlosigkeit der Gegenwart zermalmt zu werden" ("To protect myself from being crushed by the bleakness of the reality around me").
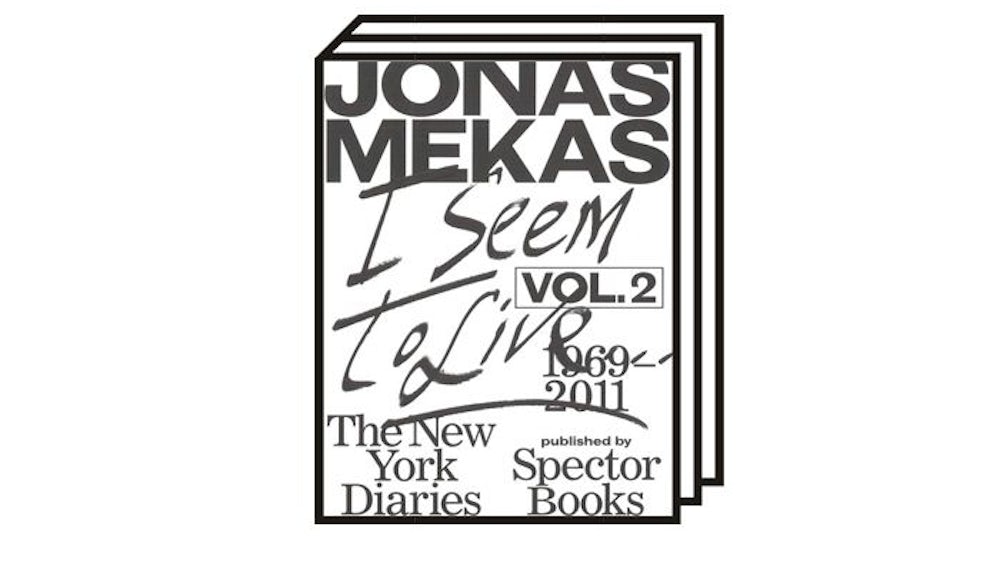
Die Kunst ist das Einzige, was zählt, für die Kunst opfert Mekas seinen letzten Cent. Wie kaum ein anderes Buch legen seine Tagebücher von dieser Unbedingtheit Zeugnis ab. Immer wieder geht es darum, Geld zu beschaffen, Geld für die Zeitschrift, Geld für Filmmaterial, Geld für die Miete. Dafür hungern Mekas und sein Bruder Adolfas buchstäblich, essen über Wochen nichts als Bohnen, und selbst die können sie sich irgendwann nicht mehr leisten.
Bei all dem Ernst, den das Gewerbe der Kunst erfordert, bei allen Steinen, die das Leben einem Künstler in den Weg legt, und bei aller Melancholie, die Mekas entweder angeboren ist oder die sich durch den Verlust der geliebten Heimat in ihm niedergelassen hat - seine Mutter wird er erst nach 27 Jahren wiedersehen -, zeugen seine Tagebücher doch von einer unglaublich lebensbejahenden Vitalität. New York bietet ihm eine Freiheit und ein soziales Umfeld, wie es sie an keinem anderen Ort der Welt gegeben hätte.
Die Tagebücher folgen, da Mekas jedes strenges Reglement fremd ist, keinem Tag-für-Tag-Schema, sondern versammeln Listen, Anekdoten, Pamphlete, Briefe, Gespräche und immer wieder Gedanken über das Filmemachen. Sie versammeln zudem, wie ein buntes Album, Fotografien, Filmstills, Handschriftliches, Tickets, Postkarten, Kontoauszüge, Zeichnungen oder auch ein Telegramm des Fluxus-Pioniers George Maciunas, seines litauischen Landsmanns und Freundes: "God is an infant devil is an infant eat baby food."

Bevor Jonas Mekas 2019 starb, hatte er sämtliches Material für die nun vorliegenden Bände seiner Tagebücher eingescannt und organisiert. Persönliches, so es nicht in Verbindung mit der Arbeit steht, kommt darin praktisch nicht vor, keine minutiösen Beschreibungen emotionaler Erschütterungen, kein Schwelgen in vergänglichen Gefühlslagen.
So verliert Mekas auch kein Wort über seinen ersten Besuch in der litauischen Heimat im Jahr 1971, wir sehen nur ein Foto, auf dem er mit einer Handkamera über die Wiese vor dem Haus seiner Mutter schwenkt. Ebenso ergreifend wie dieses Foto ist, gerade durch seine Sachlichkeit, ein Bericht über den Tod Allen Ginsbergs und die fotografisch dokumentierte Totenwache. Von der Geburt der Tochter erfährt man indirekt durch einen Brief, den Mekas' Mutter aus Litauen schickt.

Interessante Bücher, dazu Interviews und ausgewählte Debatten-Beiträge aus dem Feuilleton - jeden zweiten Mittwoch in Ihrem Postfach. Kostenlos anmelden.
Anders als Mekas' erstes Tagebuch, "Ich hatte keinen Ort", das vor allem seine Zeit in den Displaced-Person-Camps in Kassel und Wiesbaden umfasst, hat der Spector-Verlag die beiden Bände von "I seem to live" nicht übersetzen lassen. Doch selbst jemand, der lediglich mittelgut Englisch liest, wird keine Probleme haben, den Sätzen des Sprachenwechslers Mekas zu folgen, mehr noch, gerade in Mekas' schlichtem, unprätentiösem Sprachgestus liegt ein besonderer, wohl nur im Original nachvollziehbarer Charme. Für den Filmemacher ist Sprache vor allem Werkzeug. Der Dichter, der Mekas auch war, konnte jedoch nicht anders, als jedes Wort mit Witz und poetischer Energie aufzuladen: "I am worried that you may take/ this for a poem,/ while it's only a diary/ entry/ I am worried."

