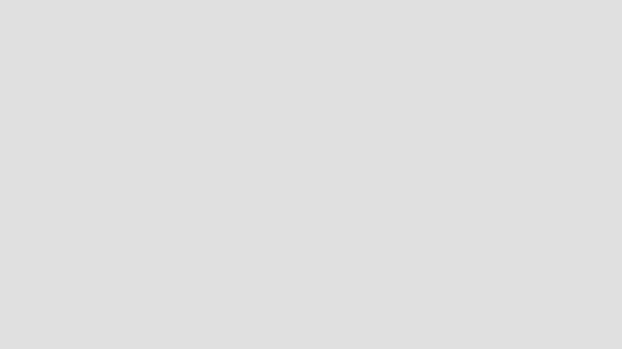In New York ist gerade mehr Jeff Koons zu sehen, als man bei diesen Temperaturen eigentlich verkraften kann. Vor dem Rockefeller Center steht ein elf Meter hoher Schaukelpferdkopf aus Blumen, das Whitney Museum zeigt die bisher größte Retrospektive, und dank der Fotografin Annie Leibovitz wissen wir jetzt, wie der Künstler von vorne wie von hinten nackt aussieht, heute, im Alter von 59 Jahren: nämlich ziemlich gut in Schuss.
Sie hat ihn für die aktuelle Ausgabe der amerikanischen Vanity Fair in seinem privaten Fitnesscenter porträtiert, wo er, wie wiederum Ingrid Sischy im Begleittext zu dem Foto schreibt, jeden Mittag trainiert, bevor er ein wenig gedünstetes Gemüse isst, weil er gern so lange arbeitsfähig bleiben wolle wie Picasso, also bis in seine Achtziger hinein.
Es ist schwer vorstellbar, dass er dabei grundsätzlich nicht mehr anhat als nur ein paar schwarze Bodybuilder-Handschuhe. Aber für die Vielschichtigkeit dieses Bildes ist es natürlich von großer Bedeutung, dass er da nun gleichzeitig an einen Faustkämpfer der griechischen Antike denken lässt und an die Sado-Maso-Keller von New York, an einen Renaissance-Herkules und an seine eigenen "Inflatables", seine, tja: aufgepumpten Hochglanzfiguren.
Koons im Spiegel
Man sieht Koons von hinten. Und im Spiegel von vorne. Und in einem weiteren Spiegel im Profil. So als hätten er und Leibovitz verabredet, gleich zwei Bezugspunkte sichtbar zu machen: das "von allen Seiten schön" der Skulpturen des Hochmanierismus, von denen Koons seit ein paar Jahren beängstigend quecksilberhafte Wiedergänger anfertigen lässt; und zweitens die spektralen Allansichtigkeiten des Kubismus, die ihn, Vorbild: Picasso!, schon früher oft beschäftigt hat. Der Layouter schließlich muss seinen lieben Spaß daran gehabt haben, die Überschrift "Jeff Koons Is Back!" so über diesem Bild zu verteilen, dass das "J" in "Jeff" und das "s" in "Is" des Künstlers sogenannte private parts verhüllen wie die Schamtüchlein des Daniele da Volterra die der ebenfalls recht muskulösen Heiligen von Michelangelo in der Sixtinischen Kapelle.
Jeff Koons "Balloon Dog (Yellow)".
(Foto: Andrew Burton/AFP)Dabei kennt die Welt Koons' vollständige Anatomie in allen Einzelheiten längst aus den Kopulations-Bildern der "Made In Heaven"-Serie mit seiner Ex-Ehefrau, der Pornodarstellerin Ilona Staller, genannt Cicciolina, für welche das Whitney Museum in New York in seiner großen Koons-Retrospektive jetzt ein eigenes Hinterzimmerchen eingerichtet hat - ein bisschen so wie die, wo früher in den Videotheken Frau Stallers Filme standen. In den Museen des alten Europa gab es oft solche Kabinette, in denen die Erotika unter Verschluss gehalten wurden.
Es ist schon immer wieder erstaunlich, wie viel gut abgehangene Kunstgeschichte unter Koons' silikonbrustpralle Oberflächen gestopft werden kann und wie kalkuliert sich das beides bei ihm gegenseitig absichert, das hochkulturelle Bildungsgut und das süßlich Frivole, die intellektuellen Referenzen und die etwas tiefer beheimateten Reverenzen, so als hätte sich das ein Finanzkonstrukteur an der Wall Street erdacht, wo Koons ja immerhin auch einmal kurz gearbeitet hat.
Size Matters
Die Retrospektive im Whitney Museum ist seine erste in New York, und es ist die letzte große Ausstellung in Marcel Breuers Bau auf der Madison Avenue, bevor das Whitney Museum nach Chelsea umzieht (wobei es neuerdings so klingt, als würde man den Bau nur für eine Weile an das Metropolitan Museum vermieten und dann eventuell eines Tages selbst wieder in Beschlag nehmen wollen). So viel Platz hat dort noch kein Künstler erhalten, über vier Etagen werden alle Koons'schen Werkgruppen weitgehend repräsentativ ausgebreitet, und das sind ja mit der Zeit recht platzbeanspruchende Unternehmungen geworden.
Size matters, tatsächlich: Die frühen Staubsauger, Referenz-Wolpertinger zwischen Warhol-Pop und Duchamp-Readymades, mit denen Koons sein Durchbruch gelang, wirken heute fast wie ältliche Studentenarbeiten gegenüber den spiegelnden Riesenherzen (Rummelplatzkitsch mit Aszendent "Arnolfini-Hochzeit" von van Eyck und "Selbstporträt im konvexen Spiegel" von Parmigianino) oder dem raumhohen Knete-Haufen "Play-Doh" (Kinderspielkram - und gleichzeitig der abstrakte Expressionismus eines Sam Francis-Gemäldes in dreidimensional), für dessen Antransport die Tür des Whitney Museums vergrößert werden musste.
Entscheidende Celebration-Serie
Die sogenannte Celebrations-Serie, der diese Arbeiten entstammen, steht auch immer als die entscheidende Etappe in den Erzählungen seiner Karriere. Der frühe Erfolg in den Achtzigern, die als Kunst ausgestellte Ehe mit Cicciolina, deren Scheitern, der anschließende Sorgerechtskrieg um den ihm entzogenen Sohn, Finanzprobleme, schließlich die Arbeit an dieser Serie, die so aufwendig und so teuer ist, dass er sie nie fertig zu bekommen scheint, die ihn am Ende aber zu einem der erfolgreichsten (im Sinne von: teuersten) Künstler seiner Zeit machen wird: Das ist, wie Ingrid Sischy schreibt, "eine klassisch amerikanische Fabel von Selbsterfindung, Einfallsreichtum und unverwüstlichem Willen, von einem gewissen Verkaufstalent mal ganz abgesehen."
Selbst solche hagiografischen Begleitzeilen zur großen Retrospektive haben ihren Referenzrahmen nicht nur im Celebrity-Kult eines gehobenen Klatschmagazins wie Vanity Fair, Sischy tut da für Jeff Koons im Prinzip nichts anderes als das, was Pietro Aretino für Tizian getan hat und Giorgio Vasari für alle anderen: die Bewirtschaftung einer konsistenten Künstlerlegende. Diesen Job teilt sie sich allerdings mit etlichen anderen. Jeffrey Deitch, der Kunsthändler, schreibt im Katalog zur Retrospektive aus der intimen Ansicht des engen, alten Freundes, wie viele von Koons' Motiven sich aus dessen Heimatstädtchen York in Pennsylvania herleiten und aus den ästhetischen Obsessionen seiner frühen Kindheit.
Die Retrospektive im Whitney Museum ist Koons erste in New York.
(Foto: AP)Der zentrale Beitrag im Katalog ist deswegen derjenige, in dem dieser Biografismus, die sorgfältig konstruierte Persona des Künstlers als Aspekt seines Werkes behandelt wird. Diesen Beitrag hat nun ausgerechnet Isabelle Graw geschrieben, Kunstgeschichtsprofessorin an der Städel-Schule in Frankfurt und Mitbegründerin der "Texte zur Kunst".
Bemerkenswert ist das deswegen, weil diese Zeitschrift in ihrem strengen, kritischen Gestus immer als das deutsche Pendant daherkam zu den strengen, kritischen Zeitschriften, die in Amerika den Künstler Koons von Anfang an geradezu angewidert zurückgewiesen haben. In der Kölner Szene, aus der die "Texte zur Kunst" stammen, wurde aber gerade Koons' offensiver Umgang mit dem Begriff der Karriereplanung positiv aufgenommen. Dass er hier seit seiner ersten Ausstellung bei Max Hetzler als amerikanischer Widerpart von Martin Kippenberger aufgefasst wurde, tat ein Übriges.
Koons'sche Märchenwelt
Die Zielstrebigkeit, mit der Koons sein Atelier zu einem regelrechten Luxusgüterkonzern ausgebaut hat, mit einem Heer von Angestellten, Materialforschungsabteilung, Zulieferbetrieben in Deutschland und etlichen Großgaleristen, die dafür zu sorgen haben, dass sich immer wieder gierige Finanziers für immer teurere Produktionen finden: Das alles macht Koons gerade für marxistische Analysen eher interessant als verdächtig.
Die grimmige "Criticality" der Theorie versteht sich in der Regel als das Gegenmittel zu der dauerbegeisterten Salesman-Attitüde, in der Koons sogar seine Galeristen weit hinter sich lässt. Viele stehen im Bannkreis seiner Persona, man spürt das, wenn er den Arm um einen aufgeregten Jungkurator legt und mit der anderen Hand den gereckten Daumen in die Kameras hält und lächelt, lächelt, lächelt. Und wenn Begriffe wie "wonderful", "engagement" und "transcendence" aus ihm herausgehaucht kommen und durch den Zuhörer mehr widerstandsfrei hindurch diffundieren, als dass sie ernsthaft gehört und verarbeitet würden. Die midasfingrige Fähigkeit, alles und alle um ihn herum in willige Bestandteile der Koons'schen Märchenwelt zu verwandeln, ist beträchtlich.
Man ist in Koons freundlich lächelnder Kunst praktisch gefangen.
(Foto: AFP)Es ist viel über die spiegelglatten Oberflächen geschrieben worden, in deren Tiefe jeder Betrachter und also auch jeder Kritiker schon deshalb ertrinken muss, weil er sich da ständig selber sieht, Ablehnung und Missgunst aber schlagen auf den Schauenden zurück, und mildes Lächeln ist fast schon Affirmation. Das ist nicht nur ein narzisstischer Trick, es hat schon etwas Totalitäres. Jeff Koons hat seine letzte große Serie 2013 präsentiert, in dem Jahr der Snowden-Enthüllungen über das Ausmaß unserer Überwachung.
Spiegelnde Metallbälle
Die "Gazing Balls" sind blaue, spiegelnde Metallbälle, die zum Beispiel einer vergrößerten Kopie des Herkules Farnese auf der Schulter sitzen. Die Welt als Google zu bezeichnen ist leider erstens ein Kalauer, der zweitens nur auf Deutsch funktioniert, und die spiegelnden Kugeln haben eine Tradition, die über den Gartenschmuck im ländlichen Pennsylvania bis in das Venedig des Mittelalters reicht. Aber diese Bälle sehen tatsächlich selber, und zwar rundherum alles. Man kann nicht aus ihrem Sichtfeld schleichen und diese Skulpturen unbeteiligt und von außen her betrachten.
Man ist in dieser freundlich lächelnden Kunst praktisch gefangen, und dass die Gemälde, die Koons von seinen Gehilfen malen lässt, demgegenüber in jeder Hinsicht stumpfer sind (wie Rosenquists für Kinder, könnte man sagen): Das ist da auch schon fast eher ein Trost als ein Kritikpunkt. Man kann nicht anders, als diese Retrospektive im Whitney Museum überwältigend zu nennen, es ist sehr schön, sehr glänzend, sehr bunt und sehr groß, und irgendwann möchte der klein gemachte Betrachter gerne aus Onkel Koons' lächelndem Paradies wieder abgeholt werden. Aber das kann er dann nur selber erledigen.
Jeff Koons: A Retrospective. Whitney Museum of American Art, New York, bis 19. Oktober. Danach in Paris und Bilbao. Katalog (Yale) 65 US-Dollar. Info: www.whitney.org