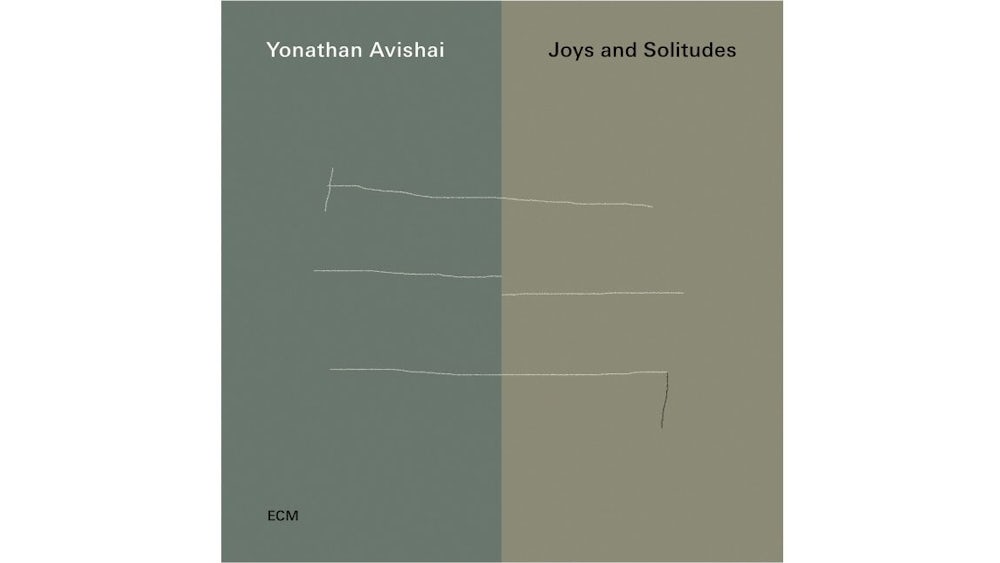Zu den mitunter zweifelhaften Errungenschaften in der Produktion populärer Musik gehört das digitale Metronom. Der permanent zu hörende "Klick" sorgt nämlich nicht nur dafür, dass alle Musiker exakt demselben Metrum gehorchen, und dass alles Gespielte als austauschbares Modul behandelt werden kann. Er hat vielmehr auch den Effekt, dass die Musiker zuweilen mehr auf ihn hören als auf ihr Gegenüber oder ihren Nachbarn. Die leichten Verschiebungen im Metrum, das sachte Ritardando oder die minimale Beschleunigung; lauter Ereignisse, die zu einem gelingenden Zusammenspiel gehören und den musikalischen Ausdruck steigern können, verschwinden zugunsten eines absoluten Gleichmaßes, in dem - nicht immer, aber oft - die Grenzen zwischen Maschine und Künstler aufgehoben werden.
Zwölfmal, ganz langsam, klopft Donald Kontonamou, der Schlagzeuger eines französischen Klaviertrios, das sich manchmal "Modern Times" nennt, auf das geschlossene Hi-Hat, bevor Yonathan Avishai, der Pianist und Chef des Ensembles, mit dem ersten Akkord einsetzt. Ein hermetisches Ding ist dieser B-Dur-Akkord mit der nach oben gesetzten Terz: Was er an dieser Stelle soll, ist einen Augenblick lang ebenso unklar wie die Richtung, die er nehmen wird. Und als dann die Melodie von Duke Ellingtons "Mood Indigo" angestimmt wird, untermalt von ein paar rollenden Arpeggien (und bald verziert mit gelegentlichen Trillern im oberen Register), ist es, als wolle Avishai mit dem Metrum wie mit der Ballade vorerst nur spielen, ganz lässig, wenn auch strikt im Zeitmaß. Ähnlich verhält sich auch der Bass, der zunächst nur zu Besuch zu kommen scheint und gleichsam erst einmal Hut und Mantel abnimmt, bevor er sich auf Dauer zu seinen beiden Kollegen gesellt. Unterdessen klopft der immer noch stoische Schlagzeuger weiter auf sein Hi-Hat, langsam und regelmäßig, um dann später, als die Mitte des Stücks fast erreicht ist, lebendig zu werden und zu einem Shuttle-Rhythmus überzugehen. In diesem Augenblick, so wirkt es, hat das Ensemble das Stück und sich selbst erst wirklich gefunden - und mit dem digitalen Metronom gespielt.
Yonathan Avishai, in Israel geboren und aufgewachsen, lebt seit langer Zeit in Frankreich - nach Jahren in der Dordogne, wohin ihn ein Austauschprogramm verschlug, nunmehr in der Nähe von Paris. Bekannt wurde er als Pianist in mehreren Ensembles des in New York lebenden Trompeters Avishai Cohen, mit dem ihn offenbar mehr als nur eine lange Freundschaft verbindet: Die Freiheit, sich in und zwischen Genres zu bewegen, gehört, neben dem Bewusstsein, dass mindestens die Hälfte der Musik aus Pausen zu bestehen hat, zu den Gemeinsamkeiten der beiden Musiker - allerdings kommt, wenn die größte Primadonna unter den Instrumenten nicht dabei ist und die Melodien vorgibt, etwas ganz anderes dabei heraus. Durch den Trompeter muss Yonathan Avishais Verbindung zum Münchner Label ECM entstanden sein, bei dem jetzt, unter dem Titel "Joys and Solitudes" die erste Veröffentlichung des Pianisten unter eigenem Namen erschien.
Ein Spiel ist, was Yonathan Avishai mit seinen Musikern hier aufführt, ein heiteres, aber sorgfältig ausgeführtes, präzises Spiel mit einer der bekanntesten Kompositionen der populären Musik im Besonderen und mit dem Metrum im Allgemeinen, ein Spiel, in dem die Pausen so wichtig sind wie die tatsächlich erklingenden Töne. Es heißt vielleicht "Befragung eines Klassikers", es mag aber auch sein, dass man es eher "Befragung eines Klaviertrios" nennen sollte. Man kann in diesem Spiel nicht verlieren, aber durchaus gewinnen, unter der Voraussetzung, dass man es ernst nimmt, dass man über die entsprechende musikalische Geistesgegenwart verfügt, dass man Freude an dieser Art von Witz hat - und dass man die Musik nicht an einen ironischen Effekt verrät. Über lange Zeit muss das Ensemble diese gemeinsame wache Präsenz geübt haben, so sehr, dass sich aus einer lyrischen Melodie mit einer Bewegung des kleinen Fingers ein Tango lösen kann, in dem dann plötzlich eine verminderte Quinte für die Verwandlung in einen Blues sorgt. Und hat der Hörer auch kaum gemerkt, wie ihm dabei geschah, kann er doch gewiss sein, dass er (und die Gruppe) sich immer noch im selben Stück befindet.
Es gibt zum Beispiel ein schnelles Stück auf diesem Album, das fast schon burleske "Lya", das an das Seilspringen erinnert, ein Spiel mit Variationen und (falls es gut beherrscht wird) Überraschungen, in dem, wenn das Seil schnell genug geschwungen wird, Bewegung und Stillstand scheinbar zusammenfallen. Und es gibt den elegischen Walzer "Shir Boker" ("Morgenlied"), bei dem man Bilder vor sich zu sehen meint, vom Blinzeln im ersten Sonnenlicht, vom tiefen Atemzug, mit dem man die Kräfte für den Tag sammelt, bis zu dem Augenblick, in dem sich der Mensch, von einem Arpeggio ermuntert, von der Bettkante hebt. Das Spiel nimmt hier Züge eines Schauspiels, vielleicht sogar einer Maskerade an, aber das liegt sozusagen in der Natur des Vorgangs: Man kann spielen, und man kann etwas oder jemanden spielen. Das Schöne an dieser Musik ist, dass sie solche Übergänge kennt und offen hält