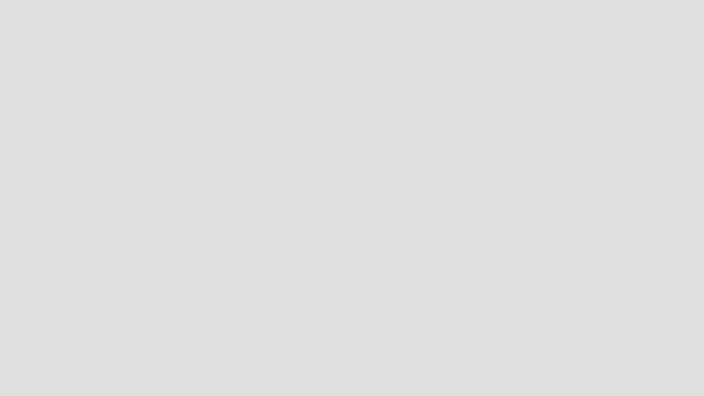In einem der besten Filme des letzten Jahres, dem auf einen Hochseefischerboot gedrehten "Leviathan", hatte man es mit Bildern zu tun, die sich nicht mehr binden ließen. Die beiden Regisseure, Lucien Castaing-Taylor und Véréna Paravel, setzten viele kleine, in wasserdichte Hüllen eingeschlagene Kameras ein - um sie dann von Bord zu werfen und in Netzen durch die Fahrtgischt gurgeln zu lassen, um sie an Masten hochzuziehen und durch glitschig-blutige Fischtanks rutschen zu lassen.
Fernab irgendeiner inszenatorischen Idee oder auch nur der geringsten Führung, ganz den Elementen und dem Zufall anheimgegeben, waren sie es, die den Film machten. Nicht die Regisseure, allein die wie Netze ausgeworfenen Kameras durchkämmten das Dunkel der Nacht und des Ozeans - wie der Leviathan, das mythische Seewesen in der Bibel. Um dann Bilder wie Fischschwärme an die Oberfläche zu ziehen: ein archaischer Strom aus Meergischt, blutigem Fischgekräuse, Ketten und Möwenflügeln.
Das Bildermonster, das da geschaffen wurde, scheint aber noch weit über diesen Film hinaus zu wirken- gerade jetzt, da Google seine Glass-Brille wirklich auf den Markt bringt und sogar schon eine digitale Kontaktlinse mit Mikrokamera zum Patent angemeldet hat. Kameras werden heute weniger geführt als getragen, ob nun vom Meer oder von Menschen, und ihre neue Autonomie bestätigt die alte These von Stanley Cavell aus den Sechzigern, dass Kino sich durch seinen automatischen Charakter auszeichne.
Im Hollywoodkino kann man schon länger beobachten, dass die virtuelle Kamera in der Computeranimation die Restriktion der Inszenierung durch physische Gesetze weitestgehend abgeschafft hat. Aber dass die Bildmaschinen ganz ihrem eigenen Gesetz überlassen werden, das erscheint in einer Industrie, die aufs geradlinige Erzählen gepolt ist, dann doch zu experimentell. Ansätze dazu aber gibt es:
Im Spektakel des zweiten "Hobbits" war die beste Szene schon jene, in der die Kamera in einer ungeschnittenen, akrobatischen Fahrt einen tosenden Wildwasserbach herunterraste und sich dabei mit den darauf tanzenden Holzfässern drehte. Und vielleicht wäre "Captain Philips" ein nur halb so packender Film, hätte Paul Greengrass seine Kamera auf hoher See nicht von den kurzen, hektischen Wellenschlägen auf- und niederreißen lassen, die das Rettungsboot hinterlässt, auf dem somalische Piraten Tom Hanks entführen.
Der Hollywoodfilm, der "Leviathan" zuletzt am nächsten kam, war "Gravity". Einmal angestoßen, scheint hier die Kamera nur noch ihrer eigenen Trägheit zu folgen, wenn sie schwerelos durchs Weltall gleitet, satellitengleich mit Sandra Bullock ewig im Erdorbit kreist. Als würde niemand sie mehr führen. Und als würde sie genau dadurch diesen Bereich umreißen, dem die Astronautin Bullock hilflos ausgeliefert ist, diese kalte, absolut lebensfeindliche Sphäre des Orbits, in der man sich ewig weiterdrehen kann, die einen nicht mehr gehen lässt.
Im Spin durchs All
In keinem Moment wird das so deutlich wie da, wo die Kamera Bullocks Helm fixiert, als sie nach dem Unfall am Space Shuttle im unkontrollierten Spin durchs All geschleudert wird. Im Spiegel des Visiers sieht man, wie sich das ganze Universum und die Erde um sie dreht. Und ihre Angst, aus dieser Bewegung niemals wieder austreten zu können. Die Kamera nimmt da ihre Subjektive ein - und fügt ihr etwas hinzu, was über sie hinausgeht und sie überleben wird.
Die autonome Kamera, das ist ein körperloses Auge, das sich wie eine unendlich dünne Membran mit dem Blick jedes organischen Lebens vermischen kann, aber unabhängig von ihm bleibt; der Blick einer monströsen, unbedingt tödlichen und selbst unzerstörbaren Natur, der unsterbliche Blick des Todes selbst. So imitiert die Kamera in "Leviathan" den Blick eines toten, aber noch immer wie vor unendlicher Verblüffung glotzenden Fisches, auf den sie in einem der Tanks immer wieder zurutscht, um dann wieder fortgezogen zu werden.
Die Kamera überlebt jeden, dessen Blick sie annehmen oder der sie sonst wie steuern oder an sich binden kann. Ganz explizit wird das in Filmen wie "Cloverfield", "Rec" oder "Diary of the Dead": Horror und Katastrophen werden hier als Montagen scheinbar zufällig entstandener Amateur- oder Newsaufnahmen gezeigt. Die Kameras laufen weiter, während die Protagonisten der Reihe nach sterben, am Ende sind sie ( und ihre Bilder) die einzigen Zeugen und Überlebenden.
Faszination autonome Kamera
Die Faszination der autonomen Kamera ist tatsächlich vor allem dort zu finden, wo Lebensgefahr herrscht. "Leviathan", dieser Film über das im Übrigen selbst manchmal hochgefährliche Gewerbe der Hochseefischerei, wurde mit kleinen, hochrobusten Helmkameras des Herstellers GoPro gedreht, dessen Modelle sich Extremsportler jeder Couleur bei ihren waghalsigen Missionen umschnallen. Man denke an das gewaltige Interesse, das der von einer Helmkamera übertragene Strato-Sprung von Felix Baumgartner hervorgerufen hat.
Die Kamera imitiert dabei das unkontrollierbare, tödliche Ausgeliefertsein dessen, an dem sie haftet, der, im freien Fall, sein Bild nicht steuern kann. Auf YouTube finden sich zahllose Clips von Kameras, die auf ihren Trägern fixiert sind wie eine Todesdrohung: Cross-Biker düsen über Bergrücken, die, verstärkt vom Froschauge der kleinen Kamera, so schmal erscheinen wie eine Wirbelsäule; ein Skifahrer rutscht kurz vor der Abfahrt vom steilen Gipfel ab und stürzt einen Hang runter; ein Fallschirmspringer kollidiert bei der Landung mit einem Kleinbus, der Aufprallschock schleudert die Kamera brutal durch die Gegend, bis sie in zufälliger, schiefer Position reglos liegen bleibt, als hätte man sie wie einen Würfel geschmissen.
Nach solchen Bildern, in denen man mit dem anderen stirbt und ihn dabei überlebt, denen der Tod immanent ist und trotzdem sein Geheimnis nicht preisgibt, kann man nur süchtig werden. Weil sie einen letztlich auch mit der Sucht konfrontieren, mit der man am eigenen Leben hängt. Darum ging es schon in Douglas Trumbulls "Projekt Brainstorm" von 1983. Dort entwickelten Wissenschaftler eine Helmvorrichtung, die Erfahrungen und Empfindungen eines Menschen aufzeichnet und für andere unmittelbar nacherlebbar macht.
Nacherleben mit allen Sinnen
Es beginnt mit Fliegen im Düsenjäger, Fahrten im Rennwagen. Was aber wirklich süchtig macht, ist nicht nur Sex, sondern vor allem die Aufnahme, die eine Sterbende im Moment ihres Todes gemacht hat und die Christopher Walken einfach unbedingt sehen muss, koste es, was es wolle: "I'm so scared. But the thing is I like it. I want more." Auch in Kathryn Bigelows "Strange Days" von 1995 stellen mit allen Sinnen nacherlebbare Clips in einem düsteren Los Angeles der Jahrtausendwende eine regelrechte Droge für Cyberjunkies dar; "Snuff Clips", in denen Leute sich dabei aufgenommen haben, wie sie jemanden umbringen oder selbst sterben, sind der übelste aller Stoffe, von dem sogar der von Ralph Fiennes gespielte Clip-Dealer lieber die Finger lässt.
In beiden Filmen kommt zum Aspekt der Todesbildersucht noch ein weiterer hinzu: die Überwachung. In "Strange Days" wird die Elektrodenvorrichtung gleich unter Perücken versteckt, da sie auch ein Instrument ist, um Leute auszuspionieren, und in "Brainstorm" werden die Wissenschaftler ermahnt, den zunächst noch klobigen, monströsen Helm in einen attraktiven, leichten, also weniger auffälligen umzuwandeln - so wie Google Glass nun mit einem italienischen Brillenhersteller paktiert, um das Gerät, das scheinbar selbst im Silicon Valley noch ziemlich verhasst ist, verkaufstauglicher zu machen - und unscheinbarer. Von den kaum mehr erkennbaren Kontaktlinsen aus dem Google-Labor ganz zu schweigen.
Aufzeichnungsgerät der Wahrnehmung
Ist Googles Brille, jenseits der bereits angeprangerten spionagetauglichen Gesichtserkennung, nicht auch die perfekte Kombination aus Helmkamera und Bildschirm, aus möglichem Aufzeichnungsgerät unserer Wahrnehmung und möglichem Abspielgerät der Wahrnehmung der anderen? Und zeigt sie nicht, dass ein zeitgenössischer "Leviathan", in dem Thomas Hobbes das Bild des absolutistischen Staats sah, heute weniger ein überwachender Geheimdienst oder ein Unternehmen wie Google ist, sondern die autonome Kamera selbst - die Autonomie der Kamera in allen autonomen Kameras?
Denn die autonome Kamera würde sich nicht nur wie ein Souverän jeder Kontrolle entziehen. Sie bliebe auch da souverän, wo jene, die sie tragen, die Kontrolle über ihr Leben verlieren. Genau darin bestünde ihre Herrschaft: Sie würde in jedem die Sucht nach der Überwachung aller anderen entfachen. Weniger nach dem Leben dieser anderen - das ist meist langweilig genug. Sondern nach dem Moment, wo dieses durch schwere Unfälle oder den Tod jeglicher Kontrolle entgleitet. Man stelle sich vor, man hätte Michael Schumacher auf seiner tragischen Skifahrt oder gar die Passagiere von MH 370 auf diese Weise "begleiten" können.
Man wäre also schlichtweg süchtig nach Kontrollverlust. Und damit nach der autonomen Kamera selbst, nach diesem unbezwingbaren leviathanischen Bildmonster, das sich an alle bindet und alle verbinden würde - ohne selbst je gebunden werden zu können.