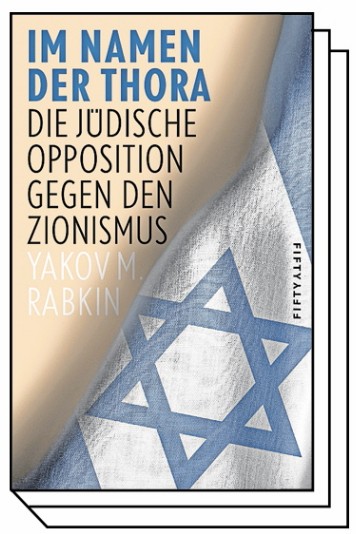Ist der Staat Israel jüdisch? Keine Frage, insofern sich der selbsternannte "jüdische Staat" seit seiner Gründung 1948 nicht nur als Hauptvertretung der Juden weltweit längst durchsetzt hat, sondern auch zum Inbegriff dessen geworden ist, was "jüdisch" heißt.
Fraglicher wird die Identifizierung zwischen Israel und Judentum bei kontroversen politischen Themen. Israels Politik ist durch Besatzung und Annektierung, die palästinensische Flüchtlingsproblematik und die Ungleichbehandlung seiner arabischen Bürger geprägt. Einst als Kriegsnotwendigkeit toleriert, machte diese Politik Israel nach mehreren Jahrzehnten allmählich zum chronischen Problemfall zeitgenössischer Nationalstaatlichkeit. Nicht Israels Jüdischsein, sondern Israels Demokratie wird immer häufiger angezweifelt.
Eben dadurch aber wird gerade das Jüdische fragwürdig: Liegt die Beeinträchtigung Israels als Demokratie darin, dass dieser Staat jüdisch ist und bleiben will?
Dass es so sei, ist heute Konsens, gar Staatsräson. Der israelische Staat übt seine Gewalt als Nationalstaat der Juden aus, er kämpft grundsätzlich um nichts anderes, als darum, jüdisch zu bleiben. So stark verschmilzt Israel Staatsgewalt mit dem Jüdischsein, dass Kritik seiner Politik schnell sein Existenzrecht als jüdischer Staat und somit das Existenzrecht der Juden überhaupt infrage zu stellen scheint.
Widerstand gegen Israels Politik wird auch mit Berufung auf die "deutsche Staatsräson" als Antisemitismus verurteilt, so im Beschluss des Deutschen Bundestags im letzten Jahr, die schon in ihrem Titel "BDS-Bewegung entschlossen entgegentreten - Antisemitismus bekämpfen" einen unauflöslichen Zusammenhang postuliert. Der Entscheidung zur Verurteilung und Isolierung der Israel-Boykott-Bewegung wird dabei in einem Akt deutscher Staatspsychologie die Identifizierung zwischen Israel und Juden zugrundegelegt: ",Don't Buy'-Aufkleber der BDS-Bewegung auf israelischen Produkten wecken unweigerlich Assoziationen zu der NS-Parole 'Kauft nicht bei Juden!'", heißt es im offiziellen Beschlusstext.
Diese Ideengeschichte versöhnt Judentum und Demokratie durch Distanzierung vom Nationalismus
Assoziationen sind aber zweischneidig. Sosehr seine Verknüpfung mit den Opfern der nationalsozialistischen Verfolgung den Staat Israel entschuldet, riskiert sie auch die Juden der Diaspora mit der israelischen Staatsgewalt zu belasten. Israels nationalstaatlichen Verfehlungen im Namen der Juden zu verteidigen, läuft Gefahr, eine Grundthese aller historischen Antijudaismen zu bekräftigen, Judentum sei Nationalismus.
Diese These zieht sich wie ein roter Faden durch die Brandmarkung des Judentums als ethnisch im christlichen Antijudaismus, als partikularistisch im linken Antisemitismus oder im neuantisemitischen Israelhass von Postkolonialisten sowie als fremd bis feindlich im rechten Antisemitismus, der bei sich autoritären Nationalisten wie Trump, Orbán und der AfD aktuell hinter der Fassade des philosemitischen Israelkults verbirgt. Gleiches gilt paradoxerweise für liberale Verbesserungsentwürfe, Israel demokratischer - neulich "utopisch" - zu gestalten, dafür weniger jüdisch, am besten säkular, hauptsächlich unorthodox.
Gegen die scheinbar unbestreitbare Tendenz des Judentums hin zum Nationalstaat argumentiert Yakov Rabkin, Historiker an der Universität Montreal, in seinem 2004 auf Französisch veröffentlichten, inzwischen in 12 Sprachen übersetzten und soeben auch auf Deutsch erschienenen Buch "Die Jüdische Opposition gegen den Zionismus". Damit ist nicht gemeint, dass es sogar Juden gibt, die den Zionismus kritisieren, sondern dass eine der grundsätzlichsten Kritiken gerade von orthodoxen Juden kommt, die sich "im Namen der Thora" dem Nationalstaatsprojekt als unjüdisch, sogar antijüdisch widersetzen.
Dem herrschenden Common Sense gilt der jüdische Antizionismus als paradox und wird damit schnell als Meinung radikaler Minderheiten beiseitegeschoben. Doch ist Rabkins Buch kein Pamphlet, es gehört vielmehr zu einer seit ein paar Jahrzehnten in den USA und in Israel gut etablierten jüdischen Ideengeschichte "gegen den Strich". Demokratisch motiviert, sucht die neue Historiografie nicht mehr, wie bisher üblich, Nationalismus mit Demokratie durch Distanzierung vom Judentum zu versöhnen, sondern Judentum mit Demokratie durch die Distanzierung vom Nationalismus. Neu erzählt wird dabei, was Jüdischsein überhaupt bedeutet und war, und wie es zum Zionismus steht.
Die Diasporazivilisation ist nicht unpolitisch zu verstehen, sondern als Tradition von Gemeinwesen
Unbestritten bildete nicht erst der Nationalstaat, sondern schon die Bestrebungen nach einem solchen einen Bruch mit der jüdischen Tradition der Diaspora. Wie Rabkin zeigt, lehnte die absolute Mehrheit der Juden den Zionismus ursprünglich entschlossen ab. Der erste Zionistenkongress 1897 musste wegen Protesten der deutschen Juden von München nach Basel verlegt werden. Heute, mehr als 120 Jahren später, bleibt die damalige Streitfrage weiterhin offen: Erlöst der Zionismus die Juden durch seinen Bruch mit der Diaspora oder löst er sie eher ab, stellt der Nationalstaat die Vollendung des Judentums dar oder vielmehr sein Ende?
Dem heutigen konventionellen Narrativ des Zionismus zufolge wird die diasporische Geschichte der Juden in ihrer politischen Dimension als negative erzählt. Das traditionelle rabbinische Judentum sei demnach die Verfallsform einer vertriebenen Nation ohne Staat, eine unpolitische Religion der Unterdrückten, welche durch den wiedergeborenen Nationalstaat aufgehoben wurde. Die orthodoxe Opposition gegen den Zionismus sei die Opposition des Weltfremden zur Welt, des Geistlichen zur Politik, der Zombies zum Leben.
Dagegen pocht die neue Geschichtsschreibung darauf, die jüdische Diasporazivilisation nicht als unpolitisch zu verstehen, sondern als anders politisch, nämlich als eine selbstbewusste Tradition von Gemeinwesen, die sich vom Nationalstaatsmodel unterscheidet, und zwar laut Rabkin vor allem durch ihre "prinzipielle Ablehnung jeglicher Gewaltanwendung". Die Gewalt übernahm der Staat Israel, so das Argument, nicht aus der Torah, sondern aus dem europäischen Nationalismus, gegen den das talmudische Judentum noch heute eine reiche Quelle der Kritik darstellt.
Rabkins Buch ist eine Einleitung in den antizionistischen Widerstand in der jüdischen Orthodoxie, er präsentiert die wichtigen Argumente, Werke, Debatten, Figuren, Organisationen, Ereignisse und schafft damit einen ersten Zugang zu einem meist unbekannten, oft als irrelevant verkannten, doch aktuellen Kosmos von Theorie und Praxis.
Der Zionismus blieb nicht säkular, es entstand eine neue national gesinnte Orthodoxie in Israel
Abgelehnt wurde der Zionismus zunächst als Idee von quasi allen Rabbinern in Europa und später, als immer mehr Zionisten nach Palästina einwanderten, auch von den dort alteingesessenen Juden, womit ein bitterer Konflikt begann, der 1924 zum politischen Mord an einem Vertreter der Antizionisten, Jacob Israël de Haan, durch die zionistische Untergrundorganisation Hagana führte. Nach der Vernichtung der europäischen Diaspora und der Gründung Israels setzte sich der Widerstand in immer kleineren Kreisen der "ultraorthodoxen" Juden, korrekter "Charedim" (die Gottes Wort "Fürchtenden"), fort.
Viele von ihnen leben heute in Israel, halten jedoch Abstand zum Staat, exiliert im Heiligen Land. Insbesondere verweigern sie den Militärdienst, lehnen je nach Radikalitätsgrad aber auch andere nationale Zeichen wie den Davidstern oder nationale Feiertage ab. Auch die Landessprache, das Neuhebräische, versuchen sie zu vermeiden und sprechen stattdessen, zum Ärger israelischer Patrioten, lieber Jiddisch. Politisch streben die antizionistischen Charedim danach, das Judentum von der Staatsgewalt zu retten, hoffen auf die gewaltlose Auflösung des jüdischen Staates nach dem Vorbild der Sowjetunion. Wenn es einen Staat geben muss, solle sich dieser nicht als jüdisch ausgeben, und im Zweifel besser palästinensisch sein. Auch der Holocaust, der immer wieder als Grund für die Notwendigkeit eines wahrhaften Judenstaates ins Feld geführt wird, bietet ihnen kein Argument gegen das Konzept der Diaspora, eher gegen das des Nationalstaats.
Letztendlich ist das prinzipielle Problem des jüdischen Antizionismus mit dem Staat Israel, dass sich dieser nicht nur unjüdisch verhält, sondern dabei als urjüdisch darstellt, wodurch das Judentum heute überall, auch in Deutschland, mit Israels Nationalpolitik identifiziert wird. Verstärkt wird die Gleichsetzung noch dadurch, dass der Zionismus nicht säkular blieb, sondern in Israel eine neue national gesinnte Orthodoxie entstand, die seit 1967 die Politik zunehmend bestimmt und die Landnahme religiös flankiert und fördert. Gegenwärtig orientieren sich auch immer mehr ursprünglich antinationale Charedim national um.
In dem hochmilitarisierten Besatzungsstaat, der den Juden das Überleben sichern sollte, droht die lange diasporische Tradition des Judentums mit ihrer Kritik der Gewalt zu verschwinden, so mahnt Rabkin. Dies zu verhindern, zunächst einmal wahrzunehmen, ist heute eine dringliche Aufgabe im Kampf gegen Antisemitismus.
Elad Lapidot ist Dozent für Philosophie und Jüdische Studien an der Universität Bern und an der Humboldt Universität Berlin.