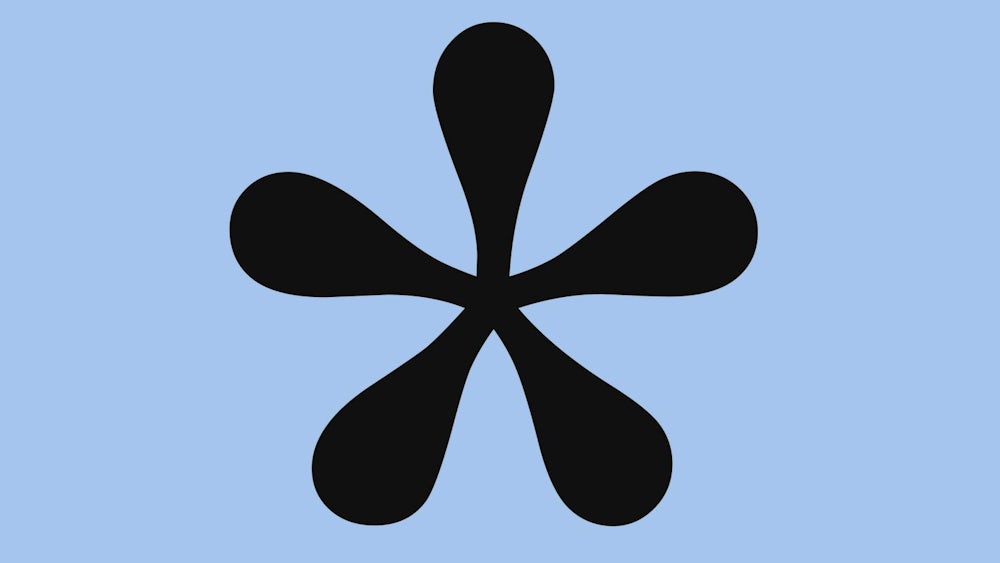Als Eduard Engel, amtlicher Stenograf im Berliner Reichstag, im Jahr 1917 das Büchlein "Sprich Deutsch! Zum Hilfsdienst am Vaterland" veröffentlichte, war die Reinigung der Sprache von ihren romanischen Anteilen zu einem politischen Programm geworden, dem man sich zumindest in der Öffentlichkeit nur schwer entziehen konnte. Das galt insbesondere für die Landesteile, in denen das Französische traditionell gegenwärtig war, also für das Elsass und den Osten Lothringens. So gingen das "Restaurant", das "Hotel" und das "Trottoir" für eine Weile dahin, und es blieben die "Gaststätte", das "Gasthaus" und der "Bürgersteig". Dauerhaften Erfolg hatte das Unternehmen nicht. Nach der Niederlage Deutschlands ließ der Enthusiasmus ("Gluttrieb") für die Verdeutschung des Deutschen nach, und wenn er auch mit der beginnenden Herrschaft des Nationalsozialismus wieder aufflammte, so mochten dessen führende Politiker den Purismus doch nicht teilen. Etliche Neuschöpfungen blieben indessen erhalten. Sie taten es immer dann, wenn mit ihnen ein Gewinn an Bedeutung verbunden blieb - oder wenn sie ökonomischer waren als die Lehnwörter, die sie ersetzen sollten.
Die Forderung nach einer geschlechterneutralen Sprache ist ein idealistisches Vorhaben
Von allen Versuchen, die deutsche Sprache einem entschlossen politischen Programm zu unterwerfen, war ihre "Entwelschung" bis vor Kurzem ein Unternehmen, das in Umfang und Intensität einzigartig war (die Rechtschreibreform gründete auf einer Fantasie von Rationalisierung). Die "Entwelschung" blieb aber mehr oder minder folgenlos, weil die Änderungen nur den Wortschatz betrafen. Denn die Wörter kommen und gehen, dem Teufel merkt man seine Herkunft aus dem Griechischen nicht an, und ob es nun "Egoismus" oder "Selbstsucht" heißt, kann der deutschen Sprache und ihren Benutzern eher gleichgültig sein.
Von ganz anderem Zuschnitt ist indessen, was die Anhänger und Sachwalter einer "geschlechtergerechten" oder "geschlechterneutralen" Sprache im Sinn haben: Denn das Genus gehört, in Gestalt etwa der Wortbildung, der Pronomina oder der Endungen, zur Grammatik. Und Veränderungen in der Sprachstruktur sind nicht nur ungleich folgenreicher und beständiger als Veränderungen im Wortschatz. Vielmehr setzt die Grammatik dem Willen zum Umbau der Sprache einen viel größeren Widerstand entgegen. Man bemerkt ihn etwa an den jüngsten Schicksalen des unpersönlichen Pronomens "man". Von Anhängern der geschlechtergerechten Sprache fälschlicherweise von "Mann" abgeleitet (anstatt, wie das französische "on", von "Mensch", "homme"), sollte es durch "frau" ersetzt werden oder, besonders sperrig, durch "man/frau". Aber die Änderung setzte sich nicht durch. Es mag allenfalls sein, dass in Sätzen, in denen man früher "man" gesagt hätte, heute häufiger ein Passiv benutzt wird.

Was Pippi Langstrumpf und Annika mit der Abwertung von Weiblichkeit zu tun haben.
Die Forderung nach einer geschlechtergerechten oder geschlechterneutralen Sprache ist ein idealistisches Vorhaben. Sie beruht auf der Verbitterung, dass alle Anstrengungen der vergangenen 150 Jahre, die Ungleichheit der Geschlechter aufzuheben, die Differenz nicht aufzuheben vermochten. Und sie verknüpft sich mit der Hoffnung, über die getrennte Berücksichtigung der Frau in der Sprache wenigstens im Symbolischen eine Gleichheit zu erzeugen. Nun wird man zwar Beispiele finden, in denen eine Veränderung der Sprache mit einer Veränderung der Weltsicht einherzugehen scheint: Mit Bussarden, Falken und Weihen geht man anders um, seitdem die fleischfressenden Flieger nicht mehr "Raubvögel", sondern "Greifvögel" heißen. Unsicher indessen ist, ob diese Veränderung tatsächlich auf einen Wechsel des Vokabulars zurückgeht, oder ob man sich anders ausdrückt, seitdem man anders denkt - und der Wechsel des Vokabulars deswegen so erfolgreich war. Die Anhänger der geschlechtergerechten Sprache kennen solche Bedenken nicht: In einem revolutionären Akt, so meinen sie, solle ein Gleichstand geschaffen werden, wie er auch in der Natur bestehe, in der es Männliches, Weibliches und Etliches gebe, das weder weiblich noch männlich, sondern irgendetwas dazwischen oder etwas ganz anderes sei.
Im Deutschen führt diese Forderung zu einem Widerspruch, der so allgemein und elementar ist, dass er sich durch die gesamte Debatte um die geschlechtergerechte Sprache zieht: Denn die "Wählerinnen und Wähler", von denen die Politiker sprechen, die "Leserinnen und Leser", die "Polizistinnen und Polizisten" sind einander keineswegs gleichgestellt, so freundlich oder höflich die Formel auch manchmal gemeint sein mag. Das liegt daran, dass die "Bäckerin" eine Ableitung aus dem "Bäcker" ist und auch gar nichts anderes sein kann: Grammatisch ist die männliche Variante die Grundform, die weibliche Endung tritt hinzu - wohlgemerkt: nicht biologisch, sondern grammatisch. Wer "ich gehe zum Bäcker sagt", denkt dabei nicht notwendig an einen Mann.
Zwar gibt es Wörter, in denen das Ableitungsverhältnis in der Bedeutung verschwunden zu sein scheint. Die "Lehrerin" zum Beispiel oder auch die "Bundeskanzlerin" treten praktisch als unabhängige Figuren auf. Grammatisch ist das Verhängnis aber immer noch da. Diese Eigenheit der deutschen Sprache führt dazu, dass die Verfechter der geschlechtergerechten Sprache die Dominanz des Männlichen reproduzieren, wenn sie Gleichheit zu schaffen meinen - ganz abgesehen davon, dass es in der deutschen Sprache eine ganze Reihe von Menschenwesen mit männlichem Genus gibt, die gar keine weiblichen Formen bilden können, die "Flüchtlinge" zum Beispiel. Manche wählen deshalb den vermeintlichen Ausweg über das Partizip Präsens. Aber "Lesende" sind andere Leute als "Leser": Die einen lesen gerade jetzt, die anderen haben vielleicht vor einem halben Jahr zum letzten Mal ein Buch gelesen. Im Übrigen wird, sobald sich zur Singularform der bestimmte oder unbestimmte Artikel gesellt, das Geschlecht schon wieder unbarmherzig enthüllt.
Der Widerspruch zwischen dem Wunsch, im Verhältnis der Geschlechter in der Sprache Gleichheit zu schaffen, und der grammatischen Notwendigkeit, die Vorherrschaft des Männlichen zu wiederholen, ist eine Kleinigkeit gegenüber dem zweiten Widerspruch, der in der geschlechtergerechten Sprache steckt: Denn Gleichheit ist eine kulturelle Errungenschaft. Als solche aber geht sie, wie man die Sache auch dreht und wendet, mit der Emanzipation des Menschen von der Natur einher (wobei man hinzufügen muss, dass die Lasten dieser Emanzipation sehr ungleich verteilt waren). Und tatsächlich: wäre es nicht tatsächlich das Beste für den intellektuellen Umgang miteinander, wenn man sich in einer Gemeinschaft freier Geister bewegen könnte, unbeschwert den Gedanken folgend, ohne Rücksicht auf biologische Voraussetzungen? So aber ist die geschlechtergerechte Sprache, wie sie bislang propagiert wird, nicht beschaffen. Stattdessen stößt sie jeden Mann und jede Frau auf seine oder ihre biologische Bedingtheit zurück. Und schlimmer noch: Viele Anhänger der geschlechtergerechten Sprache bestehen darauf, das Geschlecht sei etwas "konstruiertes" oder kulturell "gemachtes". Wenn ausgerechnet Verfechter solcher Lehren den Menschen mit allem Nachdruck in die Bedingtheit des natürlichen Geschlechtes zurückdrängen wollen, verwandeln sich Fragen nach Wahrheit oder Unwahrheit in der Sprache in Konflikte um eine kulturelle Hegemonie.
Der Dominanz des Männlichen entkommt man in der deutschen Sprache nicht
Angesichts der beiden Widersprüche, die in der Forderung nach einer geschlechtergerechten Sprache enthalten sind, nehmen sich die anderen, üblichen Vorbehalte gering aus: Selbstverständlich ist das Verlangen nach öffentlicher Anerkennung, das die neue Sprachregelungen motiviert, ein schlechter und womöglich auch falscher Ersatz für einen tatsächlich souveränen Umgang zwischen den Geschlechtern. Selbstverständlich treibt das Projekt eine Bürokratisierung der Sprache voran, die deren Entwicklungsgesetz, nämlich dem möglichst effektiven, leichten Umgang mit den zum Ausdruck aufgewendeten Mitteln, geradewegs entgegensteht - ganz abgesehen von einem schwer erträglichen Aufseherwesen, das sich mit der Forderung nach einer geschlechtergerechten Sprache etabliert. Selbstverständlich wird durch den Einsatz von Sternchen, Unterstrichen, Binnen-I's und Querstrichen nicht nur die Differenz zwischen der schriftlichen und der gesprochenen Sprache verschärft, sondern auch das Auseinander von öffentlicher und gemeinhin benutzter Sprache (es ist kein Zufall, dass eine geschlechtergerechte Sprache in Publikationen, die verkauft werden sollen, keine Rolle spielt). Und selbstverständlich ist es eine Zumutung für Menschen, die sich dem eigenen Geschlecht - oder auch dem nicht-nicht-eigenen Geschlecht - zugetan fühlen, wenn der Bürokratismus der allerneuesten sexuellen Verwaltung sie als "LGBTQ" vorführt. Am revolutionären Furor, der gegenwärtig die Debatte um Sprache und Geschlecht beherrscht, gehen solche Einwände jedoch zuschanden. Sie erscheinen als etwas Reaktionäres und von vornherein Verwerfliches.
Die Verteidiger der noch nicht geschlechtergerechten Sprache machen es ihren Kritikern leicht: Das häufigste Argument, das Linguisten gegen die Programme zugunsten einer geschlechtergerechten Sprache anführen, besteht im Verweis darauf, dass grammatisches und biologisches Geschlecht zwei grundverschiedene Dinge seien. Die Sprachwissenschaftler mögen gute Gründe dafür haben, die Frage, warum "die Lampe" weiblich und "der Tisch" männlich sei, in die Unendlichkeit der Sprachgeschichte zu verweisen: Gegen das Argument, "der Fisch" werde doch stets als etwas Maskulines wahrgenommen, kommen sie nicht an. Die Erklärung, die "Leserin" sei beim "Leser" stets "mitgemeint", mag korrekt sein. Sie muss aber wirkungslos bleiben. Denn das geschlechtspolitisch alarmierte Sprachempfinden wird sich dagegen verwahren, weil sich unter seiner Aufsicht auch der letzte nur grammatisch als männlich markierte "Bäcker" in etwas biologisch Maskulines verwandelt. Gegen ein solches Empfinden ist nur schlecht zu argumentieren - zumal das Ableitungsverhältnis zwischen "Leser" und "Leserin" bestehen bleibt: Der Dominanz des Männlichen entkommt man im Deutschen nicht. Sie ist mit der Sprache gegeben.
Im Englischen etwa ist es leichter, in geschlechtsneutralen Formen zu sprechen: Am Artikel, dem bestimmten wie dem unbestimmten ("the" oder "a"), ist das Genus nicht zu erkennen, und wenn man etwa im Filmgewerbe auf die Gleichheit der Geschlechter achten will, wird nicht von "actor" oder "actress" geredet, sondern von "the male lead" und "the female lead". Zugleich jedoch dürfte der "Ratschlag, man solle doch auf das Deutsche verzichten und aus geschlechtspolitischen Gründen auf eine Sprache ausweichen, die eine Dominanz des Männlichen allenfalls in Ansätzen kennt, in der Praxis nicht viel taugen. Der einzig mögliche Ausweg wird darin liegen, der schlechten Erfahrungen der vergangenen 150 Jahre zum Trotz, einen freien, souveränen Umgang der Geschlechter (in allen Varianten) im Praktischen anzustreben, anstatt ihn über eine Regelung der Sprache, also über etwas mithin Symbolisches, erzwingen zu wollen. Deswegen sollte man auch noch einmal gründlich über eine Arbeitswelt reden, in der das Gebären von Kindern, zu einem Urteil über "die Frau" verallgemeinert, zu einer systematischen Herabsetzung der halben Gesellschaft führt.
Wenn die AfD sich in die Debatte einmischt, kommen dabei nur schiefe Bilder heraus
Eine "Resolution", wie sie in der vergangenen Woche der Verein Deutsche Sprache wider den "Gender-Unfug" in die Welt setzte, ist kein geeignetes Mittel, sich gegen das Programm einer geschlechtergerechten Sprache, gegen seine Widersprüche und gegen seinen Totalitarismus zur Wehr zu setzen, auch wenn diese Erklärung von Monika Maron, Rüdiger Safranski, Sibylle Lewitscharoff oder Judith Hermann unterzeichnet wurde. Eine solche Erklärung bedeutet nur, einen Voluntarismus, der sich mittlerweile in vielen Ämtern und Institutionen durchgesetzt hat, durch einen anderen, notwendig schwächeren ersetzen zu wollen. Und gar verbitten möchte man sich die Kritik am Verlangen nach Gleichheit in der deutschen Sprache, wenn sie von der "Alternative für Deutschland" kommt: "Unter dem Deckmantel, die vorgebliche Diskriminierung von Frauen in der Sprache verhindern zu wollen, sollen durch solche Maßnahmen politische Ziele linksradikaler Ideologen auch sprachlich zementiert werden", mutmaßte Jörg Meuthen, einer der beiden Sprecher der AfD, als der Rat für deutsche Rechtschreibung im vergangenen Jahr über das geschlechtergerechte Schreiben diskutierte. Wie aber soll man sich ein linksradikales Zementieren unter sprachlichen Mänteln vorstellen? Ein begründetes Urteil über die "Schönheit und Vielfalt unserer Sprache" ist von solchen Opportunisten jedenfalls nicht zu erwarten.