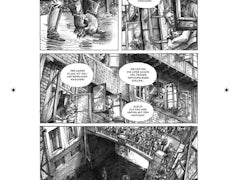Das Böse! Schon wer dessen Namen ausspricht, dem läuft ein Schauer den Rücken herunter. Man solle den Teufel nicht an die Wand malen, warnt der Volksmund. Mehrere neue Bücher tun genau das.

Schlechthin "Das Böse" nennt der Kulturwissenschaftler Terry Eagleton sein Werk, als wäre es ein Thriller auf DVD (im englischen Original etwas essayistischer "On Evil"). Eagleton steigt ein mit einem Fall, der vor einiger Zeit für Entsetzen in der britischen Öffentlichkeit gesorgt hat: Zwei Zehnjährige überfallen, ohne ersichtlichen Grund, ein Kleinkind und quälen es zu Tode. Ein Polizeibeamter, der den Fall untersucht, erklärt, gleich beim ersten Blick auf einen der Täter habe er gewusst, dass dieser böse sei.
Welchen Sinn hat eine solche Aussage? Sie gibt sich rein phänomenal und impliziert doch mancherlei. Der Polizist tut, als wäre er von einem Anblick passiv überwältigt. Ohne dass dies ausdrücklich gesagt werden müsste, liegt darin die Forderung nach Härte notfalls auch gegen Kinder. Die Behauptung, hier einfach das Böse vor sich zu haben, intendiere nichts anderes, als jeden Erklärungs-, und das heißt Entschuldigungsversuch abzuschneiden. "Nichts davon ergibt einen Sinn, aber so ist das nun einmal mit dem Bösen." Dabei scheint dem Polizisten und allen, die seine Sichtweise teilen, zu entgehen, dass gerade die Behauptung, jemand sei absolut böse, diesen der Strafe entziehe.
Wenn wirklich manche Menschen, wie Eagleton es ausdrückt, böse auf dieselbe Weise wären, wie der Himmel blau ist, dann trifft sie daran keine Schuld; und was die praktischen Konsequenzen angeht, so komme man an demselben Punkt heraus wie die verabscheute psychologisch-soziologische Relativiererei, bloß ohne Hoffnung, dass hier jemand gebessert und eingegliedert werden könnte: es laufe hinaus auf Verwahrung ohne begleitendes Sozialprogramm. Um den und das Böse strafen zu können, müssten sie in einem freien Entschluss wurzeln - und spätestens hier tritt das Problem des Bösen von einem juristischen in ein philosophisches über.
"Diesem Buch", sagt Eagleton, "liegt die Auffassung zugrunde, dass das Böse nicht völlig rätselhaft ist, wohl aber die Grenzen alltäglicher sozialer Verhältnisse transzendiert. Das Böse, wie ich es verstehe, ist tatsächlich metaphysisch, insofern es sich gegen das Sein als solches wendet und nicht gegen diesen oder jenen seiner Teile. Grundsätzlich will es das Ganze vernichten."
Damit aber wird dem Bösen der ontologische Teppich unter den Füßen weggezogen, es verwandelt sich in eine bedingte Größe. Da Eagleton das Böse zu einem solchen Schattenwesen degradiert, legt er ihm zuletzt eine Neid- und Verkürzungstheorie zugrunde: Böse ist, wer daran leidet, dass er sich vom Reichtum der seienden Welt ausgeschlossen fühlt. Das ist seichter, als man nach dem scharfsinnigen Start erwartet hätte.
Lesen Sie weiter auf Seite 2, woran die beiden anderen Autoren scheitern.

Haben wir die Bilder vom Krieg inzwischen satt, können wir nicht genug von ihnen bekommen - oder lassen wir uns von ihnen manipulieren? Wie die sozialen Medien den Krieg wieder sichtbar machen, zeigt die Ausstellung "Serious Games" in Darmstadt.
Dem Bösen als einem unbestreitbaren Faszinosum steht Eagleton kategorial wehrlos gegenüber. Alle Reflexionen über das Böse scheinen immer auf den einen Satz Hannah Arendts von der "Banalität des Bösen" weisen zu müssen, geäußert anlässlich des Eichmann-Prozesses. Eagleton will den Satz aus seinem aporetischen Status in den Rang einer eigentlichen Wahrheit erheben: Natürlich, meint er, sei das Böse banal, da ihm alles distinkt Existierende immer als gleichartig wertlos erscheine; das Böse, und zwar gerade das dämonisch Böse, sei vor allem eins, unglaublich langweilig.
Eagleton schreckt in seinem ansonsten klugen Buch ängstlich davor zurück, dem Bösen bis in seine Wurzeln nachzugehen. Er glaubt, Partei für das Gute nehmen zu sollen, noch ehe das Böse ganz erkannt wäre. Infolgedessen endet er verzagt und matt mit einem Porträt des Terroristen. Diesen jedoch beschriebe man wohl treffender als einen Politiker am kürzeren Hebel, welchen er mit besonderem Impetus handhabt, um dennoch Wirkung zu erzielen. Kann Politik böse sein? Das Abgründigste an Eagletons Buch ist seine Widmung: "Für Henry Kissinger".
Nach diesem Verdunstungseffekt, mit dem Eagleton endet, nimmt man erwartungsvoll ein Buch zur Hand, das "Die Lust am Bösen" heißt. Es verheißt, dass hier keine Ausreden durchgehen sollen, sondern der Teufel am Schlafittchen gepackt wird. Eugen Sorg, der Verfasser, unterwegs für das Internationale Komitee vom Roten Kreuz, hat besonders in den postjugoslawischen Bürgerkriegen zu viel gehört und gesehen, als dass ihn die verlegenen Exkulpationen der westlichen Öffentlichkeit nicht aufbringen müssten.
Unausgetragene historische Konflikte seien es, die sich hier Bahn brächen, ein rückständiger Nationalismus, eine panisch um sich schlagende Angst, Irrtum, Vorurteil, Aberglaube, Unwissen? Das alles gleite völlig von jener tiefen Lust ab, mit der man einem früheren Nachbarn und Spielgefährten rostige Nägel durch die Füße bohrt.
Solche und noch schlimmere Dinge aber hat es massenweise gegeben; und nicht Einzelne haben sie begangen, sondern Tausende, ohne Befehl und völlig spontan: begeisterte Urheber waren am Werk gewesen. "Sie (die Medien und Experten im Westen) zogen die Möglichkeit, dass Menschen mit einer genuinen Neigung zum Bösen ausgestattet und durch den Zustand der Gesetzlosigkeit förmlich beflügelt werden könnten, nicht einmal in Betracht."
Sorg hält zu Recht daran fest, dass jegliche "Erklärung" in solchen Fällen den Sachverhalt verfehle, indem sie das Opfer degradiere, den Täter verharmlose, nicht zuletzt dem Erklärenden selbst allzu bequem sei. Aber es scheint im Wesen seines Gegenstands zu liegen, dass dieser, sobald er dingfest gemacht ist, sich in der Tautologie verhärtet: Das Böse, wenn es wirklich das Böse ist, ist - das Böse. Genau dies hatte Eagleton als Problem registriert; und genau hier kommt Sorg nicht weiter. Es bereitet dem Autor zusehends schlechte Laune, er beginnt Fall um Fall aufzuzählen, von Ruanda bis zu den Überfällen in der Münchner Fußgängerzone, wo der "pastorale Therapeutismus" ins Leere gehe. An Gegenbegriffen hat er zu bieten: "Untat", Ursünde", "Verworfenheit", und wenn er poetisch wird: "schwarzer Demiurg".
Fast unmerklich verlagert das Buch sein Augenmerk von der Feststellung, dass das Böse nicht therapierbar sei, auf die Unverbesserlichkeit jener anderen, die nicht sind wie wir. Da wird der iranische Präsident Ahmadinedschad zum "kleingewachsenen Mann mit dem Freizeitjäckchen", der sich der "offenen Verhöhnung des globalen Zivilisationsvertrags" vermisst, weil er eine Atombombe will, die ihm nicht zusteht. Das ist bloß noch wüstes Geschimpfe ohne Erkenntniswert.
Das Buch schließt mit einem Finale furioso wiederum gegen Terroristen und Islamisten. Wo Eagleton in Ermattung strandete, da herrscht bei Sorg eine Wut, bei der man sich fragt, zu wie viel von dem, was sie anderen unterstellt, sie gegebenenfalls selbst fähig wäre.
Lesen Sie weiter auf Seite 3, was das Böse wirklich ausmacht.

Ein Säugling mit Hitler-Bärtchen und in Mini-SS-Uniform: Die Künstlerin Nina Maria Kleivan hat ihre Tochter in Despoten-Kostümen fotografiert - ist das Kunst oder reine Provokation? Die Bilder.
Mit der Lust am Bösen also kommt man nicht voran. Der Psychiater Robert J. Simon versucht es anders, sein Buch heißt (mit deutschem Titel): "Die dunkle Seite der Seele - Psychologie des Bösen". Nun hatte Sorg in seinem ansonsten einigermaßen ärgerlichen Essay doch mit dem einen recht, dass es eine Psychologie des Bösen nicht geben kann: Denn unerwünschten Phänomenen mit Psychologie, also mit Explikation und Therapie zu kommen, heißt eben ihre Qualität des Bösen zu verleugnen oder so weit zu verkleinern, dass es sich mit der Krankenkasse abrechnen lässt.
Der englische Titel hingegen ist geeignet, das anspruchslose theoretische Rüstzeug sichtbar zu machen: "Bad Men Do What Good Men Dream" (wobei man "bad" und "good" am besten mit "schlimm" und "brav" wiedergibt). Wir alle stellen uns gern schlimme Dinge vor, aber nur die Schlimmen unter uns tun sie auch: Darauf läuft es bei Simon hinaus; und man fragt sich, wie ein seit 35 Jahren tätiger Psychiater eine solche Trivialität als den Ausbund seiner Berufserfahrung verkaufen kann.
Im Verlauf des Werks hört man denn auch sehr wenig über das Böse außer gelegentlichem kopfschüttelndem Moralisieren, begleitet von Sentenzen aus den Büchern Jeremia und Hiob; ansonsten arbeitet der Verfasser ziemlich mechanisch seine Tätergruppen ab, die Vergewaltiger, die Stalker, die Amokläufer, die Serienmörder, wobei betont wird, dass die Psychiatrie leider gar nichts für die echten Psychopathen tun könne - also diejenigen, die es am meisten bräuchten.
Warum scheitern alle diese drei Bücher, so verschieden sie sonst sind, an ihrem Gegenstand?
Eagleton, der interessanteste der drei, ist dort am stärksten, wo er sich auf die Paradoxie des Bösen einlässt, auf die beunruhigende Einsicht, dass das Böse als solches zugleich ist und nicht ist, äußerst real und zugleich unfassbar. Sein eigentliches Gegenstück hat es womöglich gar nicht am Guten, sondern an der Zeit. Von der Zeit sagt Augustinus: Solang' ihn keiner frage, was sie sei, wisse er es; frage ihn aber einer, so wisse er es nicht mehr. Das Nachdenken über sie bringt ihre bestürzende Nichtigkeit zum Vorschein, indem sie als Vergangenheit nicht mehr, als Zukunft noch nicht ist und als Gegenwart in der Ausdehnungslosigkeit des Punkts verschwinden; und doch liegt gerade in dieser Nichtigkeit das Bestürzende. Einzufangen ist sie im Grunde nur von der Theologie, die dem Nichtigen durch die wahre Existenz Gottes, den Bezugsrahmen setzt und es daran hindert, bodenlos zu werden.
Nun gehen die drei Autoren, trotz gelegentlicher biblischer Anleihen, sämtlich von säkularen Voraussetzungen aus; und damit bricht das Böse aus seinem umfangenden Rahmen aus und droht als isoliertes metaphysisches Faktum absolut zu werden: ein verwirrender Befund, auf den die drei mit Abwehr und Abkehr antworten, jeder auf seine Weise.
Wo aber hätte das Böse je fassliche Gestalt gewonnen? Vielleicht darf man zum Schluss einen Blick auf "Es" werfen, diesen erstaunlichen Roman von Stephen King. "Es", zunächst völlig amorph, ist als Alien vor vielen Millionen Jahren auf die Erde gestürzt, hat sich über unendliche Zeiträume mit dem Quälen von Tieren mehr schlecht als recht durchgeschlagen und blüht erst auf, als es in Kontakt mit Menschen kommt; "Es" vermag in ihre Psyche hineinzukriechen und sich in ihre schlimmsten Ängste einzufühlen. Deren Form nimmt es an und nährt sich von Seelen, speziell Kinderseelen, denn die haben die meiste Phantasie. Es bedarf dieser Seelen und verhält sich insofern parasitär; aber es bringt sie in ihrer Todesangst auch zum innigsten Daseinszustand, dessen sie fähig sind: In dieser Hinsicht besitzt es primäre Qualitäten.
Das echte Böse, wie es hier erscheint, gründet nicht in einem Mangel an Empathie, im Gegenteil; es kehrt allerdings die Vorzeichen um. Der Samariter und der Sadist: beiden geht durch Mark und Bein, was sie sehen, und beide handeln danach, wenn auch entgegengesetzt.
Im Weltraum geht es furchtbar öde zu; das Glück der Lebewesen bringt schon etwas Schwung in die Bude; noch mehr aber deren körperliche Qual. Und das Intensivste sind Angst und Schmerz in Verbindung mit echter Erkenntnis. "Es" entfaltet dieses Potential auf radikale Weise. Wer einen Menschen zu Tode martert und sich daran weidet, entzündet in der unendlichen Kälte des Weltalls ein Feuerlein, an dessen verzehrender Hitze er sich ein klein wenig wärmen kann.
TERRY EAGLETON: Das Böse. Aus dem Englischen von Heiner Kober. Ullstein Verlag, Berlin 2011. 208 S., 18 Euro.
EUGEN SORG: Die Lust am Bösen. Warum Gewalt nicht heilbar ist. Nagel & Kimche, Zürich 2011, 155 S., 14, 90 Euro.
ROBERT J. SIMON: Die dunkle Seite der Seele. Psychologie des Bösen. Aus dem Englischen von Jürgen Neubauer. Hans Huber, Bern 2011. 327 S., 24,95 Euro.