In ihren Zürcher Poetikvorlesungen vom Herbst 2002 hat Barbara Honigmann ihren Aufbruch in eine Schriftstellerexistenz auf den Sommer 1976 datiert. Da lebte sie in Berlin, der Hauptstadt der DDR, war 27 Jahre alt, hatte mit dem Malen schon begonnen, trug ihr erstes Kind aus, arbeitete als Dramaturgin und Regisseurin in verschiedenen Theatern und schrieb eine Bühnenversion des Märchens "Das singende, springende Löweneckerchen" aus der Sammlung der Brüder Grimm. Und sie trat in die jüdische Gemeinde ein. Das Märchen war erfolgreich, auch als Hörspiel, Kinderschallplatte und Trickfilm, es sicherte ihre ökonomische Existenz. Das Bekenntnis zum Judentum als Glaubensgemeinschaft war, so hat sie es in mehreren Büchern geschildert, eine Art innerer Ausreise aus der DDR.
Auf den Sommer 1976 folgte der Herbst, in dem Wolf Biermann in Köln sang und danach ausgebürgert wurde. Es begannen, ohne dass das Ende sichtbar gewesen wäre, die späten Jahre der DDR. Barbara Honigmann verließ das Land 1984, ging über Paris nach Straßburg, zwei Jahre später erschien ihr literarisches Debüt, der Erzählungsband "Roman von einem Kinde".
Der Roman, den das Debüt im Titel trug, war eine Fiktion. Das Werk, das mit diesem Debüt begann, gewinnt seine Gestalt und seinen Ton dadurch, dass Barbara Honigmann, die ihre Stoffe immer wieder dem eigenen Leben oder dem Leben ihrer Eltern entnimmt, die Romanform, etwa den dickleibigen Familienroman, immer wieder ausschlägt. Sie schreibt Porträts, gelegentlich in Form von Briefen, meist aber in Form der autobiografischen Erzählung, und wie eine Malerin gibt sie sich selten mit einer Version des Porträts zufrieden.
Ein schlichter Satz ihrer Poetikvorlesungen nennt dafür den Grund: "Auch nach ihrem Tod verändern sich die Menschen noch."
Nun, zu ihrem siebzigsten Geburtstag am 12. Februar, ist "Georg" erschienen, ein Buch über ihren Vater. Nicht zum ersten Mal steht Georg Honigmann, der 1903 in Wiesbaden geboren wurde und 1984 in Weimar starb, im Zentrum eines der Bücher seiner Tochter. In "Eine Liebe aus nichts" (1991) reiste die Ich-Erzählerin von Paris aus mit einem eng begrenzten, kompliziert zu beantragenden Visum wieder in die DDR ein, die sie soeben verlassen hatte, um am Begräbnis des Vaters teilzunehmen. Und so trat der Tote in den Anfangssätzen dem Leser gegenüber: "So, wie er es in einem hinterlassenen Brief - nicht etwa einem Testament, nur einem Brief, ein paar Zeilen auf einem karierten Zettel - gewünscht hat, ist mein Vater auf dem jüdischen Friedhof von Weimar nach den Vorschriften begraben worden. Auf dem kleinen Friedhof, der ein Stück weit von der Stadt liegt, ist seit Jahrzehnten niemand mehr begraben worden, und man konnte sich über den Wunsch meines Vaters nur wundern, denn er hatte in seinem ganzen Leben überhaupt keine Verbindung zum Judentum und nicht einmal einen hebräischen Namen."
Als Mahnmal und Gedenkstätte wurde der verfallene jüdische Friedhof in Weimar 1983 wiederhergerichtet, ein Jahr vor dem Tod Georg Honigmanns. Außerhalb der Stadt liegt er nicht, als Begräbnisstätte diente er nicht mehr. Im neuen Buch, "Georg", liegt der Vater denn auch "nach seinem Wunsch auf dem jüdischen Friedhof in Berlin-Weißensee begraben, manchmal besuche ich sein Grab, er liegt dort unter lauter fremden Menschen".
Die Frage nach dem Judentum des Vaters, die beide Bücher verbindet, bleibt von der literarischen Umbettung unberührt. Sie führt ins Zentrum der Lebensgeschichte Barbara Honigmanns und ihrer Eltern, die 1946 aus dem englischen Exil nach OstBerlin gingen, um dort den Sozialismus aufzubauen. Zu Beginn ihres Buches "Ein Kapitel aus meinem Leben" (2004) hat die Tochter ihr Aufwachsen in einer Villa in Karlshorst beschrieben. Hier stand die Mutter im Vordergrund, Litzy, in Wien geboren, einer ungarisch-jüdischen Familie entstammend, die gegen Ende der Zwischenkriegszeit ein mondänes Leben in Paris führte, ehe sie angesichts einer drohenden Besetzung durch die Deutschen nach London ging. Nicht ein Lebenskapitel der Tochter, sondern der Mutter gab dem Buch den Titel, ihre Ehe mit Kim Philby, der 1963 als sowjetischer Spion enttarnt wurde. "Ich möchte gern in meiner Eigenart des Schreibens und nicht in meiner Eigenart des Lebens wahrgenommen werden," hat Barbara Honigmann einmal geschrieben. Der Satz ist ein Stoßseufzer angesichts der Neigung des Publikums, den Lebensstoff, der in einem Stück Literatur enthalten ist, wichtiger zu nehmen als die Form, in der er gestaltet ist. Honigmanns Umgang mit der zeithistorischen Dimension ihres autobiografischen Erzählens ist gegen die Privilegierung der "Eigenart des Lebens" auf Kosten der "Eigenart des Schreibens" gerichtet. "Es war grausam, Ethel und Julius Rosenberg hinzurichten, aber unschuldig waren sie nicht', sagte meine Mutter, während sie vor dem Spiegel ihre wilde Frisur in irgendeine Ordnung zu bringen versuchte."
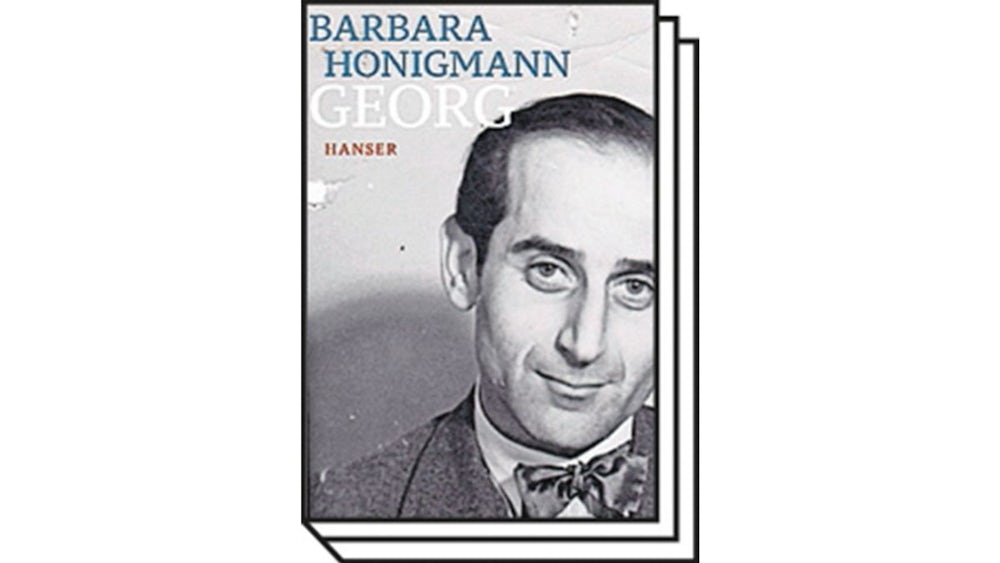
Das Wissen der Mutter in diesem Anfangssatz des ihr gewidmeten Buches führt tief hinein in die Geschichte der sowjetischen Spionage. Aber die Erzählung wird die Balance wahren zwischen der zeithistorischen Dimension und der Frisur und Haarfarbe der Mutter und daran arbeiten, sie in eine Figur zu verwandeln, die ihr literarisches Leben unabhängig von ihrer Beglaubigung durch die Wirklichkeit führt.
Dieser Verwandlung unterliegt nun, in "Georg", der Vater. Die Umrisszeichnung ähnelt der in "Eine Liebe aus nichts". Er ist der Journalist aus bürgerlichem Hause, der in Hessen aufwuchs und die Odenwaldschule unter dem Reformpädagogen Paul Geheeb besuchte, der Feuilletonautor der Vossischen Zeitung in Düsseldorf und Paris, der Exilant, der als enemy alien aus London in ein Internierungslager nach Kanada gebracht wurde, der Mann mit vier Ehen und vielen Affären, der die Mutter, seine zweite Ehefrau, für eine Schauspielerin verlässt, die nach dramatischer Trennung eine weitere Nachfolgerin findet: "Mein Vater heiratete immer dreißigjährige Frauen. Er wurde älter, aber seine Frauen blieben immer um die Dreißig."
Zur Umrisszeichnung gehört auch die Abwehr und Bagatellisierung des eigenen Judentums zugunsten der politischen Mission. Aber wie sich in "Georg" die Figur der Schauspielerin durch den Namen Gisela an die - ebenfalls aus Hessen stammende - Schauspielerin und Sängerin Gisela May annähert, die Diva der DDR, so wird auch der Satz "er hatte in seinem ganzen Leben überhaupt keine Verbindung zum Judentum" noch einmal genauer betrachtet. Und revidiert. In diesem neuen Porträt tritt die Genealogie der Herkunftsfamilie leuchtend hervor, Aktenvermerke des britischen Geheimdienstes wie der Staatssicherheit klassifizieren seine jüdische Physiognomie, und als er über das Rentenalter schon hinaus ist, nähert er sich einem Stoff, von dem die Tochter meint, darin könnte ein Buch stecken, das er womöglich gern geschrieben hätte: "Georg vertiefte sich, während er seine Bücher über die kapitalistische Monopolpresse und die Manipulationen durch die Pressezaren Hearst und Hugenberg schrieb, in die Auseinandersetzungen über den Platz der Juden in der Gesellschaft, die sein Großvater und dessen Mitstreiter im Preußen des 19. Jahrhunderts geführt hatten. Da man in der Staatsbibliothek nicht so viele Kopien anfertigen konnte, schrieb er die Texte und Argumentationen des Für und Wider die Emanzipation der Juden teilweise Seite für Seite mit der Hand ab und versah sie am Rande mit vielen Ausrufungszeichen".
Nicht ohne Pathos, mit deutlich hörbarem Anklang an die Feuerbachthese von Karl Marx, hat Barbara Honigmann einmal geschrieben: "Alle Menschen haben eigenartige Lebensgeschichten. Es kommt aber darauf an, sie zu verändern." Das ist ihr in "Georg" ganz ohne Pathos gelungen.