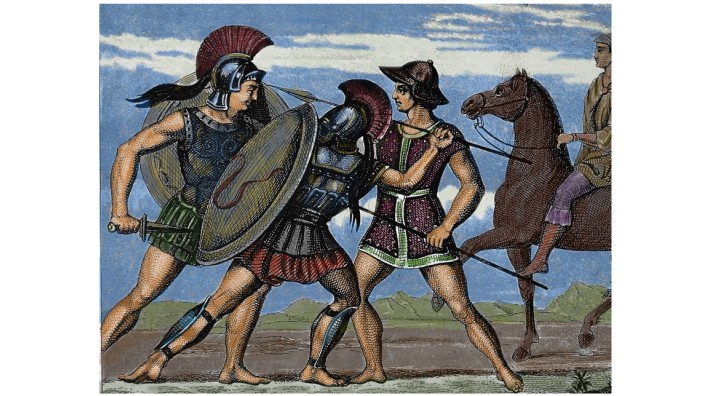Am Ende brannte die Stadt lichterloh, die Männer waren tot, die Frauen erwartete ein furchtbares Schicksal, sie waren Beute der Sieger. Andromache, die Witwe des Heerführers Hektor, sagt zu ihren trauernden Leidensgenossinnen: "Doch Sterben ist besser noch als das Leben voller Jammer. Den Toten kümmert's nicht, wenn er ein Leid erfuhr."
Als der Athener Dramendichter Euripides 415 v. Chr. die Tragödie "Die Troerinnen" erstmals aufführt, weiß jeder Zuschauer, was es bedeutet, wenn er den Heldenmythos vom Sieg der Griechen über Troja nicht wie Homer aus Sicht der Krieger und Götter, sondern aus jener der Opfer erzählt. "Die Troerinnen" werden noch heute aufgeführt, als zeitlose Anklage gegen den Krieg; damals aber war das Stück ein Mittel radikaler politischer Kritik.
Im Vorjahr hatte Athens mächtige Flotte den abtrünnigen Bundesgenossen Melos angegriffen, ein Heer die Insel besetzt, die Stadt gestürmt, alle Männer getötet und überlebende Frauen und Kinder in die Sklaverei verkauft. Athen, die politisch und kulturell bedeutendste Stadt Griechenlands, Mutter der Demokratie, hatte die Unschuld verloren, endgültig. Im "Melier-Dialog" beschreibt der Historiker Thukydides später die ideologische Begründung des Massakers: Es ist das schiere Recht des Stärkeren.
In fast dreißig Jahre andauernden Kämpfen zerstörte eine Hochkultur sich selbst
Der Peloponnesische Krieg war fast 16 Jahre alt, als Melos in Blut und Feuer versank, dennoch war hier ein Tiefpunkt erreicht. Dieser (fast) dreißigjährige Krieg, von dem sich die Welt der griechischen Antike niemals wirklich erholen sollte, ist ungewöhnlich gut und detailreich überliefert, weil Thukydides und nach ihm Xenephon eine ausführliche Geschichte des Dramas aufschrieben. Der deutsche Philosoph Georg Wilhelm Friedrich Hegel sagte 1822 darüber: "Dieses unsterbliche Werk ist der absolute Gewinn, welchen die Menschheit von jenem Kampf hat."
Entsprechend intensiv hat die Geschichtswissenschaft den Peleponnesischen Krieg untersucht. Der Bonner Althistoriker Wolfgang Will legt nun ein weiteres Buch vor, und die Frage, was ein solches noch Neues erzählen kann, ist leicht beantwortet. Er berichtet nicht nur von Kämpfen und Feldzügen, sondern auch von Menschen und Strukturen - vor allem aber von der Selbstzerstörung der höchsten Kultur, welche Europa bis dato gesehen hatte, jener des klassischen Griechenlands.
Es ist eine Geschichte von Hybris und Machtstreben, die stärker werden als die Vernunft. Insofern ist es eine sehr aktuell anmutende Geschichte, die aufschlussreiche, ja bestürzende Parallelen erkennen lässt zu der im Inneren tief verunsicherten Welt des Westens und der Demokratien und zum Aufstieg der Populisten heute. Der sorgfältige Althistoriker Wolfgang Will zieht solche Analogien allerdings kaum. Er lässt seine Geschichte für sich sprechen, und was sie uns zu sagen hat, ist eindeutig genug.
Im Jahre 431 vor Christus liegen die Perserkriege ein Menschenalter zurück. Der Ansturm der östlichen Großmacht auf die freien Stadtstaaten Griechenlands war bei Salamis und Plataiai gescheitert, ihr Selbstbehauptungswillen hatte den Griechen eine Zeit der kulturellen und wirtschaftlichen Blüte gebracht. Der Attische Seebund beherrschte das östliche Mittelmeer, seine Vormacht Athen erfreute sich jenes demokratischen Regierungsmodells, aus dem, viel später, die freie Welt hervorgegangen ist. Stärkste Landmacht blieb der Soldatenstaat Sparta, der bei Schülern zuletzt durch die Comic-Verfilmung "300" eine für Althistoriker durchaus überraschende Popularität gewann.
Athen unterstützte andere Stadt-Demokratien, Sparta eher die Oligarchen. Die Rivalität wuchs. Bei Lichte besehen konnten beide Mächte kein Interesse an einem Krieg gegeneinander haben - er würde Menschen, Ressourcen, Städte verschlingen, bei höchst ungewissem Ausgang. Und doch haben sie ihn begonnen und 27 Jahre lang voller Härte und mit stupider Unnachgiebigkeit geführt und ihre Welt dabei irreparabel zerrüttet.
Wolfgang Will schildert das Drama des Bruderkriegs lebendig, mitunter fesselnd und immer anschaulich. Niemand sollte zurückschrecken vor all den Harmosten, Ekklesiazusen und Perioiken, die sein Buch zahlreich bevölkern - der Autor hat ein schönes Glossar ans Ende gestellt, das all dies erklärt. Die Sozialgeschichte kommt nicht zu kurz und auch nicht eine Macht, gegen welche die Menschen noch viele medizinische Revolutionen später nicht gefeit sein werden: die Seuchen. 430, im zweiten Kriegsjahr, traf eine Seuche Athen mit ganzer Wucht, die Stadt hatte das Unglück selber provoziert. Der Mensch bereitete der Pandemie den Boden.
Die Strategie des großen Athener Staatenlenkers Perikles sah vor, den gefürchteten Hopliten - gepanzerten Fußsoldaten - Spartas besser nicht in offener Feldschlacht zu begegnen, sondern dank der Kriegsschiffe, der Trieren, die empfindlichen Küsten des Gegners, die Gestade des Peleponnes, zu treffen und seine Wirtschaft zu zerrütten. Athen selbst war schwer befestigt und durch die "Langen Mauern" mit seinem Seehafen Piräus verbunden. In diesen geschützten Raum zwischen Stadt und Hafen floh die Landbevölkerung und sah von den Zinnen aus hilflos zu, wie die Spartaner Felder, Dörfer, Weinstöcke verwüsteten; der Krieg gegen Zivilisten wurde bald zu einem der Merkmale dieses Konflikts. In den dicht gedrängten Zelt- und Hüttenlagern zwischen den Langen Mauern verbreitete sich eine pestartige Seuche wie ein Feuer auf Stroh. Tausende gingen elend zugrunde, unter ihnen Perikles, Opfer seiner eigenen Politik. Das war der Krieg neuen Stils: "Drinnen starben die Menschen, draußen verödete das Land", schrieb Thukydides.
Folgt man Wolfgang Will, dann hatte die Demokratie Athens aber einen noch gefährlicheren Feind als die Pandemie oder die Speerkämpfer Spartas: nämlich sich selbst. Will hat schon als junger Dozent in den Achtzigerjahren manch altgedienten Kollegen in seinem Bonner Altgeschichts-Seminar mit der Frage irritiert, ob Athens Seebund bei all seinen Kulturen verbindenden, Schutz bietenden Vorzügen nicht auch ein Instrument des schieren Imperialismus war. Je mächtiger Athen wurde, desto ohnmächtiger erschienen die Werte von Freiheit und Selbstbestimmung, für die es zu kämpfen vorgab.
Noch immer wirkt das Bild nach, in diesem Krieg habe die Demokratie gegen die Tyrannis gekämpft und am Ende verloren. Will sieht das differenzierter: Durch den Krieg wurde die "imperiale Demokratie" ihren Feinden immer ähnlicher. Als sie 404 am Boden lag, so berichtet Xenophon, "bekränzten sich ihre Bundesgenossen und feierten".
Die Befürworter der Oligarchie etikettierten den Sturz der Demokratie als Rückkehr zu ihr
Je länger der Krieg dauerte, desto mehr gewannen die Demagogen und Hetzer an Boden. In Athen selbst, schreibt Will, erzeugten sie "ein Klima der Angst und Einschüchterung, der Verdächtigungen und des Verfolgungswahns". Im Winter 415 setzte Athens Kriegspartei per Volksabstimmung jenen Feldzug durch, der die Kräfte der Stadt überspannte und in einer furchtbaren Niederlage enden sollte: die Flottenexpedition nach Sizilien, wo das reiche, mächtige Syrakus lockte. Kaum einer all der Schwerbewaffneten und Marinesoldaten, die meisten von ihnen Bürger der Stadt, kehrte zurück.
Eine interessante Parallele zur Gegenwart ist das Verhalten der Oligarchen, die 412 im vom Krieg zerrütteten Athen die Demokratie zu stürzen trachteten. Anders als in früheren Zeiten führten sie diesen Angriff nicht offen: "So etikettierten denn die Befürworter der Oligarchie den Sturz der Demokratie als Rückkehr zu ihr", schreibt Will. Auch Populisten gab es bereits, nur allzu gern bereit, sich die demokratische Ordnung aus Eigennutz untertan zu machen. Zu diesen zählte der Athener Hyperbolos, ein entschlossener Kriegstreiber, der seinen Mangel an Eignung durch die Fähigkeit ausglich, seine Sache als die des Volkes und seine Feinde als dessen Feinde zu inszenieren. Thukydides schreibt: "Dieser Hyperbolos ließ sich durch Schmähungen nicht erschüttern und war unempfindlich aus Mangel an Ehrgefühl - eine Schamlosigkeit und Abgebrühtheit, die manche Mut und Mannhaftigkeit nennen, und war eigentlich keines Menschen Freund."
Was die Hochkultur der griechischen Polis nach diesem Krieg auf lange Sicht erwartete, das haben "Die Troerinnen" des Euripides schon vorweggenommen. Jeder Zuschauer, der das Theater verließ, hat es gewusst: "Dann sind die Sieger in Meeresstrudeln ertrunken, von Zyklopen gefressen, dem Wahnsinn verfallen, an Felsen zerschlagen, von Mördern erschlagen, haben den Freitod gewählt oder irren noch auf dem Meer umher." Kaum einer der Griechen aus Homers "Ilias" überlebt den Triumph über Troja lange. Die Seherin Kassandra hat es ihnen vorhergesagt: "Es gibt keine Sieger."
Athen erholte sich im 4. Jahrhundert noch einmal von der Niederlage, aber nicht auf Dauer; am Ende war, so Wolfgang Will, "vom demokratischen System nur noch eine tote Hülle" übrig: "Von der Demokratie blieb die Idee."
Wolfgang Will: Athen oder Sparta. Die Geschichte des Peloponnesischen Krieges. Verlag C.H. Beck, München 2019. 352 Seiten, 26,95 Euro.