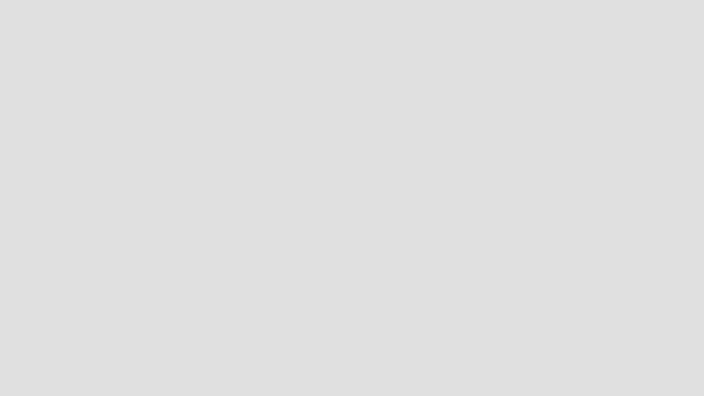Moment einmal, spricht hier nicht eine Amerikanerin? Eine Vertreterin jenes Landes also, dessen Grundphilosophie alles für denkbar, machbar und erreichbar hält, von der Marslandung über den sauberen Drohnenkrieg bis hin zum genetisch perfektionierten Menschen? Anne-Marie Slaughter ist Amerikanerin, und sie hat, drei Jahre nach ihrem millionenfach gelesenen und kommentierten Atlantic-Aufsatz "Why women still can't have it all" (Warum Frauen immer noch nicht alles auf einmal haben können), ein Buch über Arbeiten, Leben und Familie geschrieben, das tatsächlich recht unamerikanisch daherkommt. Damit eröffnet sie eine Debatte, die man sogar als Kapitalismuskritik interpretieren könnte.
Im Kern sagt Slaughter in "Unfinished Business - Women, Men, Work, Family" (Random House), dass all jene, die auf das "alles auf einmal haben" pochen, mal über ihre Werte nachdenken sollten. "Competition and care", Wettbewerb und Fürsorge, seien schon immer zentrale Pole und Treiber des menschlichen Miteinanders und Fortschritts gewesen. Dies bestätigten Anthropologen, Soziologen, Psychologen und Neurowissenschaftler. Es sei an der Zeit, der Fürsorge in diesem Wertesystem wieder mehr Raum zu geben.
Das heftigste Reinhängen hilft nichts, wenn es das Leben anders will
Slaughters Buch ist praktisch die Gegenrede zu Sheryl Sandbergs Bestseller "Lean In", den sich nach seinem Erscheinen 2013 viele ambitionierte Frauen zur Erbauung neben den Schreibtisch gelegt hatten. Die Facebook-Managerin hatte darin zwar die frauen- und familienfeindliche Kultur in der Unternehmenswelt angeprangert und damit vielen aus der Seele gesprochen. Aber sie hatte vor allem Frauen aufgefordert, daraus Konsequenzen zu ziehen: sich nicht unterkriegen lassen, dranbleiben und eben - reinhängen.
Anne-Marie Slaughter hingegen argumentiert, dass das heftigste Reinhängen nichts hilft, wenn es das Leben anders will. Wenn das Kind behindert zur Welt kommt, die Eltern dement werden, der Teenager-Sohn - wie in Slaughters Fall - plötzlich von der Polizei aufgelesen wird. Deshalb hatte sie sich einst auch gegen eine weitere Karriere in Hillary Clintons Außenministerium entschieden und den berühmten Aufsatz verfasst.
Was für die einen wunderbar funktioniere, die Vereinbarkeit von Karriere und Beruf, müsse es für die anderen noch lange nicht, auch wenn sie ebenso wild entschlossen seien, argumentiert Slaughter. Die Tragik ist, dass Sheryl Sandberg das Fragile am Leben in diesem Jahr selbst besonders hart zu spüren bekommen hat, als ihr Mann, der Vater ihrer zwei Kinder, im Familienurlaub tödlich verunglückte.
Die nächste Stufe der Geschlechterdebatte
Slaughters Buch ist deshalb so interessant, weil es eine dritte Diskussionslinie in der Geschlechterdebatte aufmacht. Während sich die einen damit beschäftigen, an den Frauen herumzuschrauben und sie fitter für den Wettbewerb in einer männlich geprägten Arbeitswelt zu machen, geht es den anderen darum, die Strukturen zu verändern. Es müssten mehr Kita-Plätze, mehr Ganztagsschulen, mehr Diversity-Trainings für Männer und Frauen her, dann gehe das schon, wird da argumentiert. Je nach kultureller Prägung der Fordernden ist dafür eher der Staat oder die Privatwirtschaft zuständig.
Geldverdienen wird höher bewertet als Fürsorge
Slaughter hingegen will die Debatte auf die nächste Stufe heben. Natürlich hat sie auch eine Wunschliste vor allem für Unternehmen parat. Und natürlich fordert sie mehr Wertschätzung für Männer, die sich um ihre Familien kümmern - das richtet sie auch an die Adresse von deren Ehefrauen, die ihre Männer endlich mal machen lassen sollten.
Aber darüber hinaus stellt sie das gesamte Wertegefüge infrage, auf dem die kapitalistische Wirtschaft basiert: dass nur der oder die etwas wert sind, die für Lohn arbeiten. "Die Wahrheit ist, dass wir Menschen mehr wertschätzen, die in sich selbst investieren, als diejenigen, die in andere investieren, das gilt für beide Geschlechter", schreibt Slaughter. Eine Gesellschaft, die Geldverdienen höher bewerte als Fürsorge, sei blind für die Kosten, die durch Vernachlässigung entstehen.
"Fix the values" statt "fix the women"
Die Diskussion entwickelt sich also weiter, auf Englisch ausgedrückt von "fix the women" über "fix the system" hin zu "fix the values", von der Arbeit an den Frauenrechten zur Arbeit am System und schließlich an den Werten. Was ihr nur guttun kann. Allerdings dürfte diese neue Stufe noch schwieriger zu erklimmen sein als die anderen, für die es immerhin ein paar handfeste Lösungen gibt. Denn Werte sind gesellschaftlich tief verankert und geben Sicherheit; Wertesysteme ändern sich entsprechend langsam.
Globale Fürsorge-Lücke
Viele Frauen überall auf der Welt haben sich in den vergangenen Jahrzehnten schon ein gehöriges Stück auf den Weg gemacht, weg von ihrer reinen Fürsorge-Rolle hin zu einer Position im ökonomischen Wettbewerb. Diese Vielfalt tut der Wirtschaft gut, und sie tut vielen Frauen gut; man sollte sie deshalb nicht wieder in die Gegenrichtung treiben, und das will Slaughter ganz sicher nicht bezwecken.
Nur täte es der Gesellschaft gut, wenn sich ebenso viele Männer in die umgekehrte Richtung auf den Weg machen würden. Denn das wird selten offen diskutiert, weil es meistens den Frauen auf die Füße fällt: Wenn alle in die Erwerbstätigkeit streben und sämtliche Aufgaben, die der Liebe bedürfen, in bezahlte Arbeit umgewandelt werden, entsteht eine gewaltige Fürsorge-Lücke. Auf diese Weise entwickeln sich globale Fürsorgeketten, also um die Welt ziehende Haushälterinnen, Pflegerinnen und Dienstboten, an deren Ende Kinder und Alte oft alleine zurückgelassen werden.
Sie sei eine Vertreterin des weißen Mittelschichten-Feminismus
Aus diesem Grund belässt es Slaughter in ihrem Buch auch nicht bei den üblichen Forderungen nach flexiblen Arbeitszeiten, bezahlter Elternzeit und einer anderen Arbeitskultur, die für Familien in vielen europäischen Ländern zum Teil ohnehin Selbstverständlichkeiten sind. Denn damit ist der Fürsorge-Krise nicht beizukommen. Die Juristin und Princeton-Professorin, die heute Geschäftsführerin des Think Tanks New America Foundation ist, hat sich spürbar die Kritik an ihrem Ursprungs-Aufsatz zu Herzen genommen.
Ein wiederkehrender Vorwurf war, sie sei eine Vertreterin des weißen Mittelschichten-Feminismus; es gehe ihr nur um Karrieren ohnehin schon privilegierter Frauen. Die vielen anderen, die schlicht um ihr Auskommen ringen, kämen weder bei ihr noch bei Sandberg vor.
Tatsächlich ist die Leistung vieler dieser Frauen in der Fürsorge nicht nur unbezahlt, sondern auch unbezahlbar. Slaughter erkennt deshalb an, dass gerade schwarze Frauen in Amerika eine zentrale Rolle dabei übernommen haben, weißen Frauen Karrieren zu ermöglichen, indem sie deren Kinder aufgezogen haben. In Ländern, in denen Arbeitskraft billig ist, haben Mittelschicht-Frauen mit der Vereinbarkeit von Beruf und Familie deshalb weniger Probleme als in egalitären Gesellschaften. Fachbegriffe gibt es dafür auch schon - da geht es um den "plutocrat feminism" der Eliten gegen den "intersectional feminism", der alle Gesellschaftsbereiche umfasst.
Fürsorge muss ein wichtiger Wert werden
Wenn man die Ungerechtigkeit der globalen Arbeitsverteilung nicht verstärken möchte, gibt es nur den von Slaughter skizzierten Weg: Fürsorge muss ein so wichtiger Wert, eine so attraktive Aufgabe werden, dass sie, wenn sie auf dem Arbeitsmarkt angeboten wird, entsprechend gut vergütet wird - was auch heißt, dass Kita- und Pflegeplätze noch deutlich teurer werden müssten. Und sie muss gesellschaftlich so anerkannt werden, dass Männer und Frauen stolz darauf sein können, zumindest in bestimmten Lebensphasen für andere zu sorgen oder gesorgt zu haben.
Slaughter zitiert als Beleg US-Präsident Barack Obama mit den Worten, dass er auf seinem Totenbett sicher nicht darüber nachdenken werde, welches Gesetz und welche Politik er durchgesetzt habe. Er werde seinen Lebenserfolg daran messen, ob er seiner Familie gerecht geworden sei. Ist man erst einmal Präsident, sagt sich das allerdings leicht.