Der silberfarbene Ford C-Max hängt zwei Meter hoch in der Luft, direkt über seinem Genick. Curtis trägt Ohrstöpsel und gelbe Arbeitshandschuhe, der Hydraulikschrauber in seiner Faust surrt. Er legt den Kopf in den Nacken, gleich wird es krachen, wenn er die Hinterachse festzieht. "Na, Curtis?", fragt der Geselle. "Läuft", sagt Curtis.
Eine Werkstatthalle in Hamburg-Barmbek, Männer in grauer Kluft zwischen aufgebockten Autos, Werkzeugbänken und Stapeln mit Ersatzteilen: Das ist der Ort, an dem Curtis Sander, 18, erwachsen werden soll. Wenn man denn die Lehre so sieht, wie sie einst gedacht war, seit ihren Anfängen im Mittelalter, als sich die Berufsstände und Zünfte herausbildeten und mit ihnen eine besondere Tradition der Weitergabe von Wissen: vom Meister auf den Lehrling. Als Kind in die Lehre, als Geselle auf Wanderschaft, bevor man selbst Meister werden durfte.

Unternehmer Wagdi Najmeddin kam einst als Asylbewerber nach Deutschland. Heute bildet er Deutsche und Migranten aus und weiß, was zum Berufsstart schiefgeht.
Das mit der Walz ist heute Folklore, auch sonst verläuft das Leben eines Lehrlings im 21. Jahrhundert etwas prosaischer, auch im Autohaus Hermann Claaßen. Im Kern jedoch sind es für den Kfz-Mechatronik-Azubi Curtis die gleichen Aufgaben geblieben, wenn er wie an diesem Morgen nach dem Schrauben die Muttern überprüft: Er soll zuschauen und nachmachen, er soll ausprobieren und den Gesellen zur Hand gehen, und wenn alles gut geht, hält er im Frühjahr 2022 den eigenen Gesellenbrief in der Hand.
Halbherzig schrieb Curtis Bewerbungen und bekam nur Absagen
Dass es so weit kommt, hätte Curtis noch vor Kurzem selbst kaum glauben können, denn seine Geschichte ist auch die Geschichte eines in die Krise geratenen dualen Ausbildungssystems und von den Anstrengungen der Politik, einen Ausweg zu finden. Curtis erzählt sie im Pausenraum der Werkstatt, an einem schmucklosen Furnierholztisch, und er erzählt in einer Tonlage, als habe sie wenig mit ihm zu tun.
Eigentlich hatte Curtis Abitur machen wollen. Er wusste zwar nicht, was er danach machen sollte, aber das war der Plan. Bis ihm seine Lehrer auf der Stadtteilschule kurz vor Ende der zehnten Klasse eröffneten, dass das nichts wird. Schuld sei seine Deutschnote, sagten sie. Und so brauchte Curtis, damals 16, plötzlich einen Ausbildungsplatz. Das war im Mai, und das Ausbildungsjahr startete am 1. August.
Halbherzig schrieb er ein paar Bewerbungen, bekam eine Absage nach der anderen. Oder gar keine Antwort. Vielleicht lag es daran, dass schon alle Lehrstellen besetzt waren. Vielleicht verrieten ihn auch seine Bewerbungsschreiben. Doch wie sollte er sicher sein, was das Richtige für ihn ist?
Der 1. August kam, und es blieb dabei: Curtis fand keinen Platz. Innerhalb von drei Monaten war aus dem angehenden Abiturienten ein Problemfall geworden. Zumindest reden Politiker und Journalisten so, wenn sie die fast 300 000 schulpflichtigen Jugendlichen meinen, die jedes Jahr ohne Ausbildungsplatz bleiben. Die im sogenannten Berufsvorbereitungsjahr landen, im "Übergangssektor", wie der Nationale Bildungsbericht ihn nennt. Die dort "geparkt werden", wie Kritiker es formulieren, bis ihre Schulpflicht endet.
Fest steht: Viele dieser Jugendlichen werden ihr Leben lang keine Berufsausbildung abschließen, 2016 hatten 14,5 Prozent der 25- bis 34-Jährigen keinerlei Berufsabschluss. Und das in Zeiten, in denen Unternehmen klagen, dass ihnen die Azubis fehlen. Die Berufsbildungsforscherin Susan Seeber von der Universität Göttingen kritisiert, dass die meisten Firmenchefs sich den Kopf zerbrächen, wie sie noch mehr Abiturienten anlocken können, um die Lücken zu stopfen. "An die Jugendlichen am unteren Rand denkt kaum einer."
Die Zahlen waren auch in Hamburg so erschreckend, dass Bildungssenator Ties Rabe (SPD) sie noch heute aus dem Stegreif aufsagen kann: Nur einer von vier Hamburger Schulabgängern schaffte es 2012 nach der zehnten Klasse in eine Ausbildung. Die anderen 75 Prozent kamen ins Berufsvorbereitungsjahr. Das sollte sie im zweiten Anlauf fit machen, doch gelang der direkte Übergang in eine Lehre danach gerade mal bei zehn bis 20 Prozent der Teilnehmer. "Eigentlich ein Skandal", sagt Rabe.
So haben sie sich in Hamburg 2012 an die große Reform gemacht. Sie führten ein eigenes Pflichtschulfach Berufs- und Studienorientierung ab Klasse acht ein, und aus dem Berufsvorbereitungsjahr, das fast nur in der Berufsschule stattfand, wurde das "AVdual". Anstatt irgendwelche Werkstattarbeiten zu simulieren, gehen die AVdual-Schüler wie echte Azubis in echte Betriebe. Als Praktikanten zwar, aber sonst läuft es fast wie in einer dualen Ausbildung zwischen Berufsschule und Arbeitsplatz.
"Es hat doch keinen Sinn ergeben, dass wir ausgerechnet die Jugendlichen mit den schwierigsten Schulerfahrungen noch mal ausschließlich zur Schule geschickt haben", sagt Rabe. Nebenbei lernen die Firmen im AV dual ohne Risiko potenzielle Azubis kennen - die sie womöglich nie genommen hätten, wären sie durch einen Lehrvertrag gebunden gewesen.
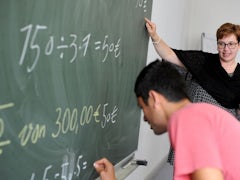
Die Hälfte der Berufsschullehrer geht bis 2030 in den Ruhestand. Für ihre Stellen gibt es viel zu wenig Anwärter. Das ist nicht nur für Azubis und Betriebe ein Problem, sondern für die ganze Gesellschaft.
Seit das AV dual in Hamburg das BVJ abgelöst hat, ist die Übergangsquote auf 50 Prozent gestiegen, ein bemerkenswerter Erfolg, wie die Berufsforscherin Susan Seeber bestätigt. "Er zeigt, dass die Größe des Übergangssystems kein Naturgesetz ist, dass man es mit den richtigen Maßnahmen merklich verkleinern kann."
Klingt alles so naheliegend, dass das eigentlich Überraschende ist, warum es so lange dauerte, bis mehr und mehr Bundesländer auf eine duale Ausbildungsvorbereitung aufgesprungen sind. Inzwischen sind es laut Forscherin Seeber neun. Sie nennt zwei Gründe für die Zurückhaltung: Das neue Modell funktioniert nur, wo es genügend Betriebe gibt, die mitmachen. Und: Es ist sehr betreuungsintensiv. Denn wenn der Kern von AV dual ist, dass die Jugendlichen in die Betriebe kommen, um zu bleiben, dann kommt ausgerechnet den Berufsschullehrern eine Schlüsselrolle zu.
Im Fall von Curtis übernahm die Marius Dose. Als Curtis bei der ersten Firma anrief, um sich nach einem Praktikum zu erkundigen, saß Dose neben ihm. Und als eine Werkstatt für Oldtimer zusagte, kam er Curtis dort regelmäßig besuchen. "Das ist vor allem Beziehungsarbeit, die wir leisten", sagt er und freut sich, seinen ehemaligen Schüler wiederzusehen, zum ersten Mal seit Monaten. Curtis ist an diesem Tag extra mitgekommen in die BS 16, die Berufliche Schule Fahrzeugtechnik, er hat Dose die Hand geschüttelt und gelächelt. Wer Curtis beobachtet, wie er minutenlang keine Miene verziehen kann, der weiß: Das bedeutet viel. "Hier habe ich herausgefunden, was ich will und kann", sagt er.
Vor AV dual hatte Curtis überlegt, eine kaufmännische Ausbildung zu machen. Doch mit Doses Hilfe lernte er sich besser kennen. Und Dose half ihm, als klar war: Bei der Oldtimer-Werkstatt geht es nicht weiter, sie können nicht ausbilden. Und so stand Curtis irgendwann vor Sven Hadenfeldt vom Autohaus Hermann Claaßen.
Das Ende von Curtis' Umweg
Hadenfeldt ist ein ungewöhnlicher Typ für den Job, den er macht. Promovierter Physikochemiker, vor 28 Jahren hat er an der Uni den ersten Internet-Server Norddeutschlands mit aufgebaut, später internationale Lehreraustausch-Programme organisiert. Doch er ist auch der Enkel von Hermann Claaßen, schon als Vierjähriger ist er durch die Werkstatthalle geflitzt, und so war klar: Eines Tages ist er an der Reihe. Vielleicht hilft so eine Biografie ja, Leuten eine Chance zu geben, die auch nicht den normalen Weg gehen. Hadenfeldt nahm Curtis ins Praktikum, und als er sah, wie der Junge sich reinhängte, wie geschickt er war, gab er ihm auch eine Lehrstelle.
Ein Happy End im AV dual, von denen es in Hamburg erstaunlich viele gibt. Rund 50 Prozent der Jugendlichen sind danach Azubis, zweieinhalb Mal so viele wie im alten System. Das Ende von Curtis' Umweg, und doch ist er am Anfang, denn wer glaubt, Hadenfeldt würde ihm wegen seiner Geschichte Rabatt geben, irrt. "Bei vielen Jugendlichen fehlt heute die Leistungsbereitschaft", sagt Hadenfeldt. "Und die Fokussierung." Während er dies sagt, fahren Curtis und er hinüber zur Kfz-Innung, wo die sogenannten überbetrieblichen Teile der Ausbildung stattfinden, seinen ersten Kurs zur Kfz-Elektrik hat Curtis gerade hinter sich.
Hadenfeldt sitzt am Steuer und berichtet von Bewerbungsschreiben voller Rechtschreibfehler, die er erhält, wo vor lauter Copy and Paste manchmal selbst die Anrede nicht stimmt. Und er rechnet vor, dass ihn jeder Azubi netto - das heißt Ausgaben für Gehalt, Innungsschulungen, Berufskleidung und Werkzeug abzüglich wirtschaftlichem Ertrag - 25 000 Euro kostet. Curtis sitzt im Fond des Wagens und schweigt.
596,44 Euro netto verdient er im ersten Lehrjahr, das sei okay, hat er am Morgen erzählt, im Pausenraum hinter der Werkstatt. Er wohnt bei seiner Mutter, mit dem Geld spart er auf den Führerschein, und er finanziert sich seine Reisen zu Tuningfestivals. Oldtimer sind sein Faible, besonders der Ford Mustang. Und japanische Autos, aber nur die bis 2007 gebauten, da nimmt er es sehr genau. Die neueren könne man wegschmeißen, sagt Curtis. Bei diesem Thema redet er auf einmal ganz schnell.
