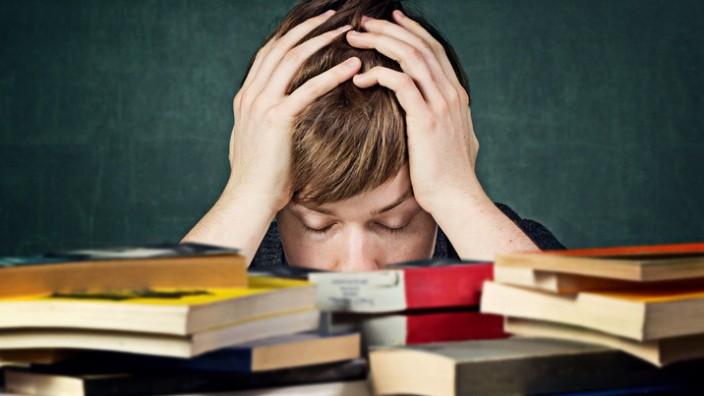Wer Schwierigkeiten hat, sich viele Details langfristig zu merken, sollte nach dem Lernen Sport treiben. Allerdings nicht sofort, sondern etwa vier Stunden später. Zu diesem Ergebnis kommen der Wissenschaftler Guillén Fernández von der Radboud-Universität in Nijmegen (Nimwegen), Niederlande, und sein Team in einer aktuellen Studie, die im Fachblatt Current Biology vorgestellt wurde.
In dem Versuch bekamen 72 Probanden, aufgeteilt in drei Gruppen, Bilder vorgelegt - mit der Bitte, sich diese so gut wie möglich zu merken. Die erste Gruppe musste anschließend sofort in den Fitnessraum und etwa eine halbe Stunde Fahrrad fahren. Die zweite Gruppe durfte sich nach der Paukerei erst mal ausruhen und musste erst vier Stunden später zum Sport.
Eine Pause zwischen Lernphase und Sport hilft
Für die dritte Gruppe stand kein Training auf dem Programm. Zwei Tage nach dem Versuch befragten die Forscher ihre Probanden, an welche Bilder sie sich noch erinnern können. Gleichzeitig überprüften sie mittels funktioneller Magnetresonanztomografie, ob sich beim Abrufen der mentalen Bilder die Hirndurchblutung ändert.
Das Ergebnis: Jene Probanden, die zwischen Lernphase und Sport vier Stunden Pause hatten, konnten sich besser an das Gelernte erinnern. Auf den MRT-Aufnahmen dieser Probanden waren im Bereich des Hippocampus zudem verstärkte Aktivitäten zu beobachten. Der Hippocampus ist ein wichtiger Teil des Gehirns und für Lernprozesse unerlässlich.
Bislang ungeklärt ist, warum die Pause zwischen Lernen und Sport die Gedächtnisleistung steigert. Die Wissenschaftler vermuten, dass die durch das Radfahren ausgeschütteten Hormone wie Dopamin und Adrenalin die Merkfähigkeit des Gehirns ankurbeln. Direkt nach dem Lernen allerdings könnten diese Hormone wenig Einfluss auf das Gehirn haben, da es ohnehin schon ausreichend angeregt ist. Ob diese Erklärung stimmt, will das Team von Neurowissenschaftler Guillén Fernández nun in weiteren Versuchen klären.