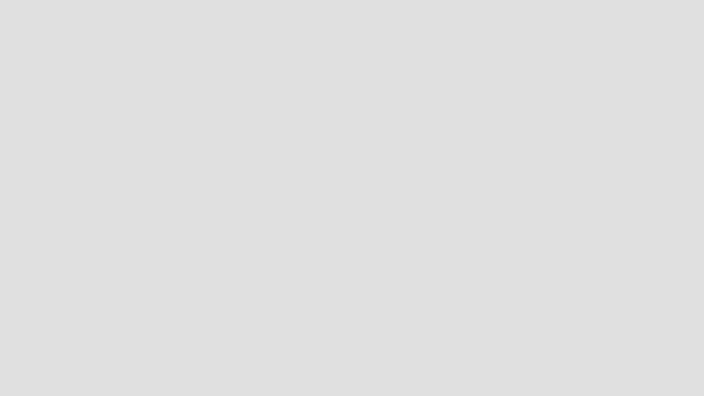Rosalind Picard konnte nicht wissen, dass solche Geschichten ihr weiteres Leben prägen würden. Es war ein Tag im Juni 1999, die Elektroingenieurin grübelt gerade darüber, welchen Namen das neue, von ihr mit aufgebaute Forschungsfeld bekommen könnte. Später sollte es schließlich Wearable Computers heißen, anziehbare Computer. Da klopft ein Student an die Tür ihres Büros am Massachusetts Institute of Technology (MIT) in Cambridge, USA. Er fragt schüchtern: "Können Sie meinem Bruder helfen? Er kann Emotionen nicht verstehen, er ist Autist."
Picard hat sich bereits einige Jahre lang damit beschäftigt, wie Computer die Gefühle von Menschen erkennen können. Vielversprechend erscheint ihr damals der Weg über den Gesichtsausdruck: Anhand von Fotos lernen ihre Algorithmen, ob ein Mensch gerade glücklich oder traurig ist, wütend oder enttäuscht.
Sie freut sich über den jungen Mann und bittet ihn herein. Ein guter Anwendungsfall für ihre Forschung! Autisten wie der Bruder ihres Studenten könnten davon profitieren, wenn Computer die Emotionen von Menschen entschlüsseln. Picard packt stets ein ihr eigener Feuereifer, wenn sie das Gefühl hat, etwas Gutes zu tun - so auch in diesem Fall: Sie verstärkt ihre Forschung und stattet den Bruder ihres Studenten und zahlreiche weitere Probanden mit Mini-Computer und einer App aus. Die soll ihnen anhand des Gesichtsausdrucks verraten, was ihr Gegenüber gerade empfindet.
18 Jahre später steht Picard in einem Saal in Heidelberg vor Tausenden Teilnehmern einer Informatikkonferenz und berichtet von diesem Zusammentreffen, dem Beginn ihrer Karriere. Sie weiß, wie sie ihr Publikum in Bann zieht, sie macht kunstvolle Pausen. "Wir hatten damals eine Genauigkeit von 70 Prozent", ruft sie in den Saal, betont das "damals" und grinst über das ganze Gesicht: 70 Prozent der Emotionen also hatte ihr damaliges System richtig gedeutet. "Heute aber", fährt sie fort, "heute haben wir 90 Prozent Genauigkeit, wir haben inzwischen mehr als vier Millionen Probanden aus 75 Ländern vermessen". Längst prangt das Logo eines Unternehmens auf ihren Folien: Affectiva. Picard hat die Firma mitgegründet. Sie besitzt den größten Emotionsdaten-Speicher der Welt. Und das ist erst der Anfang der Geschichte.
In einer Konferenzpause wird die blonde Frau umringt, vor allem von jungen Forscherinnen, alle haben Fragen an sie, jede träumt davon, eines Tages Großes zu vollbringen, ein wenig wie ihr Vorbild Picard. Die 55-Jährige bewegt sich in einer Traube von Menschen zum Kaffeetresen, ganz langsam, um ja keine Frage zu verpassen. Picard ist es ein Anliegen, dass Jüngere aus ihrer Erfahrung lernen.
Nur wem es gelingt, Rosalind Picard in der Ruhe eines Nebenraumes zu treffen, erfährt von ihren Zweifeln. "Das mit den Emotionen per Gesichtserkennung ist nicht so einfach", sagt sie und reicht ihr Handy herüber: "Hier, probieren Sie." Und in der Tat: ein falsches Lächeln interpretiert die App als echte Freude, und wer konzentriert dreinblickt, gilt schnell als unzufrieden. Die Algorithmen fallen auf ähnliche Muster herein wie Menschen - zusätzlich fehlt ihnen aber der Kontext und die Intuition. Daher missinterpretieren sie mehr als die meisten Menschen. "Eine Stirnfalte kann Konzentration bedeuten, aber auch Wut", sagt die Informatikerin, "oder sie kann auch einfach ein Zeichen des Alterns sein."
Ein Kind mit nie gesehenem Stress
Doch zum Glück ist Picards Geschichte hier noch nicht zu Ende. Rosalind Picard macht schnell Karriere am MIT. Sie wird Professorin und berühmt für ihre Forschungen rund um anziehbare Computer. Doch anders als viele ihrer Kollegen hat sie das Zuhören nie verlernt. Auch deshalb wagt es wohl einer ihrer Probanden, ein Autist, ihr eines Tages die Wahrheit zu sagen: dass sie nämlich auf dem Holzweg sei. "Ich habe kein Problem damit, Emotionen zu verstehen", sagte er, "aber ihr versteht meine Gefühle nicht."
Spätestens an diesem Punkt wird Picard klar, dass Algorithmen, die Gesichtsausdrücke lesen, zumindest Autisten nicht weiterhelfen. "Die Betroffenen wirken oft äußerlich sehr ruhig, sind aber innerlich aufgewühlt", sagt sie. Selbst für das engste Umfeld bleibt ihr Gesichtsausdruck rätselhaft. Picard überlegt daher, wie sie die innere Unruhe bei Autisten messen kann, sie findet heraus, dass Stress direkt mit dem Schweiß am Handgelenk korreliert. Die Haut wird feucht - oft, ohne dass es die Betroffenen bemerken. Sie entwickelt gerade Mess-Armbänder, die ähnlich wie Lügendetektoren funktionieren, als kurz vor Weihnachten 2007 wiederum ein Student bei ihr anklopft. "Können Sie mir helfen? Ich würde gern wissen, wann mein Bruder gestresst ist."
Die Forscherin erschrickt, als sie die Daten sieht: "Das Kind hatte so einen Stress, wie ich ihn noch nie gesehen hatte."
Rosalind Picard interessiert sich auch für den Bruder dieses Studenten, "erzähl mir mehr von ihm", und gibt dem Studenten über die Weihnachtsferien Messgeräte mit - gleich zwei Stück, für den Fall, das eines ausfällt. Als der junge Mann im Januar zurück ins Labor kommt, staunt sie über die gemessenen Werte. Der Student hatte sie falsch verstanden: anstatt nur eines Armbands hatte er an beiden Armen seines Bruders Messgeräte angebracht. Und während die Werte an einem Handgelenk gleichmäßig aussehen, erschrickt Picard angesichts der Daten vom anderen Handgelenk. "Das Kind hatte so einen Stress, wie ich ihn noch nie gesehen hatte." Wie kann es sein, dass der Stress die elektrodermale Aktivität nur an einem Handgelenk verändert? Picard steht vor einem Rätsel. Sie sieht sich die Werte genauer an und fragt schließlich ihren Studenten: Was war am Sonntag um 14 Uhr? Der hat Tagebuch geführt und sagt: "Kurz danach hatte mein Bruder einen epileptischen Anfall."
Epilepsie? Picard beginnt, neurowissenschaftliche Artikel zu lesen. Sie lernt, dass die elektrodermale Aktivität auch mit der Aktivität im autonomen Nervensystem korreliert - jenen Nervenbahnen also, die sich nicht bewusst steuern lassen, aber für viele Körperfunktionen wichtig sind. Aber was hat dieser Ausschlag an einem Handgelenk zu bedeuten? Dazu findet sie nichts in der Literatur. Schließlich fragt sie ihre Praktikantin, die zufällig die Tochter eines führenden Epilepsieforschers am Bostoner Kinderkrankenhaus ist. Ob man vielleicht mal miteinander reden könne? Der Arzt stimmt einem Treffen sofort zu. "Ich war furchtbar aufgeregt", gesteht Picard. Wird der Arzt sie ernst nehmen? Wird er offen sein für Technologie? Werden sie überhaupt die gleiche Sprache sprechen?
Die gleiche Sprache? Für Tobias Loddenkemper ist das eine seltsame Frage. Natürlich nicht. "Wir beide sind hoch spezialisiert", sagt der Direktor der Abteilung für klinische Epilepsie-Forschung des Boston Children's Hospital. Aber aus seiner Sicht war es ein Glücksfall, dass er mit Picard zusammengefunden hat. "Ich wünschte, wir hätten uns schon früher getroffen", sagt er. Für ihn liefert die Informatikerin Anfang 2009 ein wichtiges Puzzleteil für seine Forschung. "Wir kannten dieses Signal, wir wussten, dass diese Veränderung im autonomen Nervensystem ein Sudep-Marker ist." Sudep steht für "sudden death in epilepsy", den plötzlichen Tod nach einem epileptischen Anfall. Dieser Tod war für die Forscher bis dahin ein Rätsel. Wann genau trat er auf? Und wieso? Diese Veränderungen im autonomen Nervensystem ließen sich bis dahin nur aufwendig in der Klinik messen.
Aus Erfahrung weiß der Arzt, dass die Anwesenheit anderer Menschen bei einem Krampfanfall den Tod verhindert
Schon lange hatte Loddenkemper vermutet, dass sich das Signal auch mit dem EEG nachweisen lassen müsse, einer Methode, die die elektrische Aktivität des Gehirns misst. Doch erst im Jahr 2010 folgte der Beweis. Damals zeigte der Neurologe Samden Lhatoo vom University Hospital in Cleveland anhand der Daten aus dem Krankenhaus, dass manche auffällig flache EEG-Signale kurz vor einem Krampfanfall offenbar auch einen plötzlichen Tod vorhersagen. Weitere Experimente ergaben: Jener Ausschlag in der elektrodermalen Hautreaktion, den Picard mit ihrem Armband messen kann, korreliert stark mit dem flachen EEG-Signal, das Lhatoo beschrieben hatte. "Es ist meine größte Hoffnung, dass der Sensor Anfälle detektieren und sagen kann, wie hoch das Sterberisiko ist" sagt Loddenkemper.
Das Armband, das Picard entwickelt hat.
(Foto: REUTERS)Wie zuverlässig ist das Gerät?
Aus vielen Daten der Vergangenheit weiß er, dass diese plötzlichen ungeklärten Todesfälle meist geschehen, wenn die Betroffenen allein sind. Irgendetwas an der Anwesenheit anderer Menschen scheint den Tod zu verhindern. Wer einen Anfall in Gesellschaft erleidet, stirbt seltener. Picard erklärt das so: Eine Stelle im Gehirn werde durch den heftigen Anfall derart beeinflusst, dass der Betroffene regelrecht vergisst zu atmen. "Man muss ihn nur ansprechen, dann atmet er wieder!" Sie gründet eine weitere Firma, Empatica, und bringt ein Messgerät auf den Markt, das solche Anfälle dank verschiedener Sensoren und künstlicher Intelligenz immer besser vorhersagt.
Picard liest gern aus einer E-Mail vor, die ihre eine Mutter geschickt hat: "Wir hatten einen Alarm heute morgen, rannten in das Kinderzimmer, und da lag unsere Tochter mit dem Gesicht nach unten: Sie hatte einen Anfall und atmete nicht mehr. Wir haben sie umgedreht, und jetzt liegt sie da rosig und schlafend." Kunstpause. "Das Gerät rettet Leben", sagt Picard.
Rettet es Leben? Loddenkemper wünscht sich nichts sehnlicher. "Ich will nicht mehr diese Anrufe von Familien bekommen, die sagen: Heute Nacht ist mein Kind gestorben. Ich wusste nicht, dass es einen Anfall hat." Er stockt. "Das ist das Schlimmste, was einem Arzt passieren kann." Daher würde er zu gerne sagen, dass das Gerät seinen Zweck erfüllt. Aber er sagt: "Wir können es nicht mit Sicherheit sagen." Er weiß von vielen Todesfällen, bei denen der Betroffene allein war. Und er kennt die Erzählungen von Picard, darüber, wie das Gerät Alarm schlug und ein Patient gerettet werden konnte. Aber wäre er ohne Ansprache tatsächlich gestorben? Und wären die anderen nicht gestorben, wenn jemand bei ihnen gewesen wäre?
"Kürzlich ist ein Patient mit Armband am Handgelenk gestorben", sagt er. Es hatte Alarm geschlagen, aber die Eltern des Kindes kamen zu spät. In diesem Fall hat das Gerät den Tod also nachweislich richtig vorhergesagt. Er bezweifelt allerdings, dass das Ansprechen genügt. "Das ist immer nur das Erste, was man tut - niemand würde es dabei belassen." Menschen geben Medikamente, sie beatmen den Betroffenen, sie rufen einen Arzt.
Manche werfen Picard vor, sich am Leid der Kranken zu bereichern. Wenn man sie darauf anspricht, wird die leichte Falte auf Picards Stirn tiefer. Ein Zeichen für Ärger, würde ihre App vielleicht sagen. "Eine Firma zu gründen, das erschien mir immer so, als würde ich auf die dunkle Seite wechseln", sagt sie. Bis heute hadert sie mit ihrem Unternehmerdasein. "Aber wir brauchten die besten Leute, und die haben wir anders nicht bekommen." Das Geld der Marketing-Unternehmen helfe, um weiterzuforschen - für die Autisten. Dann glättet sich ihre Stirn, sie strahlt: "Heute weiß ich, dass Menschen leben, weil Empatica diese Geräte baut."
Am Ende der Konferenz ist Picard noch immer umringt von jungen Menschen. "Ich kann euch nur ermutigen", sagt sie immer wieder. "Wenn ihr eine Idee habt, arbeitet daran." Wie es aber mit der FDA sei, will eine Studentin wissen. Mit der US-Arzneimittelbehörde stehen viele Wearable-Entwickler auf Kriegsfuß. Weil die FDA wissenschaftlichen Belege sehen will. "Wir können das nicht kausal beweisen", gesteht sie. Ein Problem, das sich kaum lösen lässt. Schließlich muss die Behörde sichergehen, dass Picards Gerät den Patienten tatsächlich einen Vorteil bringt.
Solange die FDA ihr Gerät nicht als medizinisches Produkt zulässt, ist es nur ein "teures Spielzeug", sagt Loddenkemper. Er wünscht sich, dass Picard einen Weg findet, die FDA zu überzeugen. "Die Daten sind wichtig", sagt er. Mit ihnen könnte man nicht nur die Anfälle einzelner Patienten vorhersagen. Man könnte auch nach generellen Mustern in der Bevölkerung suchen, vorhersagen, wer an Epilepsie erkranken wird und Medikamente entwickeln. Bislang nämlich beruht die Epilepsieforschung vor allem auf den Selbstauskünften der Patienten. "Sie kommen alle paar Wochen zum Arzt, erinnern sich nicht mehr genau und bemerken manche Anfälle selbst gar nicht", sagt Loddenkemper. "Die Daten, die wir bisher über epileptische Anfälle haben, sind zu 50 Prozent falsch." Entsprechend fehlerhaft seien die bisherigen Medikamentenstudien.
Zwar wäre es theoretisch möglich, die Geräte auf übliche Weise mit einer Kontrollgruppe zu testen, doch Loddenkemper meint, dass man das Gerät schon jetzt niemandem verweigern könne. Vor einiger Zeit hätten Kollegen im Fachmagazin The Lancet die Effektivität von Fallschirmen gegen die Schwerkraft beweisen wollen. "Aber sie fanden keine Kontrollgruppe, die auf den Fallschirm verzichten wollte." Das Ganze war ein Witz, aber Loddenkemper kann darüber nicht lachen.
Anmerkung der Redaktion: In einer früheren Version des Textes war zu lesen, Picard habe Probanden mit Smartphones ausgestattet. Gemeint war eine Art "Mini-Computer", so genannte Personal Digital Assistants. Wir haben diesen Fehler korrigiert.