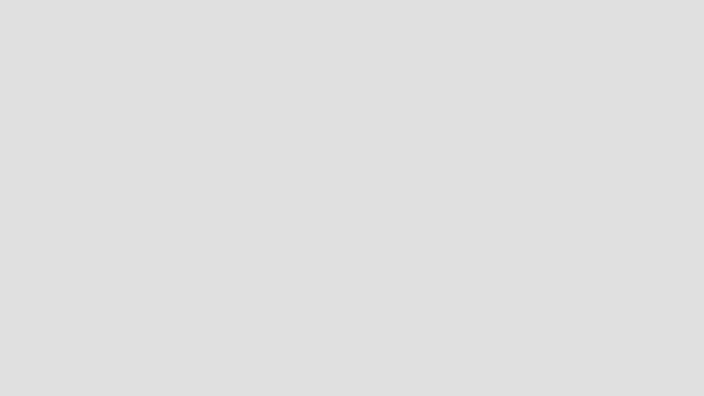Der Arzt von heute ist ein leidgeprüftes Wesen. Seine jahrhundertelang stolz präsentierten Statussymbole haben längst an Strahlkraft verloren. Das Stethoskop beispielsweise hängen sich viele Mediziner nur noch zu dekorativen Zwecken um den Hals - oder damit man sie im weißen Kittel nicht mit dem Friseur verwechselt, wie böse Zungen behaupten. Der weiße Kittel selbst habe sowieso keinen praktischen Wert, sondern diene lediglich der Psychohygiene der Doktoren, lästerte Hygiene-Experte Franz Daschner vom Uniklinikum Freiburg schon vor 20 Jahren. Kein Wunder, dass die Zunft verunsichert darüber ist, welche Anforderungen künftige Ärzte zu meistern haben - und was Medizinstudierende heute überhaupt noch wissen und lernen sollten.
Die ETH Zürich, die 2017 in die Ärzteausbildung eingestiegen ist und seit vergangenem Jahr einen Bachelorstudiengang Medizin anbietet, hat kürzlich unter dem Schlagwort "Digital Health" in einer kleinen Leistungsschau gezeigt, welche technischen Neuerungen auf den Arzt der Zukunft zukommen könnten. Da ist etwa die Virtual-Reality-Brille, mit deren Hilfe sich die Schädelöffnung während einer Obduktion beobachten und erlernen lässt. Die Schnittführung ist ebenso plastisch zu erkennen wie die verschiedenen Bereiche von Kortex bis Hirnstamm, sowie der Verlauf der Hirnnerven.
Ein paar Schritte weiter führen Präzisionsroboter in die Technik mikrochirurgischer Eingriffe am Auge ein. Mit dem "Lab on a Chip" lässt sich die Blutuntersuchung per Mobiltelefon bewerkstelligen. Am nächsten Stand zeigt Jörg Goldhahn, wie sich Ultraschallbilder auf dem Smartphone anschauen und vergrößern lassen. Der kleine Schallkopf ist über ein Kabel direkt mit dem Handy verbunden, sonst braucht es nichts dazu. Mit Hilfe einer App sind die Bewegtbilder sofort sichtbar und können sowohl an einem größeren Bildschirm als auch Tausende Kilometer entfernt in Echtzeit angesehen werden. Der Arzt der Zukunft braucht wohl vor allem ein Smartphone, so der Eindruck, auf jeden Fall aber digitale Kompetenz.
"Unsere Studenten müssen auf die Flut von Informationen aus dem Internet vorbereitet werden, sie müssen Daten und deren Quellen bewerten können und ebenfalls mit Patienten umgehen können, die schon vorinformiert in ihre Praxis kommen", sagt Goldhahn, der das ETH-Projektteam für die neue Bachelor-Ausbildung leitet. "Bei aller Technologie und Information geht es am Ende aber immer noch um Patienten. Daher treffen unsere Studenten schon im ersten Semester auf Patienten und werden im Laufe des Studiums diese Interaktionen gemeinsam mit klinischen Partnern weiterentwickeln." Ärzte sollen künftig ja nicht nur technische Skills beherrschen, sondern den Patienten auch vermitteln können, wie es um sie steht. Kranke wie Gesunde wünschen sich schließlich keinen medizinischen Ingenieur, sondern einen warmherzigen und verständnisvollen Doktor.
Joachim Buhmann, Professor für Maschinelles Lernen an der ETH stellt dennoch die Frage, wie lange der Arzt seine Rolle als Medizinexperte und damit die Deutungshoheit über das, was krank und gesund heißt, überhaupt noch innehaben wird. Man könne Ärzte oftmals ja auch "als schlecht gewartete Datenbank mit unzuverlässigem Zugriff" sehen. Die viel beschworene Erfahrung älterer Ärzte bekäme mittelfristig ebenfalls Konkurrenz durch die Fortentwicklung der künstlichen Intelligenz. Während der Arzt noch in seinem löchrigen Gedächtnis kramen muss, haben Computer die Einzelfälle und Kuriosa der Heilkunde sicher gespeichert und ergänzen sie jederzeit um seltene Fallbeispiele oder andere Normvarianten, die einzelne Patienten besonders machen und spezielle Behandlungswege für sie erfordern.
"Medizinstudierende werden bisher nicht adäquat darauf vorbereitet, die Herausforderungen der digitalen Medizin zu meistern", sagt Martin Fischer, Didaktikexperte und Studiendekan für Medizin an der Ludwig-Maximilians-Universität München. "Dazu gehört insbesondere die bewusste Nutzung digitaler Werkzeuge und deren kritische Bewertung."
Der Arzt - eine schlecht gewartete Datenbank mit unzuverlässigem Zugriff?
Allerdings stelle sich gerade mit der Zunahme digital zugänglicher Informationen immer dringlicher die Frage, was dann noch als relevantes und im Kern stabiles medizinisches Wissen für all jene zu gelten habe, die mal Arzt werden wollen. Was kann in der Datenbank gespeichert bleiben - und wovon sollte jeder Medizinstudierende in der Ausbildung schon gehört oder gelesen haben? "Ohne Wissensbasis ist kein verantwortungsvolles und fundiertes ärztliches Handeln möglich, deshalb führt kein Weg um das Lernen herum", ist Fischer überzeugt. "Zum Arztsein reicht Nachschlagenkönnen alleine nicht aus." Deshalb sollte Studierenden künftig besser beigebracht werden, wie sie rasch verlässliche und aktuelle Informationen in Datenbanken finden, was sie auch so unbedingt wissen müssen - und wem sie als Experten vertrauen können und warum.
Ob sich die Studenten unter der Last dieses vielfältigen Anforderungsprofils noch zurechtfinden? Einerseits sollen sie technische Neuerungen in ihren Alltag integrieren, als Digital Natives sicher durch Datenbanken navigieren und gleichzeitig erkennen, wo ihnen die künstliche Intelligenz überlegen ist und wann sie der menschlichen Ergänzung bedarf. Andererseits dürfen gleichzeitig Kommunikationsvermögen, Empathie und eine gehörige Portion Menschlichkeit nicht zu kurz kommen. Ein bisschen viel verlangt, wenn gleichzeitig das Grundstudium auf drei Bachelor-Jahre verkürzt ist.
Schwer zu erklären, warum Augenärzte genauso lange studieren wie Allgemeinmediziner
Es stimmt ja, dass Medizinstudierende vor Prüfungen viel zu viel Wissensballast anhäufen, der danach schnell wieder abgeworfen wird. "Mit wenigen Ausnahmen geben Mediziner zu, dass sie 80 bis 90 Prozent dessen, was sie im Studium lernen mussten, drei Tage nach den Prüfungen wieder vergessen haben und dieses ,Wissen' auch nie mehr benötigten", sagt Johann Steurer von der Universität Zürich, der das Schweizerische Bildungsnetzwerk Medizin koordiniert. Es gibt ungefähr 40 medizinische Disziplinen, aber alle Studenten absolvieren das gleiche Grundstudium von sechs Jahren. "Bisher hat mir noch niemand plausibel erklären können, warum es sechs Jahre braucht, um für eine Augenärztin, einen Radiologen, aber genauso für eine Chirurgin oder einen Allgemeinmediziner weiterbildungsfähig zu sein."
Konsequent wäre aus Steurers Sicht daher ein Grundstudium von drei Jahren (vergleichbar einem Bachelor), in dem das gelehrt wird, was alle Mediziner, unabhängig von der Disziplin, in der sie später tätig sein werden, wissen und können müssen. Wie lange ein solches Grundstudium dauert, könne man freilich diskutieren, findet Steurer, "manche meinen ja, dass man mit den entsprechenden Inhalten die Studierenden nicht länger als ein halbes Jahr unterhalten kann". Anschließend an das dreijährige Grundstudium müssten sich die Studierenden - analog zu einem Masterstudiengang - bereits für eine der späteren Disziplinen vorentscheiden. "Das wären sicher nicht 40 verschiedene, aber zehn oder zwölf Richtungen könnten es schon sein", so Steurer.
LMU-Studiendekan Fischer hält eine Verkürzung des Studiums bei dem stetig wachsenden Wissensberg hingegen für kontraproduktiv. Das verbindliche Basiswissen für alle Medizinstudierenden müsse definiert werden, damit Raum für individuelle Interessen geschaffen wird auf dem Weg zur Spezialisierung. "Außerdem brauchen wir eine Spezialisierung zum Generalisten. Diese Generalisten - die Allgemeinmedizin ist dafür prädestiniert - müssen den Überblick über das System und die Versorgungspfade haben, um die Patienten richtig und rasch zu lotsen."
An den unterschiedlichen Auffassungen über die vielfältigen Anforderungen für künftige Ärzte ist zu erkennen, dass eine inhaltliche Überfrachtung des Medizinstudiums droht - bei gleichzeitig immer strafferer Organisation und womöglich kürzerer Dauer. Ob auf diese Weise wirklich weise und zugewandte Ärzte herangebildet werden, bei denen man sich als Patient aufgehoben fühlt und nicht nur einen digital kompetenten und technikgläubigen Wissensmanager vor sich hat?
"Der Mensch ist keine Maschine", betont Fischer denn auch. "Kommunikationskompetenz, Empathie, Teamarbeit und professionelles Denken und Handeln in Kenntnis der eigenen Grenzen sind zentrale Elemente des ärztlichen Berufes." Diese Eigenschaften werden gerade in Zeiten der Digitalisierung auch weiterhin gebraucht. Ärzte, die nur auf den Bildschirm schauen, während sie mit Patienten reden, gibt es jetzt schon genug.