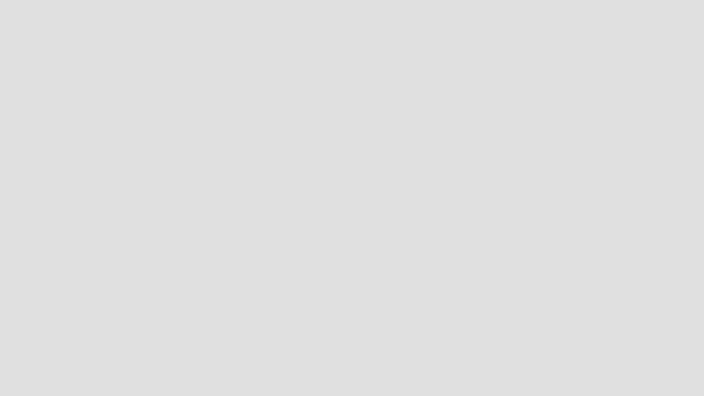Medizinkongresse sind oft wie Klassentreffen. Man sieht viele Bekannte wieder und bekommt in Vorträgen erzählt und erläutert, was man schon gehört oder in der Fachliteratur gelesen hat. Doch der große Krebskongress Ende März in New Orleans nahm überraschend eine andere Richtung: Eine umfassende Studie zog ein Lieblingsspielzeug vieler Ärzte massiv in Zweifel. Der Nutzen minimal-invasiver Eingriffe, also der endoskopischen "Schlüsselloch-Operationen", stand plötzlich infrage.
Was war geschehen? Ein internationales Ärzteteam hatte eine Studie mit mehr als 700 Patientinnen vorgestellt, die an Krebs des Gebärmutterhalses litten. Der Hälfte der Frauen mit sogenanntem Zervixkarzinom wurde ein Großteil der Gebärmutter "offen" entfernt, das heißt mit einem Schnitt durch die Bauchdecke. Bei der anderen Hälfte erfolgte die Operation minimal-invasiv. Im Bereich der Bauchhöhle wird dieses Vorgehen auch als laparoskopischer Eingriff oder Bauchspiegelung bezeichnet.
Viereinhalb Jahre nach der Operation zeigte sich, dass die Schlüsselloch-Technik den Frauen keinesfalls mehr Vorteile brachte. Im Gegenteil, unter den Patientinnen, die auf diese Weise operiert worden waren, gab es früher und häufiger Rückfälle, mit neuen Krebsabsiedlungen im kleinen Becken. Auch die Überlebensrate war nach der minimal-invasiven Tumor-Operation geringer. Während im Laufe der viereinhalb Jahre 19 Frauen starben, die minimal-invasiv operiert worden waren, kam es nach der althergebrachten "offenen" Operation in den Folgejahren nur zu drei Todesfällen.
"In der Gynäkologie ist die Laparoskopie seit vielen Jahren der Standard-Zugang"
Frauenärzte und andere Krebsexperten waren irritiert. "Die meisten zeigten sich angesichts der neuen Ergebnisse erst mal geschockt und haben nach Schwächen der Studie gesucht", sagt Sven Mahner, Direktor der Frauenklinik an der Ludwig-Maximilians-Universität München. "In der Gynäkologie ist die Laparoskopie ja seit vielen Jahren der Standard-Zugang für eine Vielzahl von Operationen." Zwar sei es für die abschließende Bewertung notwendig, dass die Untersuchung nicht nur auf einem Kongress vorgestellt, sondern in Fachzeitschriften publiziert wird. "Aber mit dieser Studie liegen erstmals Daten vor, die zeigen, wie viele Frauen überleben und wie oft es zu Rezidiven bei verschiedenen Zugangswegen in der Behandlung des Zervixkarzinoms kommt", sagt Mahner. "Alles was wir bislang hatten, waren lediglich Vergleiche der operativen Ergebnisse."
Nun ist es nicht automatisch ein Vorteil für Patienten, wenn Ärzte einen technisch komplexen Eingriff meistern. Das zynische Bonmot "Operation gelungen, Patient gestorben", bringt diesen Umstand auf den Punkt. Verschleiert etwa auch bei der Schlüsselloch-Operation die Begeisterung für die moderne Technik, dass der Nutzen für Patienten nicht immer gegeben ist oder manchmal nur marginal ausfällt? Auch in anderen Bereichen gab es ernüchternde Ergebnisse - Komplikationen, schlechterer Verlauf, Schwierigkeiten, wenn sich der Befund doch als größer erwies und das Operationsgebiet ausgeweitet werden musste. Seit Jahren mehren sich die Hinweise, dass die von vielen Ärzten favorisierte und von Laien geschätzte Methode auch Nachteile hat oder manchmal schlicht unnötigerweise zum Einsatz kommt.
Erst im Herbst zeigten Ärzte aus Oxford im Fachmagazin Lancet, dass die Entlastung des Gelenkinnenraums im Bereich der Schulter mittels endoskopischem Eingriff keine Vorteile gegenüber einer Scheinoperation brachte. Auch nachdem überschüssiges Knochen- und Bindegewebe im Gelenk ausgeräumt und Platz geschaffen wurde, ging es den Patienten nicht besser als jenen, bei denen lediglich das Endoskop eingeführt, aber unverrichteter Dinge wieder entfernt und somit ein klassischer Placebo-Eingriff vorgenommen wurde.
Ein Zugang durch den Bauchnabelgrund hinterlässt keine Narben, hat aber sonst keinerlei Vorteil für den Patienten
Legendär ist die Entlarvung der Arthroskopie, der Kniespiegelung, als häufig lukrative, aber meist nutzlose Intervention. Wenn nicht das Gelenk blockiert ist oder eine andere Funktion eingeschränkt, sondern Arthrose und Abnutzung Beschwerden bereiten, hilft die Spiegelung des Knies nicht weiter, wie Orthopäden schon 2002 gezeigt haben. Auch wenn emsig Knochenwülste geglättet, gespült und poliert werden, hilft der Eingriff nicht besser als die Schein-OP, bei der Spülgeräusche vom Band kommen, die Haut aber nur eingeritzt und rituell bepflastert wird.
"Unterm Strich ist die Entwicklung der Endoskopie ein Segen und bringt enorme Vorteile für Patienten", sagt Hartwig Bauer, ehemals Präsident und Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie. "Nach einer Operation können Kranke viel früher mobilisiert werden, oft schon nach ein paar Tagen aufstehen und die Narben sind deutlich kleiner. Wir haben gelernt, gewebeschonender zu operieren, die Zugänge zu verkleinern und die negativen Begleitumstände der Operation zu verringern."
Bauer war lange Chefarzt in Altötting und erinnert sich, dass bis in die 1980er-Jahre Patienten eine Woche oder gar zehn Tage das Bett hüten mussten, wenn ihnen die Gallenblase oder ein Leistenbruch operiert worden war - damit die Wundnaht nicht wieder aufplatzte. Komplikationen durch lange Liegezeiten sind nach dem Aufstieg der endoskopischen Operationen deutlich seltener geworden. Dazu haben neben der frühen Mobilisierung auch die verbesserte Schmerztherapie und eine optimierte Ernährung beigetragen.
Die Exzesse seiner Zunft
"In den frühen 1990er-Jahren hat sich die Endoskopie ja ausgebreitet wie ein Flächenbrand. Da haben die Chirurgen mit den Hufen geschart, so dass die Hersteller mit den Instrumenten nicht nachkamen", erinnert sich Bauer. "Anfangs wurde geradezu jedes Organ endoskopisch operiert. Wer einen neuen Hammer hat, für den sieht alles wie ein Nagel aus." Inzwischen gebe es kaum noch ein Organsystem, das nicht minimal-invasiv angegangen wird, beklagt Bauer, der bei allen Vorteilen und Erleichterungen für Patienten auch die Exzesse seiner Zunft kritisiert: "Die Indikation muss stimmen - und das war und ist längst nicht immer der Fall. Manchmal hat man die Krankheit der Methode angepasst und nicht geschaut, was bei welchem Leiden am besten hilft und Kranken guttut."
Das hat zu absurden Zugangswegen in den Körper geführt, angesichts derer sich die Route "von hinten durch die Brust ins Auge" wie die schnellstmögliche Verbindung anhört. Unter dem Schlagwort "Notes" (für "Natural Orifice Transluminal Endoscopic Surgery", also Zugang über natürliche Körperöffnungen) wird beispielsweise mit dem Endoskop durch das hintere Scheidengewölbe die Gallenblase operiert, transvaginal der Magen entfernt oder bei einer Magenspiegelung die Magenwand durchstoßen, um den Wurmfortsatz zu entfernen. "Das sind groteske Wege und wird immer minimal invasiver", echauffiert sich Bauer. "Diese Methoden sind den herkömmlichen in keiner Weise überlegen, so etwas ist allein von technischen Innovationen und Experimentierfreude getrieben, nicht vom Nutzen für Patienten."
Ähnlich verhält es sich mit der Single-Access Laparoscopic Surgery. Der komplizierte Name bedeutet, dass die endoskopischen Instrumente durch einen einzigen Zugang im Bauchnabelgrund in den Körper eingeführt werden und nicht - wie sonst üblich bei der Laparoskopie - durch zwei oder drei Öffnungen für Optik und Instrumente, die auch nur einen Durchmesser von fünf Millimetern aufweisen. "Vorteile hat das nicht, aber den Patienten wird es als narbenfreie Operation aufgeschwatzt", sagt Bauer. "Das ist oftmals reine PR." In Brasilien ist die Technik offenbar sehr beliebt, bikinitaugliche Narben sind Vergangenheit, stattdessen gibt es gar keine sichtbaren Narben mehr.
"Der Hype um die Endoskopie hat wohl auch etwas mit dem Stolz der Ärzte auf ihr technisches Können in der Miniaturisierung zu tun", sagt Medizinhistoriker Cornelius Borck von der Universität Lübeck. "Vielleicht geht es auch um die angebliche Sauberkeit - operieren, ohne den Körper richtig zu eröffnen und ohne Blut, suppendes Gewebe und andere Körpersäfte. Damit verliert die Operation etwas von ihrer immer noch unheimlichen Körperlichkeit."
Neben technisch-utopischen Fantasien spielt auch der Wunsch nach mehr Abstand zum Patienten eine Rolle
Borck erinnert sich, wie die Technik während seiner ärztlichen Ausbildung eingeführt wurde, in etwa zur selben Zeit, als die ersten Computerspiele aufkamen. "Die Ähnlichkeit war erschreckend. Das Schwierigste für die Chirurgen war es, zu begreifen, dass das Geschehen auf dem Bildschirm real war und von ihnen gesteuert ablief, dass also eine Blutung auf dem Bildschirm genauso bedrohlich ist wie eine spritzende Arterie im offenen Bauch, nur leider viel schlechter zugänglich." Dieser Faktor ist nicht zu unterschätzen. Krieg per Joystick, etwa die Bombardierung einer Rebellen-Stellung im Irak, ist auch leichter per Knopfdruck vom Kontrollzentrum in Arizona auszuführen und wirkt am Bildschirm weniger brutal als Auge in Auge mit dem Kontrahenten.
Womöglich spielt neben technisch-utopischen Fantasien, den Körper zu erobern, Licht in jede Höhle zu bringen und mit einer Art U-Boot durch Blutgefäße und Körperbahnen zu flitzen, auch der Wunsch nach mehr Abstand zum Patienten eine Rolle. Diese Tendenz ist in der Medizin allgegenwärtig zu beobachten. Der Arzt hält den Blick auf den Bildschirm fixiert, während der Kranke vor ihm ist, Schreibkram und Dokumentation lassen die Zeit mit Patienten immer knapper werden. "Verschiedenste Techniken verschaffen Ärzten einen Distanzgewinn", sagt Borck. "Da muss man sich schon fragen: Wo sind heute noch die heilende Hände Teil der ärztlichen Praxis?"
Der Siegeszug der endoskopischen Eingriffe ist bemerkenswert angesichts der Skepsis der Chirurgen zu Beginn. Als der Kieler Arzt Kurt Semm, ein Gynäkologe (!), erstmalig 1980 einen entzündeten Wurmfortsatz endoskopisch entfernte, sollte ihm noch die Approbation entzogen werden. "Etablierte, sichere OP-Verfahren zugunsten waghalsiger L'art pour l'art-Techniken aufzugeben, erschien damals ethisch unlauter", sagt Ulrich Mechler von der Medizin- und Pharmaziehistorischen Sammlung der Universität Kiel. "Für erfahrene Chirurgen war die Technik zudem Neuland, ihre Sinne waren ja nicht mehr gefragt, andere Visualität, keine Haptik, kein Geruch, außerdem neue Instrumente mit anderer Handhabung. Kurz: Das ganze Handwerk musste neu gelernt werden." Da will man nicht Patient gewesen sein, wie Chirurgen heute im vertrauten Kreis zugeben.
Wenn heute artistische Operationen mit ab- oder umwegigen Zugängen durchgeführt werden, kann das verschiedene Motive haben. "Zumeist geht es darum, den Eingriff sicherer zu machen, indem etwa besonders sensible anatomische Bereiche umgangen oder natürliche Körperöffnungen genutzt werden", sagt Mechler. "Es gibt aber auch seit jeher die immanente Tendenz in der Medizin, die Grenzen des Machbaren um der bloßen Machbarkeit willen auszuweiten." Die verwegene oder wenigstens besondere Operation lässt sich gut publizieren und erregt Aufsehen, auch wenn sie nicht ernsthaft als Standardmethode in Betracht gezogen wird.
Den erfahrenen Chirurgen Hartwig Bauer aus Altötting ärgern solche Entwicklungen. "Da gibt es schauerliche Dinge", sagt er. "Durch den Mundboden oder die Achselhöhle wird die Schilddrüse operiert, durch das Rektum der Magen. Das ist die Crux der Therapiefreiheit bei dieser Art von Neuland-Medizin." Mit dem Begriff Therapiefreiheit rechtfertigen Ärzte es gerne, wenn sie eine Behandlung ausprobieren, deren Nutzen nicht belegt ist. "Wütend werde ich, wenn behauptet wird, die Patienten fragen solche Operationsmethoden nach", sagt Bauer. "Das ist völliger Quatsch, das wurde ihnen doch nur eingeredet."