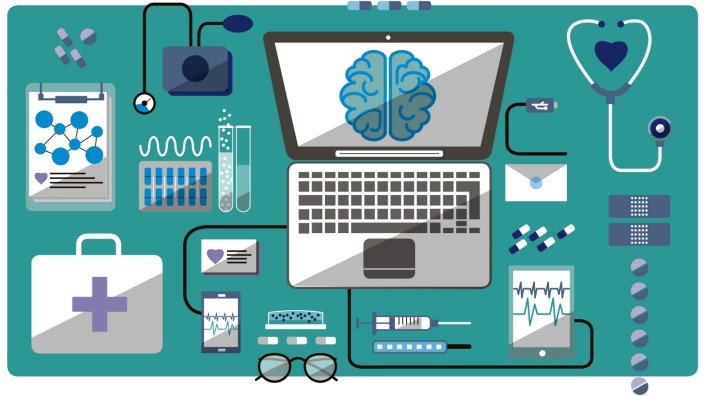Ein Leben soll Watson gerettet haben, immerhin: Im Jahre 2016 wurde ihm der Fall einer japanischen Patientin vorgelegt, über deren Zustand die Ärzte rätselten. Erst dem KI-System der IT-Firma IBM gelang es, eine seltene Leukämie zu diagnostizieren, die Frau wurde geheilt. Genau so hatte IBM es versprochen. Der Arzt müsse nur die Symptome in den Rechner eingeben, Watson schlägt die Diagnose und eine maßgeschneiderte Therapie vor. Dabei würde die KI besser als jeder Mensch den aktuellen Wissensstand berücksichtigen, automatisch medizinische Datenbanken, Studien sowie Patientenakten auswerten.
Doch bei der Anekdote ist es geblieben. Bislang hat IBM sein System noch keinen unabhängigen Studien ausgesetzt. Das medizinische Online-Magazin STAT berichtete gar, dass in Dänemark Ärzte nur in 33 Prozent der Fälle von Watsons Diagnosen überzeugt gewesen seien. In anderen Ländern hätten sich Watsons Vorschläge zwar in mehr als 90 Prozent der Fälle mit den Diagnosen der Ärzte gedeckt. Sie fragten sich allerdings, was ein System denn brächte, wenn es bestenfalls ihr Urteil bestätigte?
Die Revolution der Medizin mithilfe der künstlichen Intelligenz ist vorerst abgesagt, und manche Experten sind ganz froh darüber. Denn nun könne man sich um die wirklichen Vorteilen der neuen Ansätze kümmern. Thomas Friese, KI-Experte bei Siemens Healthineers etwa, spricht lieber von Assistenz-Systemen, von intelligenten Werkzeugen für Ärzte. Medizintechnik-Experten wie Michael Perkuhn von der Firma Philips sind sich sicher, dass 50 Prozent der Kliniken in den kommenden fünf Jahren künstliche Intelligenz implementieren würden.
Dazu muss man wissen, wozu eine KI derzeit fähig ist. Watson etwa nutzt ein neuronales Netz, das die Funktion der Neuronen im menschlichen Gehirn simuliert. Solche Netze sind lernfähig, brauchen aber Trainingsdaten. Um zum Beispiel auf den Bildern einer Magnetresonanztomografie einen Tumor zu erkennen, muss eine solche KI Tausende Beispielbilder von gesunden und kranken Menschen auswerten. Sie sucht dann nach Mustern, die den Tumor auszeichnen. Welche sie findet, wissen Informatiker nicht. Die Systeme sollen dies eigenständig erlernen, da die Regeln für einen Tumor so komplex sind, dass sie sich nicht programmieren lassen. Wichtig ist nur, dass die Unterscheidung zuverlässig gelingt.
Die Vorteile sind offensichtlich. Siemens Healthineers hat zum Beispiel ein System entwickelt, das bei der Computertomografie die bestmögliche Position für den Patienten ermittelt. Dabei schaut das System mit einer 3-D-Kamera auf ihn und zeichnet seine Form, Position, Größe und Konturen auf. Der Algorithmus wertet die Daten aus und positioniert den Patienten optimal in der Scan-Einheit. Das musste bisher das medizinische Personal tun, was Erfahrung und Zeit voraussetzt. "Mit unserem System ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass im ersten Versuch gute Ergebnisse gelingen", sagt Thomas Friese. "Das spart Zeit." Zugleich lasse sich so die Strahlendosis reduzieren, weil Zweituntersuchungen seltener nötig sind.
Beim CT entstehen zudem Schichtaufnahmen des Körpers. Um zu einem Befund zu kommen, muss der Arzt sich am Rechner durch diese Schichten hindurch- scrollen. Ein "Advanced Visualisation System", auf KI-Basis ermöglicht Ärzten, nicht nur entlang der Längsachse zu scrollen, sondern aus verschiedenen Winkeln. So können Ärzte den Verschlussgrad von Gefäßen leichter bewerten.
Auch Firmen wie Philips, GE Healthcare oder Canon bieten KI-unterstützte Systeme an. "Das generelle Ziel ist, so viel assistierende Automatisierung wie möglich einzuführen, damit Radiologen steigende Patientenzahlen, Fachkräftemangel und starken Zeitdruck, besser kompensieren können", sagt Friese. Die KI entlastet uns schon jetzt von einigen Routinetätigkeiten", bestätigt Michael Forsting vom Universitätsklinikum Essen. "Wir setzen KI zum Beispiel ein, um die Entzündungsherde bei Multipler Sklerose im Gehirn zu zählen oder Tumorgrößen zu vermessen." Die KI schaffe in Sekunden, wofür Ärzte mindestens eine Stunde bräuchten.
Datenschutz im Krankenhaus sei etwas für gesunde Menschen, sagen manche Mediziner
Mit der objektiven Vermessung durch eine KI lässt sich die Entwicklung des Tumors genauer verfolgen und ermöglicht so bessere Prognosen. "Bei Gebärmutterhalskrebs können wir mit hoher Wahrscheinlichkeit vorhersagen, ob er bereits gestreut hat - zu einem Zeitpunkt, an dem wir es ohne KI noch nicht sehen konnten," sagt Forsting. Ärzte könnten früher reagieren und den Patienten Screenings ersparen. Ähnlich gut funktioniere die KI bei Prognosen zu Schlaganfällen. Bei einem Lebertumor kann das System berechnen, ob das Organ nach einer Tumorbehandlung wieder funktionstüchtig heranwachsen werde.
Darüber hinaus dürfte die KI die radiologische Forschung vorantreiben, sagt Ben Glocker von der Biomedical Image Analysis Group am Imperial College London. Beim Schädelhirntrauma etwa vermuten Forscher, dass bestimmte, noch nicht genau bekannte Veränderungen im Gehirn auf Langzeitschäden hinweisen. "Da eine KI beim Vergleich von CT-Aufnahmen verschiedener Patienten nicht wie ein Mensch einige wenige, sondern Tausende Parameter berücksichtigen kann, hoffen wir, die genauen Muster für Langzeitschäden zu finden," sagt Glocker.
Allerdings zeigt die KI immer da Schwächen, wo das medizinische Verständnis noch lückenhaft ist. "Zum Beispiel gibt es bei neurodegenerativen Erkrankungen sehr viele Daten, die die Forschung nicht weitergebracht haben - weder in der Therapie noch in der Früherkennung", sagt Glockner. "Je weniger man über eine Erkrankung wie Alzheimer weiß, desto schlechter lassen sich aktuelle KI-Algorithmen trainieren. Diese brauchen verlässliche Grundannahmen über den Zusammenhang von Eingabe- und Ausgabedaten, also von Messwerten und Erkrankung."
an Daten werden sich Schätzungen zufolge bis 2020 jährlich auf der Erde ansammeln. Ein Zettabyte entspricht einer Eins mit 21 Nullen. Das entspricht einer Datenmenge von drei Terabyte oder der Textmenge von drei Millionen Büchern pro Kopf jedes Menschen. 14 Zettabyte oder zwei Terabyte pro Kopf werden Daten aus dem Gesundheitswesen sein, die unter anderem durch hochauflösende Bildgebung und Genomanalytik entstehen werden. So können bei der Analyse eines einzigen Krebsgenoms zwei Terabyte Daten anfallen.
Vermutlich wird KI auch die Bildgebung verbessern. Beim CT oder MRT erstellt erst die Software aus Rohdaten - physikalischen Messungen - Bilder, die ein Mensch verstehen kann. "Womöglich wäre es sinnvoll, zu diesem Ursprung zu gehen und die KI auf die Rohdaten anzusetzen", sagt Glocker. "Wer weiß, welche Erkenntnisse wir mit einer KI dort gewinnen - Muster zu Krankheiten, die bisher völlig unbekannt waren."
Aus ähnlichen Gründen sieht Gernot Marx vom Aachener Universitätsklinikums große Chancen auch in der Intensivmedizin: "Auf einer Intensivstation erhalten wir pro Stunde mehr als 1000 Daten pro Patient, da ist es für Ärzte schwer, auf die entscheidenden Signale zu achten, die auf eine Verschlechterung des Patienten hinweisen." Marx war an der Entwicklung eines Systems beteiligt, das die Daten verschiedener Geräte zusammenführt und so den Einsatz von KI erst ermöglicht. Auch hier besteht Hoffnung, dass die KI unbekannte Zusammenhänge findet, die auf Zustandsänderungen der Patienten hinweisen - und eine frühere Reaktion ermöglichen. Marx will es vermutlich bereits im kommenden Jahr einsetzen.
Die KI-Technik hat allerdings auch ihre Tücken. Schon das Training der Systeme bereitet Schwierigkeiten. So liegen zwarhäufig viele Daten häufig vor, sie sind aber nicht so strukturiert, dass die KI sie nutzen kann - dafür müssten sie annotiert und mit beschreibenden Stichwörtern versehen werden. "Da eine KI vom Ergebnis her trainiert wird, müssen wir uns immer sicher sein, dass ein Patient, dessen Daten einfließen, eine bestimmte Erkrankung tatsächlich hat", sagt Marx. "Wir brauchen also nicht Unmengen an Daten, sondern in diesem Sinne validierte Daten, und das ist der Grund weshalb es so lange dauert, bis die KI in der Medizin Fuß fasst." Unzuverlässige Daten standen wahrscheinlich auch hinter den Schwächen von Watson.
Werden Firmen wie Google eigene Krankhenhäuser bauen?
Auch für Pharma-Unternehmen sind strukturierte Daten viel wert. Die Heidelberger Firma Molecular Health will daher das gesamte biomedizinische Weltwissen strukturiert verfügbar machen. Firmengründer Friedrich von Bohlen sagt: "Jede KI-Technik ist nur so gut wie die Qualität der zugrunde liegenden Daten. Und in der Biomedizin haben wir einen inkompletten Datensatz, weil das Wissen heute nun mal nicht vollständig ist und viele Regeln im System noch unklar sind."
Trotzdem könne sein Unternehmen bereits prognostizieren, welche klinische Studien mit welchen Patienten erfolgversprechend seien: "Das ist eine wichtige Analyse, denn das Scheitern einer Studie heißt für Pharma-Unternehmen, dass mitunter bis zu zehn Jahre Forschung und Milliarden Euro in den Sand gesetzt sind - und nach wie vor scheitern sehr viele Studien". So ist es kein Wunder, warum die molekularen Daten eines einzigen Patienten den Pharmaunternehmen mehrere 10 000 Euro wert sind. Die Daten helfen bei der Suche nach Patienten, die auf einen Wirkstoff besonders gut ansprechen.
Dabei entsteht ein grundlegender Konflikt. Einerseits haben Datenschützer Angst, dass beim Datenaustausch zwischen Kliniken, Forschungseinrichtungen und Unternehmen auch nicht-anonymisierte Daten abgegriffen und verkauft werden können. Auf der anderen Seite dürften Erkrankte von der KI - und somit von der Herausgabe ihrer medizinischen Daten - profitieren. Datenschutz sei etwas für Gesunde, sagen manche Mediziner.
Problematisch wird es, wenn irgendwann Ärzte ganz ersetzt werden sollen
"Natürlich haben alle Angst, dass zum Beispiel Krankenkassen Risikopatienten ablehnen oder höher einstufen", sagt auch Friedrich von Bohlen. "Aber man kann und muss das positiv drehen." Bohlen glaubt, dass sich künftig mehr Menschen freiwillig molekularbiologisch profilieren lassen, wenn sie die Vorteile erst einmal sehen. Zudem könnten sie für ihre Bereitschaft etwas mit reduzierten Kassenbeiträgen belohnt werden. Die Versicherungen wiederum könnte die Vorsorge neu strukturieren, wenn sie wüssten, welche Patienten eine erhöhtes Risiko für bestimmte Erkrankungen hätten - dies wäre ökonomischer, weil der Verlauf einer Krankheit abgemildert werden könnte.
In solchen Visionen stecken freilich viele Konjunktive. Michael Forsting geht davon aus, dass Unternehmen wie Google, die in der KI-Forschung führen und derzeit massiv in Medizintechnik investieren, eigene Krankenhäuser bauen werden, um an valide Daten zu kommen, eine weitere Entwicklung, die Datenschützern Bauchschmerzen bereitet.
Aber auch Ethiker beschäftigen sich bereits mit der KI in der Medizin. Eine lernfähige Technik, die keine Einblicke in den Lernprozess zulässt, hat nun mal gewisse Risiken. Was ist, wenn sie das Falsche lernt? Stefan Heinemann, Theologe und Wirtschaftsethiker an der FOM-Hochschule und der Universitätsmedizin Essen, sieht den technischen Wandel zwar positiv, aber auch kritisch. "Alles, was Patienten hilft, ist zunächst einmal beachtenswert", sagt er. "Die Frage ist eher, wie viel Autonomie wir der KI zugestehen." Problematisch werde es, wenn man irgendwann glaube, Ärzte doch noch ersetzen zu müssen. Es sei keineswegs zu früh, darüber zu debattieren. "Wir müssen uns die Frage stellen, wer dann die Verantwortung trägt. Sie darf nicht wegdelegiert werden.
Ärzte dürften sich nicht allein auf das Urteil der KI verlassen, fordert Heinemann. Sie müssten Aufklärung leisten, wofür sie die KI einsetzen, was diese leisten könne und wo die Grenzen liegen. "Aber es ist auch vollkommen klar: Wenn die Verbindung von KI und Arzt-Expertise zu besseren Ergebnissen führt, und das wird sie in vielen Fällen, dann brauchen Sie sehr gute Argumente, um diese Technik abzulehnen."