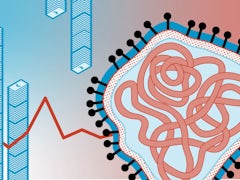David Edmonston dämmerte durch das Fieber. Masern hatten den 13-Jährigen wie viele andere Kinder der Internatsschule nahe Boston niedergestreckt. Er konnte nicht wissen, welche historische Bedeutung ihm zufallen sollte. Aus seinem Blut konnten Wissenschaftler 1954 das Masernvirus isolieren und daraus schließlich den Impfstoff erschaffen, der noch heute unter seinem Namen angewendet wird. Als Edmonston in den 1980er-Jahren Vater wurde, nahm die Geschichte eine bizarre Wendung. Seine Ehefrau, obwohl im Gesundheitswesen beschäftigt, schenkte Gerüchten über die Nebenwirkungen von Impfungen Glauben. Edmonstons Sohn wurde nicht mit dem Impfstoff geschützt, den die Welt seinem Vater verdankte.
Impfskepsis und ihre paradoxen Folgen sind kein neues Phänomen. Doch derzeit sind sie so bedrohlich, dass die EU und die Weltgesundheitsorganisation WHO erstmals einen globalen Impfgipfel einberufen haben. Mehr als 400 Politiker, Wissenschaftler und Vertreter der Zivilgesellschaft suchten in Brüssel Antworten auf die Frage: Wie kann man die Menschen wieder davon überzeugen, dass Impfungen Leben retten, Kindern ein gesundes Aufwachsen ermöglichen und sie - wie es EU-Gesundheitskommissar Vytenis Andriukaitis ausdrückte - als "Akt des Altruismus, der Moral und der Menschlichkeit" präsentieren?

Meinung
Sie schützt nicht nur die eigenen Kinder vor der Krankheit. Mitunter schleppen deutsche Urlauber das Virus auch in andere Länder und lösen Epidemien aus. Solange die Impfung freiwillig ist, wird sie nicht ernst genug genommen.
Wissenschaftlich ist die Lage klar. Weltweit verhindern Impfungen 2,7 Millionen Masernfälle pro Jahr. Und doch bröckelt der Erfolg gerade rasant. "Wir sind an einem entscheidenden Punkt angelangt", sagt WHO-Direktor Tedros Adhanom Ghebreyesus. In den vergangenen drei Jahren haben sieben Länder ihren Status als masernfrei wieder verloren, vier davon in Europa. Auf dem Kontinent hatte man eigentlich 2015 den Beschluss gefasst, die hochansteckende Krankheit bis 2020 auszumerzen. Stattdessen ist die Lage schlecht wie lange nicht: Im ersten Halbjahr 2019 wurden 90 000 Masernfälle registriert. Mehr als 80 Menschen starben in den vergangenen drei Jahren an der Infektion. Gleichzeitig vertrat fast jeder zweite Europäer die Meinung, dass Impfungen häufig schwere Nebenwirkungen haben können.
Falschinformationen verbreiten sich in sozialen Netzwerken schneller als die Viren selbst
Es gehört zu den Paradoxien des Problems, dass ein großer Teil von einer "Minderheit der Minderheit" herrührt, so Jerome Adams, der oberste Public-Health-Experte der USA. In den Vereinigten Staaten sind wie in vielen Ländern Europas noch immer über 90 Prozent gegen die Masern geimpft - eine überwältigende Mehrheit. Die anderen verpassten die Spritze meist aus Vergesslichkeit, Zeitmangel, Lässlichkeit. Harte Impfgegner sind nur wenige von ihnen. "Die größte Herausforderung ist, klarzustellen, dass Impfskepsis eben nicht die Norm ist", sagt Adams. Denn tatsächlich herrscht in der öffentlichen Wahrnehmung der Eindruck vor, dass Skepsis und Ablehnung weit verbreitet sind.
Das liegt vor allem an der enormen Lautstärke der Impfgegner. Durch die sozialen Netzwerke können sich Falschinformationen heute rasanter ausbreiten als die Erreger selbst. Deshalb kooperiert die WHO nun mit deren Betreibern. Facebook hat bereits begonnen, härter gegen Propaganda von Impfgegnern vorzugehen. Gruppen und Seiten, die Falschinformationen verbreiten, werden nicht mehr empfohlen, User werden stattdessen zu vertrauenswürdigen Informationsquellen gelenkt. Werbung, die unwahre Behauptungen enthält, wird nicht mehr akzeptiert.
Doch einfach ist das nicht. Die Botschaften, die die öffentliche Meinung negativ beeinflussen, sind oft rechtlich und sogar wissenschaftlich und moralisch nicht unbedingt angreifbar, sagt Heidi Larson, die seit zehn Jahren das Impfvertrauen im "Vaccine Confidence Project" an der London School of Hygiene and Tropical Medicine erforscht. "Wissen Sie wirklich, was in den Impfungen drin ist?", fragen Impfgegner etwa in ihren Kampagnen. Auf diese Art werde Zweifel und Unsicherheit gesät. "Wir leben in einer Welt des Misstrauens", sagt Larson.
Was also kann man tun? Die Direktorin der europäischen Seuchenschutzbehörde ECDC, Andrea Ammon, sieht drei Hauptaufgaben: Das Narrativ, dass Impfungen umstritten und unsicher seien, zu ändern. Verständlichere Informationen zu schaffen. Und letztlich, Angehörige der Gesundheitsberufe besser für den Umgang mit Impfskeptikern zu rüsten. Man weiß aus Umfragen, dass Ärzte, Schwestern und Hebammen hohes Vertrauen genießen.
Ansätze, mit denen dies erreicht werden kann, gibt es viele. In den USA wurde während der diesjährigen Masernausbrüche medizinisches Personal mit Argumentationshilfen gegen gängige Zweifel ausgestattet. In Belgien werden Impfungen zum breiten Thema im Biologieunterricht. Norwegen hat gute Erfahrungen mit einer verbesserten Organisation gemacht, etwa einem Impfregister, das Patienten und Ärzte aktiv an ausstehende Impfungen erinnert. In manchen Ländern werden Influencer eingesetzt und Social-Media-Kampagnen gestartet.
Die Skepsis verhindert in Pakistan die Ausrottung der Kinderlähmung
Was aber am besten hilft, und ob die Erkenntnisse von Land zu Land übertragbar sind, ist unklar. Dazu kommt, dass die EU - so sehr sie auch eine gemeinsame Haltung für die Impfung demonstriert - sehr unterschiedlich bei den Immunisierungen vorgeht. Innerhalb der Gemeinschaft existiert eine schwer zu überschauende Vielfalt an Impfplänen. Sowohl die Zahl der Impfungen, als auch ihr Beginn und die Kombination der Impfstoffe variieren von Land zu Land.
In die Heterogenität spielen auch Philosophie und Tradition hinein, sagt EU-Gesundheitskommissar Andriukaitis. Das erschwert nicht nur die Situation von EU-Bürgern, die in ein anderes Mitgliedsland ziehen, sondern hinterlässt auch den Eindruck, dass es keinen Konsens über die Bedeutung von Impfungen gibt. Ob eine stärkere Harmonisierung der Impfkalender angestrebt werden sollte, oder man die nationalen Gepflogenheiten beibehalten soll, ist noch nicht geklärt.
So auch die heikelste aller Fragen. Braucht Europa mehr Impfpflichten? Andriukaitis verweist darauf, dass in einigen Ländern die "soziale Kooperation" so hoch ist, dass sich die Frage überhaupt nicht stellt. In anderen aber sieht der scheidende Kommissar durchaus eine "Verantwortung zum Handeln". Für ihn läuft es auf die Grundsatzfrage hinaus: Sind die Politiker bereit, ihre Entscheidungen auf Grundlage der Wissenschaft zu treffen, oder lediglich auf Basis öffentlicher Ansichten?
Konsens ist, dass das Problem des mangelnden Vertrauens nicht von allein verschwindet. Es reicht zudem über Masern und Europa hinaus. "Wir sehen Impfskepsis überall auf der Welt", sagt WHO-Chef Tedros. In der Demokratischen Republik Kongo etwa erschwert sie den Kampf gegen Ebola, in Pakistan die Ausrottung der letzten Fälle von Kinderlähmung. Es soll daher weitere Impfgipfel geben. Hoffnung besteht auf jeden Fall: Edmonston hat die Entscheidung, den Sohn nicht impfen zu lassen, im Alter bereut und sprach sich später öffentlich für Impfungen aus.